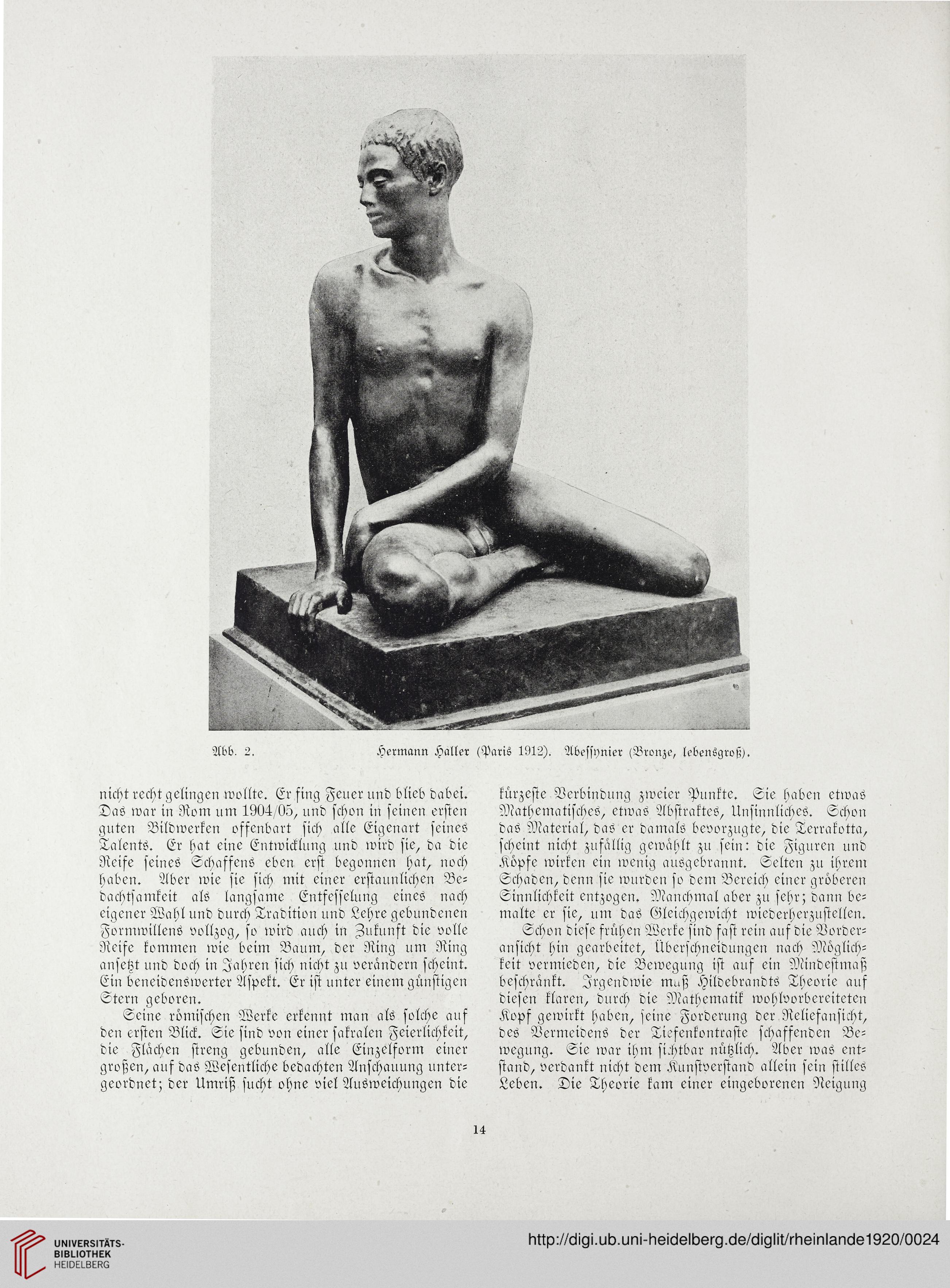Abb, 2. Hermann Haller (Paris 1912). Abessynier (Bronze, lebensgroß).
nicht recht gelingen wollte. Er sing Feuer und blieb dabei.
Das war in Rom um 1904/05, und schon in seinen erften
guten Bildwerken ossenbart sich alle Eigenart seines
Talents. Er hat eine Entwicklung und wird sie, da die
Reife seines Schaffens eben erst begonnen hat, noch
haben. Aber wie sie sich mit einer erstaunlichen Be-
dachtsamkeit als langsame Entsesselung eines nach
eigener Wahl und durch Tradition und Lehre gebundenen
Formwillens vollzog, so wird auch in Aukunft die volle
Reife kommen wie beim Baum, der Ring um Ring
ansetzt und doch in Jahren sich nicht zu verändern scheint.
Ein beneidenswerter Aspekt. Er ist unter einem günstigen
Stern geboren.
Seine römischen Werke erkennt man als solche auf
den ersten Blick. Sie sind von einer sakralen Feierlichkeit,
die Flächen streng gebunden, alle Einzelform einer
großen, auf das Wesentliche bedachten Anschauung unter-
geordnet; der Umriß sucht ohne viel Ausweichungen die
kürzeste Verbindung zweier Punkte. Sie haben etwas
Mathematisches, etwas Abstraktes, Unsinnliches. Schon
das Material, das er damals bevorzugte, die Terrakotta,
scheint nicht zufällig gewählt zu sein: die Figuren und
Köpfe wirken ein wenig ausgebrannt. Selten zu ihrem
Schaden, denn sie wurden so dem Bereich einer gröberen
Sinnlichkeit entzogen. Manchmal aber zu sehr; dann be-
malte er sie, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Schon diese frühen Werke sind fast rein auf die Vorder-
ansicht hin gearbeitet, Überschneidungen nach Möglich-
keit vermieden, die Bewegung ist auf ein Mindestmaß
beschränkt. Jrgendwie Muß Hildebrandts Theorie auf
diesen klaren, durch die Mathematik wohlvorbereiteten
Kopf gewirkt haben, seine Forderung der Reliefansicht,
des Vermeidens der Tiefenkontraste schaffenden Be-
wegung. Sie war ihm sichtbar nützlich. Aber was ent-
stand, verdankt nicht dem Kunstverstand allein sein stilles
Leben. Die Theorie kam einer eingeborenen Neigung
14
nicht recht gelingen wollte. Er sing Feuer und blieb dabei.
Das war in Rom um 1904/05, und schon in seinen erften
guten Bildwerken ossenbart sich alle Eigenart seines
Talents. Er hat eine Entwicklung und wird sie, da die
Reife seines Schaffens eben erst begonnen hat, noch
haben. Aber wie sie sich mit einer erstaunlichen Be-
dachtsamkeit als langsame Entsesselung eines nach
eigener Wahl und durch Tradition und Lehre gebundenen
Formwillens vollzog, so wird auch in Aukunft die volle
Reife kommen wie beim Baum, der Ring um Ring
ansetzt und doch in Jahren sich nicht zu verändern scheint.
Ein beneidenswerter Aspekt. Er ist unter einem günstigen
Stern geboren.
Seine römischen Werke erkennt man als solche auf
den ersten Blick. Sie sind von einer sakralen Feierlichkeit,
die Flächen streng gebunden, alle Einzelform einer
großen, auf das Wesentliche bedachten Anschauung unter-
geordnet; der Umriß sucht ohne viel Ausweichungen die
kürzeste Verbindung zweier Punkte. Sie haben etwas
Mathematisches, etwas Abstraktes, Unsinnliches. Schon
das Material, das er damals bevorzugte, die Terrakotta,
scheint nicht zufällig gewählt zu sein: die Figuren und
Köpfe wirken ein wenig ausgebrannt. Selten zu ihrem
Schaden, denn sie wurden so dem Bereich einer gröberen
Sinnlichkeit entzogen. Manchmal aber zu sehr; dann be-
malte er sie, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Schon diese frühen Werke sind fast rein auf die Vorder-
ansicht hin gearbeitet, Überschneidungen nach Möglich-
keit vermieden, die Bewegung ist auf ein Mindestmaß
beschränkt. Jrgendwie Muß Hildebrandts Theorie auf
diesen klaren, durch die Mathematik wohlvorbereiteten
Kopf gewirkt haben, seine Forderung der Reliefansicht,
des Vermeidens der Tiefenkontraste schaffenden Be-
wegung. Sie war ihm sichtbar nützlich. Aber was ent-
stand, verdankt nicht dem Kunstverstand allein sein stilles
Leben. Die Theorie kam einer eingeborenen Neigung
14