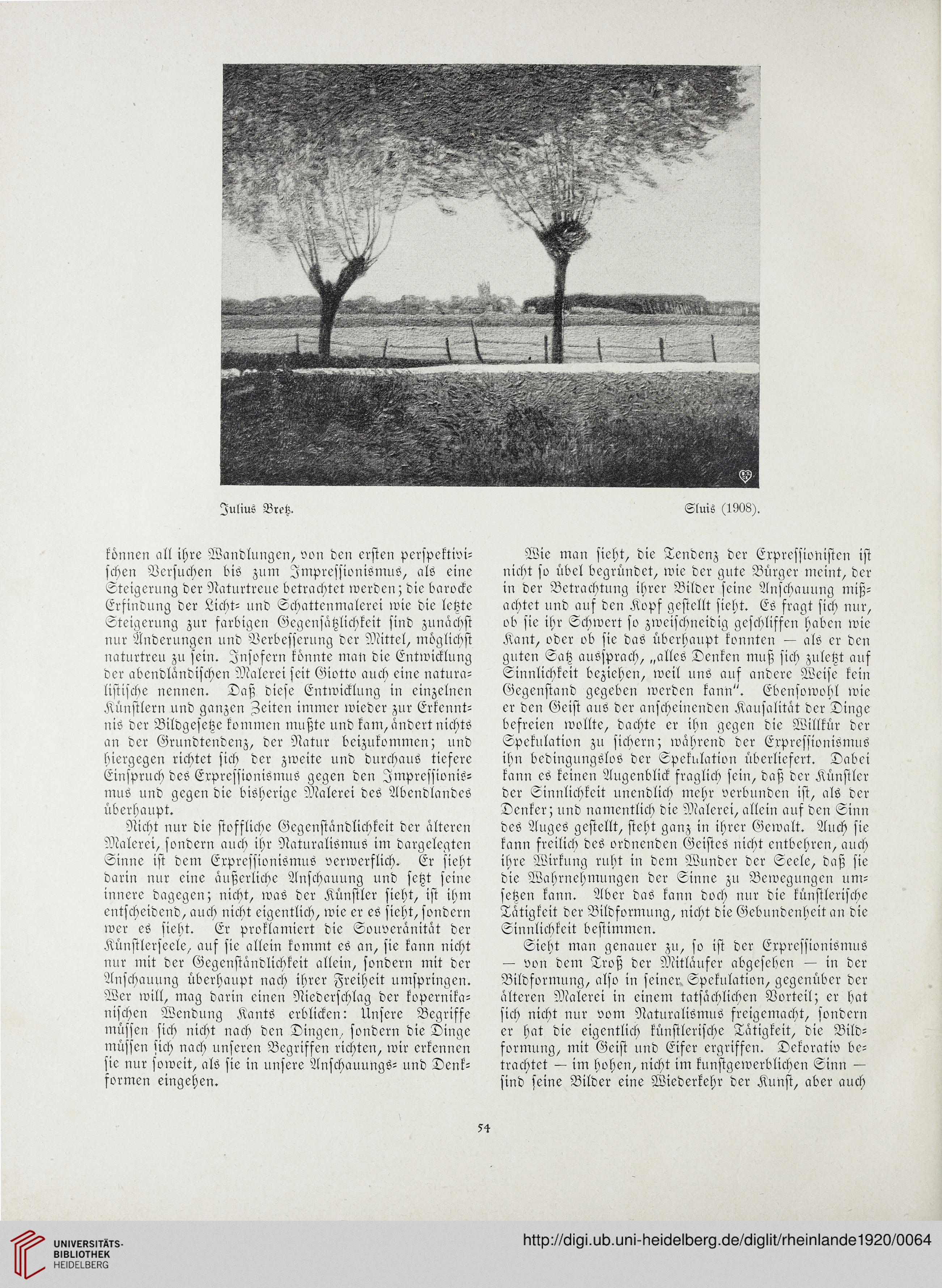Julius Bretz.
Sluis (1908).
können all ihre Wandlungen, von den ersten perspektivi-
schen Versuchen bis zum Jmpressionismus, als eine
Steigerung der Naturtreue betrachtet werden; die barocke
Ersindung der Licht- und Schattenmalerei wie die letzte
Steigerung zur sarbigen Gegensätzlichkeit sind zunächst
nur Änderungen und Verbesserung der Mittel, möglichst
naturtreu zu sein. Insofern könnte ncan die Entwicklung
der abendländischen Malerei seit Giotto auch eine natura-
listische nennen. Daß diese Entwicklung in einzelnen
Künstlern und ganzen Aeiten immer wieder zur Erkennt-
nis der Bildgesetze kommen mußte und kam, ändert nichts
an der Grundtendenz, der Natur beizukommen; und
hiergegen richtet sich der zweite und durchaus tiefere
Einspruch des Erpressionismus gegen den Impressionis-
mus und gegen die bisherige Malerei des Abendlandes
überhaupt.
Nicht nur die stoffliche Gegenständlichkeit der älteren
Malerei, sondern auch ihr Naturalismus im dargelegten
Sinne ist dem Erpressionismus verwerflich. Er sieht
darin nur eine äußerliche Anschauung und setzt seine
innere dagegen; nicht, was der Künstler sieht, ist ihm
entscheidend, auch nicht eigentlich, wie er es sieht, sondern
wer es sieht. Er proklamiert die Souveränität der
Künstlerseele, auf sie allein kommt es an, sie kann nicht
nur mit der Gegenständlichkeit allein, sondern mit der
Anschauung überhaupt nach ihrer Freiheit umspringen.
Wer will, mag darin einen Niederschlag der kopernika-
nischen Wendung Kants erblicken: Unsere Begriffe
müssen sich nicht nach den Dingen, sondern die Dinge
müssen sich nach unseren Begriffen richten, wir erkennen
sie nur soweit, als sie in unsere AnschauuNgs- und Denk-
formen eingehen.
Wie man sieht, die Tendenz der Erpressionisten ist
nicht so übel begründet, wie der gute Bürger meint, der
in der Betrachtung ihrer Bilder seine Anschauung miß-
achtet und auf den Kopf gestellt sieht. Es fragt sich nur,
ob sie ihr Schwert so zweischneidig geschliffen haben wie
Kant, oder ob sie das überhaupt konnten — als er den
guten Satz aussprach, „alles Denken muß sich zuletzt auf
Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein
Gegenstand gegeben werden kann". Ebensowohl wie
er den Geist aus der anscheinenden Kausalität der Dinge
befreien wollte, dachte er ihn gegen die Willkür der
Spekulation zu sichern; während der Erpressionismus
ihn bedingungslos der Spekulation überliefert. Dabei
kann es keinen Augenblick fraglich sein, daß der Künstler
der Sinnlichkeit unendlich mehr verbunden ist, als der
Denker; und namentlich die Malerei, allein auf den Sinn
des Auges gestellt, steht ganz in ihrer Gewalt. Auch sie
kann freilich des ordnenden Geistes nicht entbehren, auch
ihre Wirkung ruht in dem Wunder der Seele, daß sie
die Wahrnehmungen der Sinne zu Bewegungen um-
setzen kann. Aber das kann doch nur die künstlerische
Tätigkeit der Bildformung, nicht die Gebundenheit an die
Sinnlichkeit bestimmen.
Sieht man genauer zu, so ist der Erpressionismus
— von dem Troß der Mitläufer abgesehen — in der
Bildformung, also in seiner, Spekulation, gegenüber der
älteren Malerei in einem tatsächlichen Vorteil; er hat
sich nicht nur vom Naturalismus freigemacht, sondern
er hat die eigentlich künstlerische Tätigkeit, die Bild-
formung, mit Geist und Eifer ergriffen. Dekorativ be-
trachtet — im hohen, nicht im kunstgewerblichen Sinn —
sind seine Bilder eine Wiederkehr der Kunst, aber auch
54
Sluis (1908).
können all ihre Wandlungen, von den ersten perspektivi-
schen Versuchen bis zum Jmpressionismus, als eine
Steigerung der Naturtreue betrachtet werden; die barocke
Ersindung der Licht- und Schattenmalerei wie die letzte
Steigerung zur sarbigen Gegensätzlichkeit sind zunächst
nur Änderungen und Verbesserung der Mittel, möglichst
naturtreu zu sein. Insofern könnte ncan die Entwicklung
der abendländischen Malerei seit Giotto auch eine natura-
listische nennen. Daß diese Entwicklung in einzelnen
Künstlern und ganzen Aeiten immer wieder zur Erkennt-
nis der Bildgesetze kommen mußte und kam, ändert nichts
an der Grundtendenz, der Natur beizukommen; und
hiergegen richtet sich der zweite und durchaus tiefere
Einspruch des Erpressionismus gegen den Impressionis-
mus und gegen die bisherige Malerei des Abendlandes
überhaupt.
Nicht nur die stoffliche Gegenständlichkeit der älteren
Malerei, sondern auch ihr Naturalismus im dargelegten
Sinne ist dem Erpressionismus verwerflich. Er sieht
darin nur eine äußerliche Anschauung und setzt seine
innere dagegen; nicht, was der Künstler sieht, ist ihm
entscheidend, auch nicht eigentlich, wie er es sieht, sondern
wer es sieht. Er proklamiert die Souveränität der
Künstlerseele, auf sie allein kommt es an, sie kann nicht
nur mit der Gegenständlichkeit allein, sondern mit der
Anschauung überhaupt nach ihrer Freiheit umspringen.
Wer will, mag darin einen Niederschlag der kopernika-
nischen Wendung Kants erblicken: Unsere Begriffe
müssen sich nicht nach den Dingen, sondern die Dinge
müssen sich nach unseren Begriffen richten, wir erkennen
sie nur soweit, als sie in unsere AnschauuNgs- und Denk-
formen eingehen.
Wie man sieht, die Tendenz der Erpressionisten ist
nicht so übel begründet, wie der gute Bürger meint, der
in der Betrachtung ihrer Bilder seine Anschauung miß-
achtet und auf den Kopf gestellt sieht. Es fragt sich nur,
ob sie ihr Schwert so zweischneidig geschliffen haben wie
Kant, oder ob sie das überhaupt konnten — als er den
guten Satz aussprach, „alles Denken muß sich zuletzt auf
Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein
Gegenstand gegeben werden kann". Ebensowohl wie
er den Geist aus der anscheinenden Kausalität der Dinge
befreien wollte, dachte er ihn gegen die Willkür der
Spekulation zu sichern; während der Erpressionismus
ihn bedingungslos der Spekulation überliefert. Dabei
kann es keinen Augenblick fraglich sein, daß der Künstler
der Sinnlichkeit unendlich mehr verbunden ist, als der
Denker; und namentlich die Malerei, allein auf den Sinn
des Auges gestellt, steht ganz in ihrer Gewalt. Auch sie
kann freilich des ordnenden Geistes nicht entbehren, auch
ihre Wirkung ruht in dem Wunder der Seele, daß sie
die Wahrnehmungen der Sinne zu Bewegungen um-
setzen kann. Aber das kann doch nur die künstlerische
Tätigkeit der Bildformung, nicht die Gebundenheit an die
Sinnlichkeit bestimmen.
Sieht man genauer zu, so ist der Erpressionismus
— von dem Troß der Mitläufer abgesehen — in der
Bildformung, also in seiner, Spekulation, gegenüber der
älteren Malerei in einem tatsächlichen Vorteil; er hat
sich nicht nur vom Naturalismus freigemacht, sondern
er hat die eigentlich künstlerische Tätigkeit, die Bild-
formung, mit Geist und Eifer ergriffen. Dekorativ be-
trachtet — im hohen, nicht im kunstgewerblichen Sinn —
sind seine Bilder eine Wiederkehr der Kunst, aber auch
54