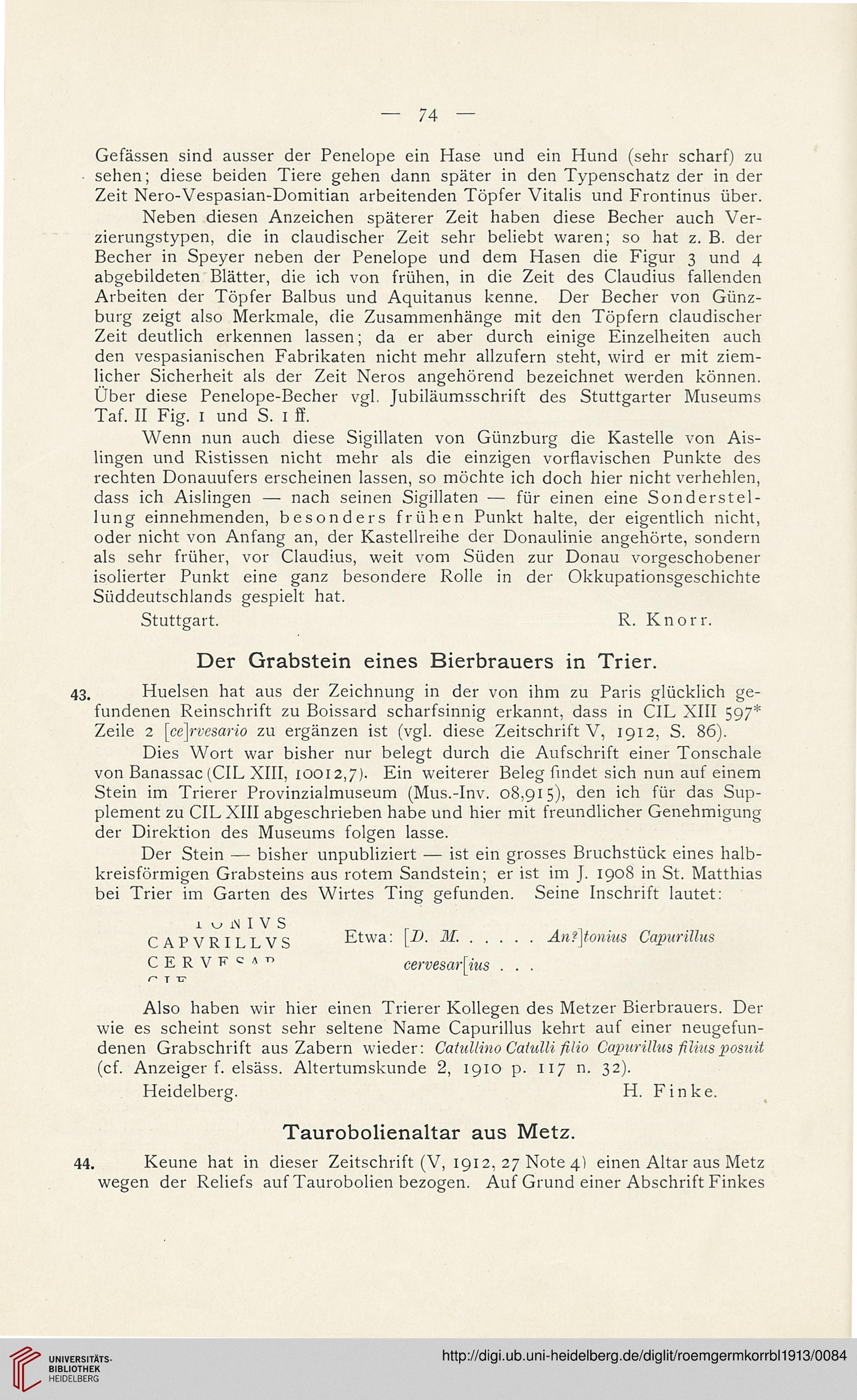7 4
Gefässen sind ausser der Penelope ein Hase und ein Hund (sehr scharf) zu
• sehen; diese beiden Tiere gehen dann später in den Typenschatz der in der
Zeit Nero-Vespasian-Domitian arbeitenden Töpfer Vitalis und Frontinus über.
Neben diesen Anzeichen späterer Zeit haben diese Becher auch Ver-
zierungstypen, die in claudischer Zeit sehr beliebt waren; so hat z. B. der
Becher in Speyer neben der Penelope und dem Hasen die Figur 3 und 4
abgebildeten Blätter, die ich von frühen, in die Zeit des Claudius fallenden
Arbeiten der Töpfer Balbus und Aquitanus kenne. Der Becher von Günz-
burg zeigt also Merkmale, die Zusammenhänge mit den Töpfern claudischer
Zeit deutlich erkennen lassen; da er aber durch einige Einzelheiten auch
den vespasianischen Fabrikaten nicht mehr allzufern steht, wird er mit ziem-
licher Sicherheit als der Zeit Neros angehörend bezeichnet werden können.
Über diese Penelope-Becher vgl. Jubiläumsschrift des Stuttgarter Museums
Taf. II Fig. 1 und S. 1 ff.
Wenn nun auch diese Sigillaten von Günzburg die Kastelle von Ais-
lingen und Ristissen nicht mehr als die einzigen vorflavischen Punkte des
rechten Donauufers erscheinen lassen, so möchte ich doch hier nicht verhehlen,
dass ich Aislingen — nach seinen Sigillaten — für einen eine Sonderstel-
lung einnehmenden, besonders frühen Punkt halte, der eigentlich nicht,
oder nicht von Anfang an, der Kastellreihe der Donaulinie angehörte, sondern
als sehr früher, vor Claudius, weit vom Süden zur Donau vorgeschobener
isolierter Punkt eine ganz besondere Rolle in der Okkupationsgeschichte
Süddeutschlands gespielt hat.
Stuttgart. R. Knorr.
Der Grabstein eines Bierbrauers in Trier.
43. Huelsen hat aus der Zeichnung in der von ihm zu Paris glücklich ge-
fundenen Reinschrift zu Boissard scharfsinnig erkannt, dass in CIL XIII 597*
Zeile 2 [ce]rvesario zu ergänzen ist (vgl. diese Zeitschrift V, 1912, S. 86).
Dies Wort war bisher nur belegt durch die Aufschrift einer Tonschale
von Banassac(CIL XIII, 10012,7). Ein weiterer Beleg findet sich nun auf einem
Stein im Trierer Provinzialmuseum (Mus.-Inv. 08,915), den ich für das Sup-
plement zu CILXIII abgeschrieben habe und hier mit freundlicher Genehmigung
der Direktion des Museums folgen lasse.
Der Stein — bisher unpubliziert — ist ein grosses Bruchstück eines halb-
kreisförmigen Grabsteins aus rotem Sandstein; er ist im J. 1908 in St. Matthias
bei Trier im Garten des Wirtes Ting gefunden. Seine Inschrift Iautet:
Etwa: [D. M..Anfjtonius Capurillus
cervesar[ius . . .
Also haben wir hier einen Trierer Kollegen des Metzer Bierbrauers. Der
wie es scheint sonst sehr seltene Name Capurillus kehrt auf einer neugefun-
denen Grabschrift aus Zabern wieder: Catullino Caiulli filio Capurillus filius posuit
(cf. Anzeiger f. elsäss. Altertumskunde 2, 1910 p. 117 n. 32).
Heidelberg. H. Finke.
Taurobolienaltar aus Metz.
44. Keune hat in dieser Zeitschrift (V, 1912, 27 Note 4) einen Altar aus Metz
wegen der Reliefs auf Taurobolien bezogen. Auf Grund einer Abschrift Finkes
1 uiUVS
CAPVRILLVS
CERVF'*"
r t ir
Gefässen sind ausser der Penelope ein Hase und ein Hund (sehr scharf) zu
• sehen; diese beiden Tiere gehen dann später in den Typenschatz der in der
Zeit Nero-Vespasian-Domitian arbeitenden Töpfer Vitalis und Frontinus über.
Neben diesen Anzeichen späterer Zeit haben diese Becher auch Ver-
zierungstypen, die in claudischer Zeit sehr beliebt waren; so hat z. B. der
Becher in Speyer neben der Penelope und dem Hasen die Figur 3 und 4
abgebildeten Blätter, die ich von frühen, in die Zeit des Claudius fallenden
Arbeiten der Töpfer Balbus und Aquitanus kenne. Der Becher von Günz-
burg zeigt also Merkmale, die Zusammenhänge mit den Töpfern claudischer
Zeit deutlich erkennen lassen; da er aber durch einige Einzelheiten auch
den vespasianischen Fabrikaten nicht mehr allzufern steht, wird er mit ziem-
licher Sicherheit als der Zeit Neros angehörend bezeichnet werden können.
Über diese Penelope-Becher vgl. Jubiläumsschrift des Stuttgarter Museums
Taf. II Fig. 1 und S. 1 ff.
Wenn nun auch diese Sigillaten von Günzburg die Kastelle von Ais-
lingen und Ristissen nicht mehr als die einzigen vorflavischen Punkte des
rechten Donauufers erscheinen lassen, so möchte ich doch hier nicht verhehlen,
dass ich Aislingen — nach seinen Sigillaten — für einen eine Sonderstel-
lung einnehmenden, besonders frühen Punkt halte, der eigentlich nicht,
oder nicht von Anfang an, der Kastellreihe der Donaulinie angehörte, sondern
als sehr früher, vor Claudius, weit vom Süden zur Donau vorgeschobener
isolierter Punkt eine ganz besondere Rolle in der Okkupationsgeschichte
Süddeutschlands gespielt hat.
Stuttgart. R. Knorr.
Der Grabstein eines Bierbrauers in Trier.
43. Huelsen hat aus der Zeichnung in der von ihm zu Paris glücklich ge-
fundenen Reinschrift zu Boissard scharfsinnig erkannt, dass in CIL XIII 597*
Zeile 2 [ce]rvesario zu ergänzen ist (vgl. diese Zeitschrift V, 1912, S. 86).
Dies Wort war bisher nur belegt durch die Aufschrift einer Tonschale
von Banassac(CIL XIII, 10012,7). Ein weiterer Beleg findet sich nun auf einem
Stein im Trierer Provinzialmuseum (Mus.-Inv. 08,915), den ich für das Sup-
plement zu CILXIII abgeschrieben habe und hier mit freundlicher Genehmigung
der Direktion des Museums folgen lasse.
Der Stein — bisher unpubliziert — ist ein grosses Bruchstück eines halb-
kreisförmigen Grabsteins aus rotem Sandstein; er ist im J. 1908 in St. Matthias
bei Trier im Garten des Wirtes Ting gefunden. Seine Inschrift Iautet:
Etwa: [D. M..Anfjtonius Capurillus
cervesar[ius . . .
Also haben wir hier einen Trierer Kollegen des Metzer Bierbrauers. Der
wie es scheint sonst sehr seltene Name Capurillus kehrt auf einer neugefun-
denen Grabschrift aus Zabern wieder: Catullino Caiulli filio Capurillus filius posuit
(cf. Anzeiger f. elsäss. Altertumskunde 2, 1910 p. 117 n. 32).
Heidelberg. H. Finke.
Taurobolienaltar aus Metz.
44. Keune hat in dieser Zeitschrift (V, 1912, 27 Note 4) einen Altar aus Metz
wegen der Reliefs auf Taurobolien bezogen. Auf Grund einer Abschrift Finkes
1 uiUVS
CAPVRILLVS
CERVF'*"
r t ir