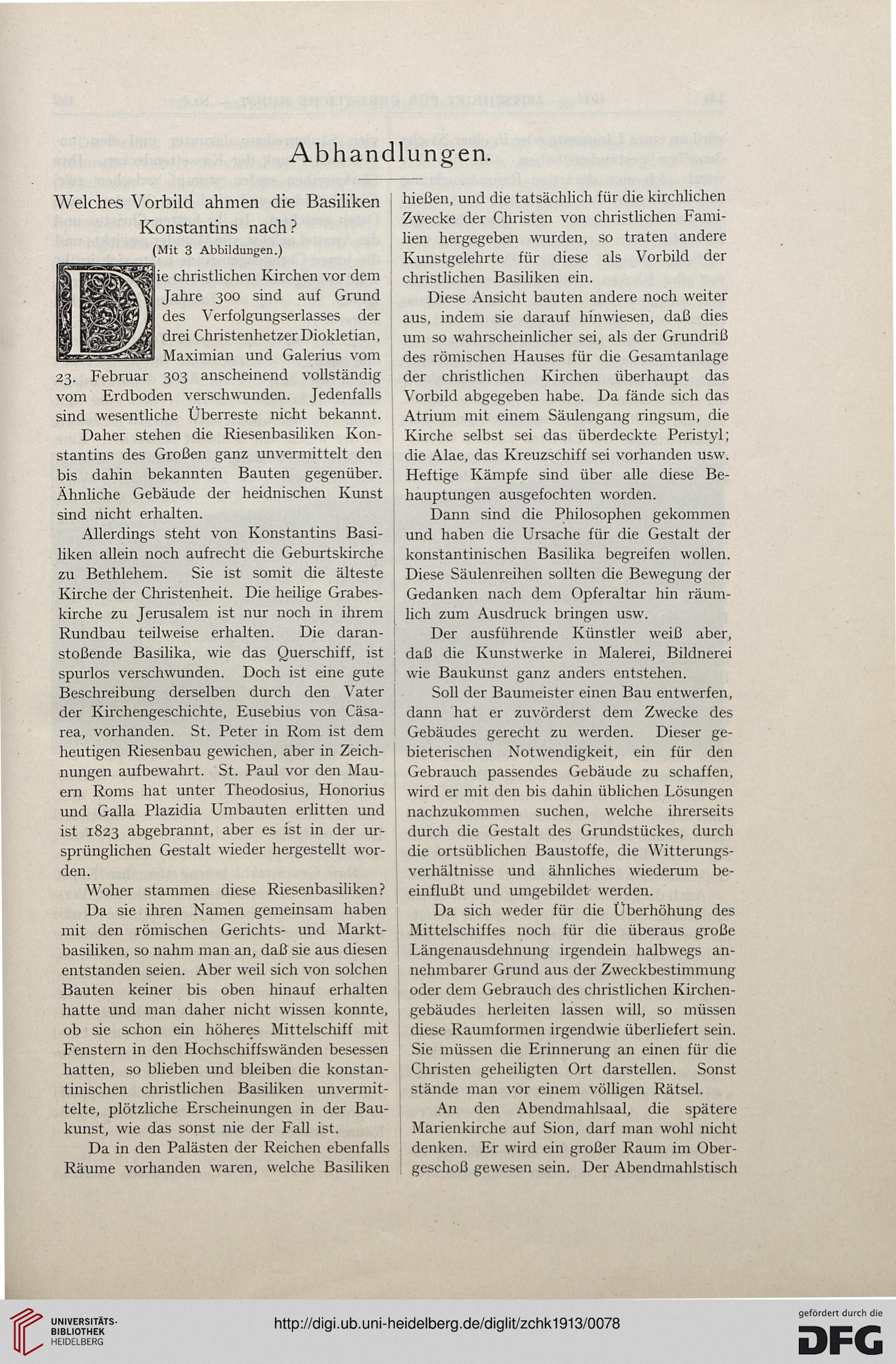Abhandlungen.
Welches Vorbild ahmen die Basiliken
Konstantins nach?
(Mit 3 Abbildungen.)
j ie christlichen Kirchen vor dem
Jahre 300 sind auf Grund
des Verfolgungserlasses der
drei Christenhetzer Diokletian,
Maximian und Galerius vom
23. Februar 303 anscheinend vollständig
vom Erdboden verschwunden. Jedenfalls
sind wesentliche Überreste nicht bekannt.
Daher stehen die Riesenbasiliken Kon-
stantins des Großen ganz unvermittelt den
bis dahin bekannten Bauten gegenüber.
Ähnliche Gebäude der heidnischen Kunst
sind nicht erhalten.
Allerdings steht von Konstantins Basi-
liken allein noch aufrecht die Geburtskirche
zu Bethlehem. Sie ist somit die älteste
Kirche der Christenheit. Die heilige Grabes-
kirche zu Jerusalem ist nur noch in ihrem
Rundbau teilweise erhalten. Die daran-
stoßende Basilika, wie das Ouerschiff, ist
spurlos verschwunden. Doch ist eine gute
Beschreibung derselben durch den Vater
der Kirchengeschichte, Eusebius von Cäsa-
rea, vorhanden. St. Peter in Rom ist dem
heutigen Riesenbau gewichen, aber in Zeich-
nungen aufbewahrt. St. Paul vor den Mau-
ern Roms hat unter Theodosius, Honorius
und Galla Plazidia Umbauten erlitten und
ist 1823 abgebrannt, aber es ist in der ur-
sprünglichen Gestalt wieder hergestellt wor-
den.
Woher stammen diese Riesenbasiliken?
Da sie ihren Namen gemeinsam haben
mit den römischen Gerichts- und Markt-
basiliken, so nahm man an, daß sie aus diesen
entstanden seien. Aber weil sich von solchen
Bauten keiner bis oben hinauf erhalten
hatte und man daher nicht wissen konnte,
ob sie schon ein höheres Mittelschiff mit
Fenstern in den Hochschiffswänden besessen
hatten, so blieben und bleiben die konstan-
tinischen christlichen Basiliken unvermit-
telte, plötzliche Erscheinungen in der Bau-
kunst, wie das sonst nie der Fall ist.
Da in den Palästen der Reichen ebenfalls
Räume vorhanden waren, welche Basiliken
hießen, und die tatsächlich für die kirchlichen
Zwecke der Christen von christlichen Fami-
lien hergegeben wurden, so traten andere
Kunstgelehrte für diese als Vorbild der
christlichen Basiliken ein.
Diese Ansicht bauten andere noch weiter
aus, indem sie darauf hinwiesen, daß dies
um so wahrscheinlicher sei, als der Grundriß
des römischen Hauses für die Gesamtanlage
der christlichen Kirchen überhaupt das
Vorbild abgegeben habe. Da fände sich das
Atrium mit einem Säulengang ringsum, die
Kirche selbst sei das überdeckte Peristyl;
die Alae, das Kreuzschiff sei vorhanden usw.
Heftige Kämpfe sind über alle diese Be-
hauptungen ausgefochten worden.
Dann sind die Philosophen gekommen
und haben die Ursache für die Gestalt der
konstantinischen Basilika begreifen wollen.
Diese Säulenreihen sollten die Bewegung der
Gedanken nach dem Opferaltar hin räum-
lich zum Ausdruck bringen usw.
Der ausführende Künstler weiß aber,
daß die Kunstwerke in Malerei, Bildnerei
wie Baukunst ganz anders entstehen.
Soll der Baumeister einen Bau entwerfen,
dann hat er zuvörderst dem Zwecke des
Gebäudes gerecht zu werden. Dieser ge-
bieterischen Notwendigkeit, ein für den
Gebrauch passendes Gebäude zu schaffen,
wird er mit den bis dahin üblichen Lösungen
nachzukommen suchen, welche ihrerseits
durch die Gestalt des Grundstückes, durch
die ortsüblichen Baustoffe, die Witterungs-
verhältnisse und ähnliches wiederum be-
einflußt und umgebildet werden.
Da sich weder für die Überhöhung des
Mittelschiffes noch für die überaus große
Längenausdehnung irgendein halbwegs an-
nehmbarer Grund aus der Zweckbestimmung
oder dem Gebrauch des christlichen Kirchen-
gebäudes herleiten lassen will, so müssen
diese Raumformen irgendwie überliefert sein.
Sie müssen die Erinnerung an einen für die
Christen geheiligten Ort darstellen. Sonst
stände man vor einem völligen Rätsel.
An den Abendmahlsaal, die spätere
Marienkirche auf Sion, darf man wohl nicht
denken. Er wird ein großer Raum im Ober-
geschoß gewesen sein. Der Abendmahlstisch
Welches Vorbild ahmen die Basiliken
Konstantins nach?
(Mit 3 Abbildungen.)
j ie christlichen Kirchen vor dem
Jahre 300 sind auf Grund
des Verfolgungserlasses der
drei Christenhetzer Diokletian,
Maximian und Galerius vom
23. Februar 303 anscheinend vollständig
vom Erdboden verschwunden. Jedenfalls
sind wesentliche Überreste nicht bekannt.
Daher stehen die Riesenbasiliken Kon-
stantins des Großen ganz unvermittelt den
bis dahin bekannten Bauten gegenüber.
Ähnliche Gebäude der heidnischen Kunst
sind nicht erhalten.
Allerdings steht von Konstantins Basi-
liken allein noch aufrecht die Geburtskirche
zu Bethlehem. Sie ist somit die älteste
Kirche der Christenheit. Die heilige Grabes-
kirche zu Jerusalem ist nur noch in ihrem
Rundbau teilweise erhalten. Die daran-
stoßende Basilika, wie das Ouerschiff, ist
spurlos verschwunden. Doch ist eine gute
Beschreibung derselben durch den Vater
der Kirchengeschichte, Eusebius von Cäsa-
rea, vorhanden. St. Peter in Rom ist dem
heutigen Riesenbau gewichen, aber in Zeich-
nungen aufbewahrt. St. Paul vor den Mau-
ern Roms hat unter Theodosius, Honorius
und Galla Plazidia Umbauten erlitten und
ist 1823 abgebrannt, aber es ist in der ur-
sprünglichen Gestalt wieder hergestellt wor-
den.
Woher stammen diese Riesenbasiliken?
Da sie ihren Namen gemeinsam haben
mit den römischen Gerichts- und Markt-
basiliken, so nahm man an, daß sie aus diesen
entstanden seien. Aber weil sich von solchen
Bauten keiner bis oben hinauf erhalten
hatte und man daher nicht wissen konnte,
ob sie schon ein höheres Mittelschiff mit
Fenstern in den Hochschiffswänden besessen
hatten, so blieben und bleiben die konstan-
tinischen christlichen Basiliken unvermit-
telte, plötzliche Erscheinungen in der Bau-
kunst, wie das sonst nie der Fall ist.
Da in den Palästen der Reichen ebenfalls
Räume vorhanden waren, welche Basiliken
hießen, und die tatsächlich für die kirchlichen
Zwecke der Christen von christlichen Fami-
lien hergegeben wurden, so traten andere
Kunstgelehrte für diese als Vorbild der
christlichen Basiliken ein.
Diese Ansicht bauten andere noch weiter
aus, indem sie darauf hinwiesen, daß dies
um so wahrscheinlicher sei, als der Grundriß
des römischen Hauses für die Gesamtanlage
der christlichen Kirchen überhaupt das
Vorbild abgegeben habe. Da fände sich das
Atrium mit einem Säulengang ringsum, die
Kirche selbst sei das überdeckte Peristyl;
die Alae, das Kreuzschiff sei vorhanden usw.
Heftige Kämpfe sind über alle diese Be-
hauptungen ausgefochten worden.
Dann sind die Philosophen gekommen
und haben die Ursache für die Gestalt der
konstantinischen Basilika begreifen wollen.
Diese Säulenreihen sollten die Bewegung der
Gedanken nach dem Opferaltar hin räum-
lich zum Ausdruck bringen usw.
Der ausführende Künstler weiß aber,
daß die Kunstwerke in Malerei, Bildnerei
wie Baukunst ganz anders entstehen.
Soll der Baumeister einen Bau entwerfen,
dann hat er zuvörderst dem Zwecke des
Gebäudes gerecht zu werden. Dieser ge-
bieterischen Notwendigkeit, ein für den
Gebrauch passendes Gebäude zu schaffen,
wird er mit den bis dahin üblichen Lösungen
nachzukommen suchen, welche ihrerseits
durch die Gestalt des Grundstückes, durch
die ortsüblichen Baustoffe, die Witterungs-
verhältnisse und ähnliches wiederum be-
einflußt und umgebildet werden.
Da sich weder für die Überhöhung des
Mittelschiffes noch für die überaus große
Längenausdehnung irgendein halbwegs an-
nehmbarer Grund aus der Zweckbestimmung
oder dem Gebrauch des christlichen Kirchen-
gebäudes herleiten lassen will, so müssen
diese Raumformen irgendwie überliefert sein.
Sie müssen die Erinnerung an einen für die
Christen geheiligten Ort darstellen. Sonst
stände man vor einem völligen Rätsel.
An den Abendmahlsaal, die spätere
Marienkirche auf Sion, darf man wohl nicht
denken. Er wird ein großer Raum im Ober-
geschoß gewesen sein. Der Abendmahlstisch