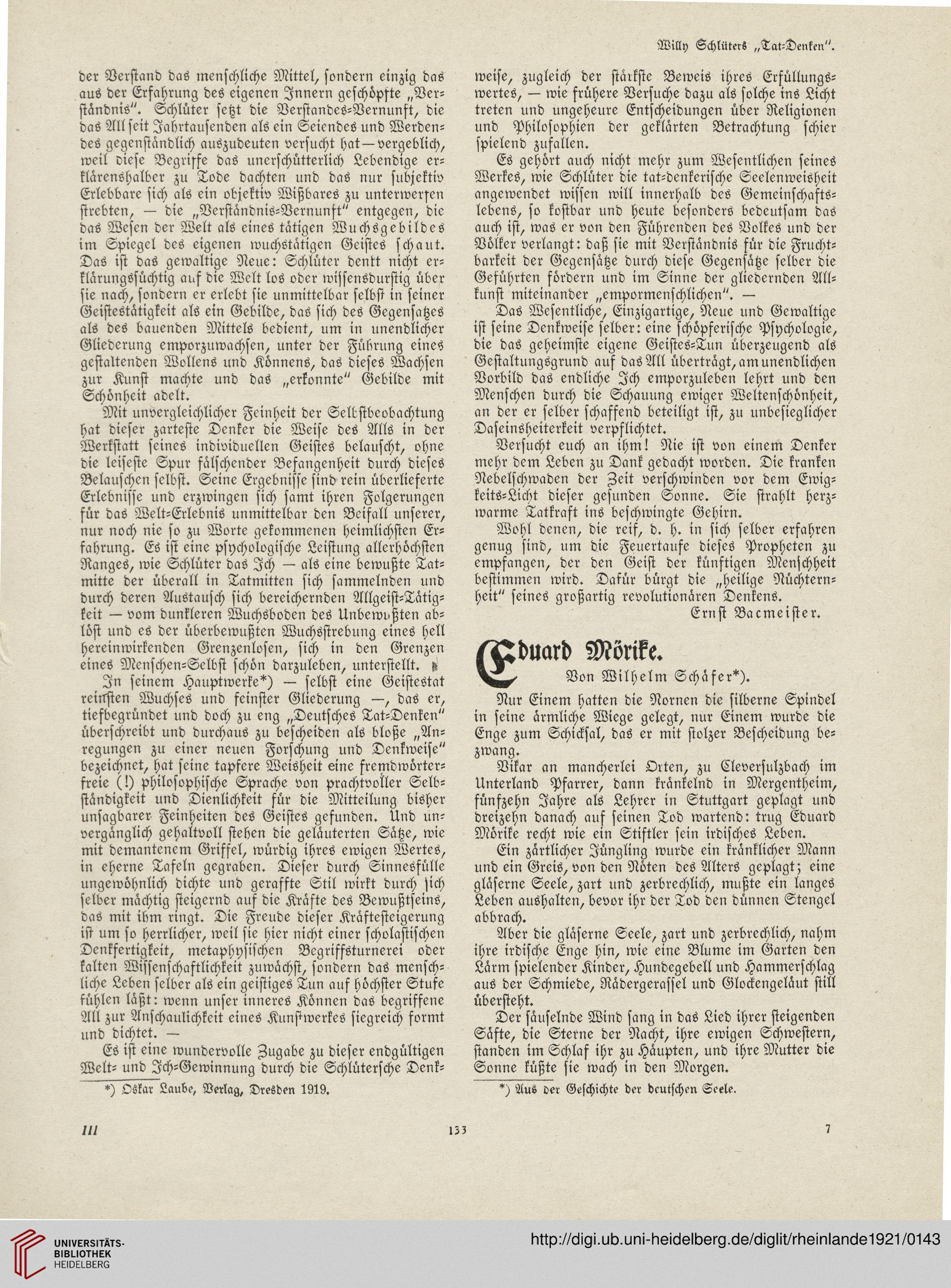Willy Schlüters „Tat-Denken".
der Verstand das menschliche Mittel, sondern einzig das
aus der Erfahrung des eigenen Innern geschöpfte „Ver-
ständnis". Schlüter setzt die Verstandes-Vernunft, die
das All seit Jahrtausenden als ein Seiendes und Werden-
des gegenständlich auszudeuten versucht hat—vergeblich,
weil Diese Begriffe das unerschütterlich Lebendige er-
klärenshalber zu Tode dachten und das nur subjektiv
Erlebbare sich als ein objektiv Wißbares zu unterwerfen
strebten, — die „Verständnis-Vernunft" entgegen, die
das Wesen der Welt als eines tätigen Wuchsgebildes
im Spiegel des eigenen wuchstatigen Geistes schaut.
Das ist das gewaltige Neue: Schlüter denkt nicht er-
klärungssüchtig auf die Welt los oder wissensdurstig über
sie nach, sondern er erlebt sie unmittelbar selbst in seiner
Geistestätigkeit als ein Gebilde, das sich des Gegensatzes
als des bauenden Mittels bedient, um in unendlicher
Gliederung emporzuwachsen, unter der Führung eines
gestaltenden Wollens und Könnens, das dieses Wachsen
zur Kunst machte und das „erkannte" Gebilde mit
Schönheit adelt.
Mit unvergleichlicher Feinheit der Selbstbeobachtung
hat dieser zarteste Denker die Weise des Alls in der
Werkstatt seines individuellen Geistes belauscht, ohne
die leiseste Spur fälschender Befangenheit durch dieses
Belauschen selbst. Seine Ergebnisse sind rein überlieferte
Erlebnisse und erzwingen sich samt ihren Folgerungen
für das Welt-Erlebnis unmittelbar den Beifall unserer,
nur noch nie so zu Worte gekommenen heimlichsten Er-
fahrung. Es ist eine psychologische Leistung allerhöchsten
Ranges, wie Schlüter das Ich — als eine bewußte Tat-
mitte der überall in Tatmitten sich sammelnden und
durch deren Austausch sich bereichernden Allgeist-Tätig-
keit — vom dunkleren Wuchsboden des Unbewußten ab-
löst und es der überbewußten Wuchsstrebung eines hell
hereinwirkenden Grenzenlosen, sich in den Grenzen
eines Menschen-Selbst schön darzuleben, unterstellt.
In seinem Hauptwerke*) — selbst eine Geistestat
reinsten Wuchses und feinster Gliederung —, das er,
tiefbegründet und doch zu eng „Deutsches Tat-Denken"
überschreibt und durchaus zu bescheiden als bloße „An-
regungen zu einer neuen Forschung und Denkweise"
bezeichnet, hat seine tapfere Weisheit eine fremdwörter-
freie (!) philosophische Sprache von prachtvotler Selb-
ständigkeit und Dienlichkeit für die Mitteilung bisher
unsagbarer Feinheiten des Geistes gefunden. Und un-
vergänglich gehaltvoll stehen die geläuterten Sätze, wie
mit demantcnem Griffel, würdig ihres ewigen Wertes,
in eherne Tafeln gegraben. Dieser durch Sinnesfülle
ungewöhnlich dichte und geraffte Stil wirkt durch sich
selber mächtig steigernd auf die Kräfte des Bewußtseins,
das mit ihm ringt. Die Freude dieser Kräftesteigerung
ist um so herrlicher, weil sie hier nicht einer scholastischen
Denkfertigkeit, metaphysischen Begriffsturnerei oder-
kalten Wissenschaftlichkeit zuwächst, sondern das mensch-
liche Leben selber als ein geistiges Tun auf höchster Stufe
fühlen läßt: wenn unser inneres Können das begriffene
All zur Anschaulichkeit eines Kunstwerkes siegreich formt
und dichtet. —
Es ist eine wundervolle Angabe zu dieser endgültigen
Welt- und Jch-Gewinnung durch die Schlütersche Denk-
*) Oskar Laube, Verlag, Dresden 1919.
weise, zugleich der stärkste Beweis ihres Erfüllungs-
wertes, — wie frühere Versuche dazu als solche ins Licht
treten und ungeheure Entscheidungen über Religionen
und Philosophien der geklärten Betrachtung schier
spielend zufallen.
Es gehört auch nicht mehr zum Wesentlichen seines
Werkes, wie Schlüter die tat-denkerische Seelenweisheit
angewendet wissen will innerhalb des Gemeinschafts-
lebens, so kostbar und heute besonders bedeutsam das
auch ist, was er von den Führenden des Volkes und der
Völker verlangt: daß sie mit Verständnis für die Frucht-
barkeit der Gegensätze durch diese Gegensätze selber die
Geführten fördern und im Sinne der gliedernden All-
kunst miteinander „empormenschlichen". —
Das Wesentliche, Einzigartige, Neue und Gewaltige
ist seine Denkweise selber: eine schöpferische Psychologie,
die das geheimste eigene Geistes-Tun überzeugend als
Gestaltungsgrund auf das All überträgt, am unendlichen
Vorbild das endliche Ich emporzuleben lehrt und den
Menschen durch die Schauung ewiger Weltenschönheit,
an der er selber schaffend beteiligt ist, zu unbesieglicher
Daseinsheiterkeit verpflichtet.
Versucht euch an ihm! Nie ist von einem Denker
mehr dem Leben zu Dank gedacht worden. Die kranken
Nebelschwaden der Aeit verschwinden vor dem Ewig-
keits-Licht dieser gesunden Sonne. Sie strahlt herz-
warme Tatkraft ins beschwingte Gehirn.
Wohl denen, die reif, d. h. in sich selber erfahren
genug sind, um die Feuertaufe dieses Propheten zu
empfangen, der den Geist der künftigen Menschheit
bestimmen wird. Dafür bürgt die „heilige Nüchtern-
heit" seines großartig revolutionären Denkens.
Ernst Bacmeister.
Eduard Mörike.
Von Wilhelm Schäfer*).
Nur Einem hatten die Nornen die silberne Spindel
in seine ärmliche Wiege gelegt, nur Einem wurde die
Enge zum Schicksal, das er mit stolzer Bescheidung be-
zwang.
Vikar an mancherlei Orten, zu Cleversulzbach im
Unterland Pfarrer, dann kränkelnd in Mergentheim,
fünfzehn Jahre als Lehrer in Stuttgart geplagt und
dreizehn danach auf seinen Tod wartend: trug Eduard
Mörike recht wie ein Stiftler sein irdisches Leben.
Ein zärtlicher Jüngling wurde ein kränklicher Mann
und ein Greis, von den Nöten des Alters geplagt; eine
gläserne Seele, zart und zerbrechlich, mußte ein langes
Leben aushalten, bevor ihr der Tod den dünnen Stengel
abbrach.
Aber die gläserne Seele, zart und zerbrechlich, nahm
ihre irdische Enge hin, wie eine Blume im Garten den
Lärm spielender Kinder, Hundegebell und Hammerschlag
aus der Schmiede, Rädergerassel und Glockengeläut still
übersteht.
Der säuselnde Wind sang in das Lied ihrer steigenden
Säfte, die Sterne der Nacht, ihre ewigen Schwestern,
standen im Schlaf ihr zu Häupten, und ihre Mutter die
Sonne küßte sie wach in den Morgen.
*) Aus der Geschichte der deutschen Seele.
der Verstand das menschliche Mittel, sondern einzig das
aus der Erfahrung des eigenen Innern geschöpfte „Ver-
ständnis". Schlüter setzt die Verstandes-Vernunft, die
das All seit Jahrtausenden als ein Seiendes und Werden-
des gegenständlich auszudeuten versucht hat—vergeblich,
weil Diese Begriffe das unerschütterlich Lebendige er-
klärenshalber zu Tode dachten und das nur subjektiv
Erlebbare sich als ein objektiv Wißbares zu unterwerfen
strebten, — die „Verständnis-Vernunft" entgegen, die
das Wesen der Welt als eines tätigen Wuchsgebildes
im Spiegel des eigenen wuchstatigen Geistes schaut.
Das ist das gewaltige Neue: Schlüter denkt nicht er-
klärungssüchtig auf die Welt los oder wissensdurstig über
sie nach, sondern er erlebt sie unmittelbar selbst in seiner
Geistestätigkeit als ein Gebilde, das sich des Gegensatzes
als des bauenden Mittels bedient, um in unendlicher
Gliederung emporzuwachsen, unter der Führung eines
gestaltenden Wollens und Könnens, das dieses Wachsen
zur Kunst machte und das „erkannte" Gebilde mit
Schönheit adelt.
Mit unvergleichlicher Feinheit der Selbstbeobachtung
hat dieser zarteste Denker die Weise des Alls in der
Werkstatt seines individuellen Geistes belauscht, ohne
die leiseste Spur fälschender Befangenheit durch dieses
Belauschen selbst. Seine Ergebnisse sind rein überlieferte
Erlebnisse und erzwingen sich samt ihren Folgerungen
für das Welt-Erlebnis unmittelbar den Beifall unserer,
nur noch nie so zu Worte gekommenen heimlichsten Er-
fahrung. Es ist eine psychologische Leistung allerhöchsten
Ranges, wie Schlüter das Ich — als eine bewußte Tat-
mitte der überall in Tatmitten sich sammelnden und
durch deren Austausch sich bereichernden Allgeist-Tätig-
keit — vom dunkleren Wuchsboden des Unbewußten ab-
löst und es der überbewußten Wuchsstrebung eines hell
hereinwirkenden Grenzenlosen, sich in den Grenzen
eines Menschen-Selbst schön darzuleben, unterstellt.
In seinem Hauptwerke*) — selbst eine Geistestat
reinsten Wuchses und feinster Gliederung —, das er,
tiefbegründet und doch zu eng „Deutsches Tat-Denken"
überschreibt und durchaus zu bescheiden als bloße „An-
regungen zu einer neuen Forschung und Denkweise"
bezeichnet, hat seine tapfere Weisheit eine fremdwörter-
freie (!) philosophische Sprache von prachtvotler Selb-
ständigkeit und Dienlichkeit für die Mitteilung bisher
unsagbarer Feinheiten des Geistes gefunden. Und un-
vergänglich gehaltvoll stehen die geläuterten Sätze, wie
mit demantcnem Griffel, würdig ihres ewigen Wertes,
in eherne Tafeln gegraben. Dieser durch Sinnesfülle
ungewöhnlich dichte und geraffte Stil wirkt durch sich
selber mächtig steigernd auf die Kräfte des Bewußtseins,
das mit ihm ringt. Die Freude dieser Kräftesteigerung
ist um so herrlicher, weil sie hier nicht einer scholastischen
Denkfertigkeit, metaphysischen Begriffsturnerei oder-
kalten Wissenschaftlichkeit zuwächst, sondern das mensch-
liche Leben selber als ein geistiges Tun auf höchster Stufe
fühlen läßt: wenn unser inneres Können das begriffene
All zur Anschaulichkeit eines Kunstwerkes siegreich formt
und dichtet. —
Es ist eine wundervolle Angabe zu dieser endgültigen
Welt- und Jch-Gewinnung durch die Schlütersche Denk-
*) Oskar Laube, Verlag, Dresden 1919.
weise, zugleich der stärkste Beweis ihres Erfüllungs-
wertes, — wie frühere Versuche dazu als solche ins Licht
treten und ungeheure Entscheidungen über Religionen
und Philosophien der geklärten Betrachtung schier
spielend zufallen.
Es gehört auch nicht mehr zum Wesentlichen seines
Werkes, wie Schlüter die tat-denkerische Seelenweisheit
angewendet wissen will innerhalb des Gemeinschafts-
lebens, so kostbar und heute besonders bedeutsam das
auch ist, was er von den Führenden des Volkes und der
Völker verlangt: daß sie mit Verständnis für die Frucht-
barkeit der Gegensätze durch diese Gegensätze selber die
Geführten fördern und im Sinne der gliedernden All-
kunst miteinander „empormenschlichen". —
Das Wesentliche, Einzigartige, Neue und Gewaltige
ist seine Denkweise selber: eine schöpferische Psychologie,
die das geheimste eigene Geistes-Tun überzeugend als
Gestaltungsgrund auf das All überträgt, am unendlichen
Vorbild das endliche Ich emporzuleben lehrt und den
Menschen durch die Schauung ewiger Weltenschönheit,
an der er selber schaffend beteiligt ist, zu unbesieglicher
Daseinsheiterkeit verpflichtet.
Versucht euch an ihm! Nie ist von einem Denker
mehr dem Leben zu Dank gedacht worden. Die kranken
Nebelschwaden der Aeit verschwinden vor dem Ewig-
keits-Licht dieser gesunden Sonne. Sie strahlt herz-
warme Tatkraft ins beschwingte Gehirn.
Wohl denen, die reif, d. h. in sich selber erfahren
genug sind, um die Feuertaufe dieses Propheten zu
empfangen, der den Geist der künftigen Menschheit
bestimmen wird. Dafür bürgt die „heilige Nüchtern-
heit" seines großartig revolutionären Denkens.
Ernst Bacmeister.
Eduard Mörike.
Von Wilhelm Schäfer*).
Nur Einem hatten die Nornen die silberne Spindel
in seine ärmliche Wiege gelegt, nur Einem wurde die
Enge zum Schicksal, das er mit stolzer Bescheidung be-
zwang.
Vikar an mancherlei Orten, zu Cleversulzbach im
Unterland Pfarrer, dann kränkelnd in Mergentheim,
fünfzehn Jahre als Lehrer in Stuttgart geplagt und
dreizehn danach auf seinen Tod wartend: trug Eduard
Mörike recht wie ein Stiftler sein irdisches Leben.
Ein zärtlicher Jüngling wurde ein kränklicher Mann
und ein Greis, von den Nöten des Alters geplagt; eine
gläserne Seele, zart und zerbrechlich, mußte ein langes
Leben aushalten, bevor ihr der Tod den dünnen Stengel
abbrach.
Aber die gläserne Seele, zart und zerbrechlich, nahm
ihre irdische Enge hin, wie eine Blume im Garten den
Lärm spielender Kinder, Hundegebell und Hammerschlag
aus der Schmiede, Rädergerassel und Glockengeläut still
übersteht.
Der säuselnde Wind sang in das Lied ihrer steigenden
Säfte, die Sterne der Nacht, ihre ewigen Schwestern,
standen im Schlaf ihr zu Häupten, und ihre Mutter die
Sonne küßte sie wach in den Morgen.
*) Aus der Geschichte der deutschen Seele.