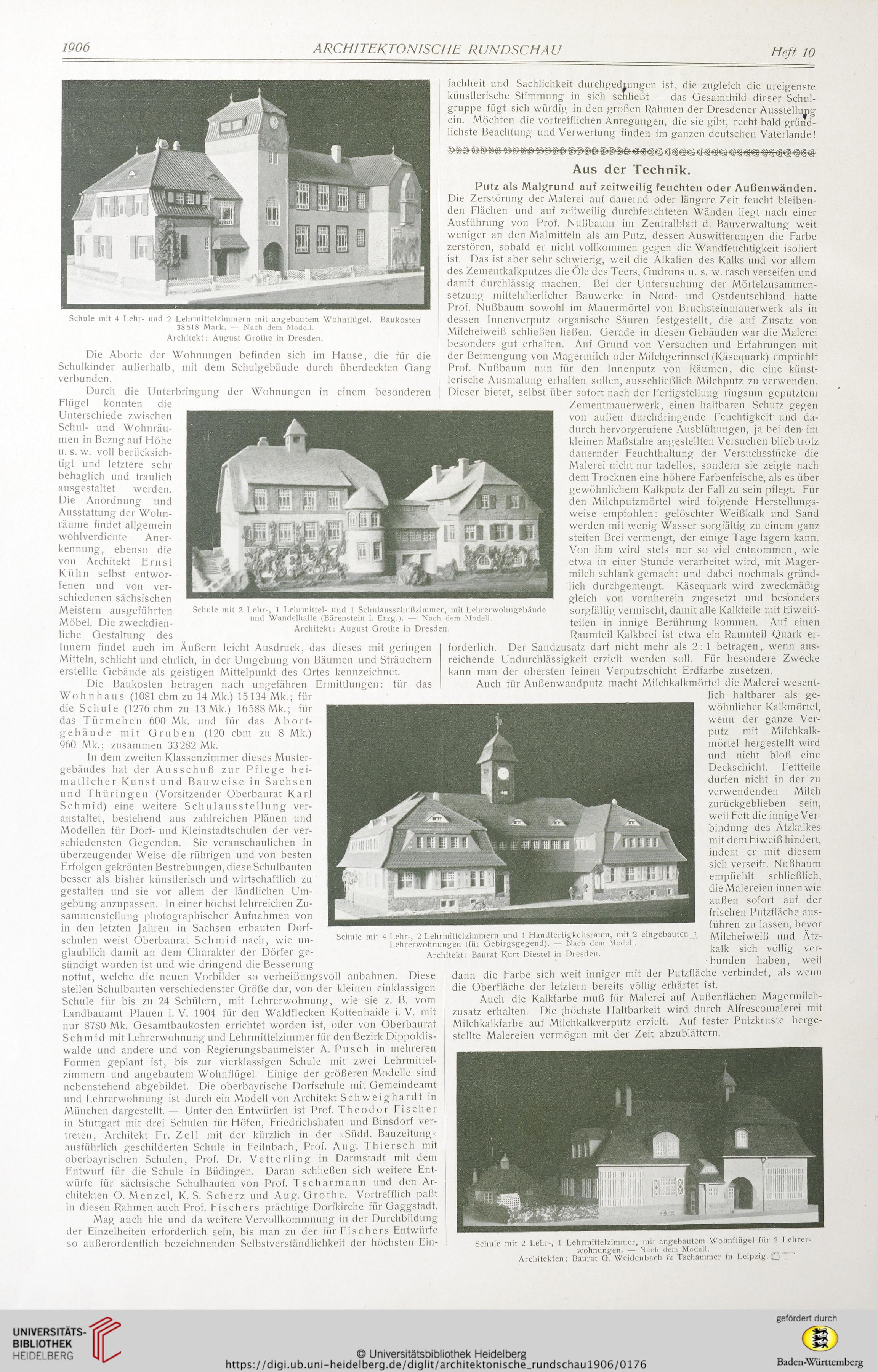1906
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 10
Schule mit 4 Lehr- und 2 Lehrmittelzimmern mit angebautem Wohnflügel. Baukosten
38 518 Mark. — Nach dem Modell.
Architekt: August Grothe in Dresden.
Die Aborte der Wohnungen befinden sich im Hause, die für die
Schulkinder außerhalb, mit dem Schulgebäude durch überdeckten Gang
verbunden.
Durch die Unterbringung der Wohnungen in einem besonderen
Flügel konnten die
Unterschiede zwischen
Schul- und Wohnräu¬
men in Bezug auf Höhe
u. s. w. voll berücksich¬
tigt und letztere sehr
behaglich und traulich
ausgestaltet werden.
Die Anordnung und
Ausstattung der Wohn¬
räume findet allgemein
wohlverdiente Aner¬
kennung, ebenso die
von Architekt Ernst
Kühn selbst entwor¬
fenen und von ver¬
schiedenen sächsischen
Meistern ausgeführten
Möbel. Die zweckdien¬
liche Gestaltung des
Innern findet auch im Äußern leicht Ausdruck, das dieses mit geringen
Mitteln, schlicht und ehrlich, in der Umgebung von Bäumen und Sträuchern
erstellte Gebäude als geistigen Mittelpunkt des Ortes kennzeichnet.
Die Baukosten betragen nach ungefähren Ermittlungen: für das
Wohnhaus (1081 cbm zu 14 Mk.) 15 134 Mk.; für
die Schule (1276 cbm zu 13 Mk.) 16588 Mk.; für
das Türmchen 600 Mk. und für das Abort¬
gebäude mit Gruben (120 cbm zu 8 Mk.)
960 Mk.; zusammen 33282 Mk.
In dem zweiten Klassenzimmer dieses Muster¬
gebäudes hat der Ausschuß zur Pflege hei¬
matlicher Kunst und Bauweise in Sachsen
und Thüringen (Vorsitzender Oberbaurat Karl
Schmid) eine weitere Schulausstellung ver¬
anstaltet, bestehend aus zahlreichen Plänen und
Modellen für Dorf- und Kleinstadtschulen der ver¬
schiedensten Gegenden. Sie veranschaulichen in
überzeugender Weise die rührigen und von besten
Erfolgen gekrönten Bestrebungen, diese Schulbauten
besser als bisher künstlerisch und wirtschaftlich zu
gestalten und sie vor allem der ländlichen Um¬
gebung anzupassen. In einer höchst lehrreichen Zu¬
sammenstellung photographischer Aufnahmen von
in den letzten Jahren in Sachsen erbauten Dorf¬
schulen weist Oberbaurat Schmid nach, wie un¬
glaublich damit an dem Charakter der Dörfer ge¬
sündigt worden ist und wie dringend die Besserung
nottut, welche die neuen Vorbilder so verheißungsvoll anbahnen. Diese
stellen Schulbauten verschiedenster Größe dar, von der kleinen einklassigen
Schule für bis zu 24 Schülern, mit Lehrerwohnung, wie sie z. B. vom
Landbauamt Plauen i. V. 1904 für den Waldflecken Kottenhaide i. V. mit
nur 8780 Mk. Gesamtbaukosten errichtet worden ist, oder von Oberbaurat
Schmid mit Lehrerwohnung und Lehrmittelzimmer für den Bezirk Dippoldis-
walde und andere und von Regierungsbaumeister A. Pusch in mehreren
Formen geplant ist, bis zur vierklassigen Schule mit zwei Lehrmittel-
zimmern und angebautem Wohnflüge!. Einige der größeren Modelle sind
nebenstehend abgebildet. Die oberbayrische Dorfschule mit Gemeindeamt
und Lehrerwohnung ist durch ein Modell von Architekt Schweighardt in
München dargestellt.— Unter den Entwürfen ist Prof. Theodor Fischer
in Stuttgart mit drei Schulen für Höfen, Friedrichshafen und Binsdorf ver-
treten, Architekt Fr. Zell mit der kürzlich in der »Siidd. Bauzeitung«
ausführlich geschilderten Schule in Feilnbach, Prof. Aug. Thierseh mit
oberbayrischen Schulen, Prof. Dr. Vetterling in Darmstadt mit dem
Entwurf für die Schule in Büdingen. Daran schließen sich weitere Ent-
würfe für sächsische Schulbauten von Prof. Tscharmann und den Ar-
chitekten O. Menzel, K. S. Scherz und Aug. Grothe. Vortrefflich paßt
in diesen Rahmen auch Prof. Fischers prächtige Dorfkirche für Gaggstadt.
Mag auch hie und da weitere Vervollkommnung in der Durchbildung
der Einzelheiten erforderlich sein, bis man zu der für Fischers Entwürfe
so außerordentlich bezeichnenden Selbstverständlichkeit der höchsten Ein-
fachheit und Sachlichkeit durchgedrungen ist, die zugleich die ureigenste
künstlerische Stimmung in sich schließt — das Gesamtbild dieser Schul-
gruppe fügt sich würdig in den großen Rahmen der Dresdener Ausstellung
ein. Möchten die vortrefflichen Anregungen, die sie gibt, recht bald gründ-
lichste Beachtung und Verwertung finden im ganzen deutschen Vaterlande!
Putz als Malgrund auf zeitweilig feuchten oder Außenwänden.
Die Zerstörung der Malerei auf dauernd oder längere Zeit feucht bleiben-
den Flächen und auf zeitweilig durchfeuchteten Wänden liegt nach einer
Ausführung von Prof. Nußbaum im Zentralblatt d. Bauverwaltung weit
weniger an den Malmitteln als am Putz, dessen Auswitterungen die Farbe
zerstören, sobald er nicht vollkommen gegen die Wandfeuchtigkeit isoliert
ist. Das ist aber sehr schwierig, weil die Alkalien des Kalks und vor allem
des Zementkalkputzes die Öle des Teers, Gudrons u. s. w. rasch verseifen und
damit durchlässig machen. Bei der Untersuchung der Mörtelzusammen-
setzung mittelalterlicher Bauwerke in Nord- und Ostdeutschland hatte
Prof. Nußbaum sowohl im Mauermörtel von Bruchsteinmauerwerk als in
dessen Innenverputz organische Säuren festgestellt, die auf Zusatz von
Milcheiweiß schließen ließen. Gerade in diesen Gebäuden war die Malerei
besonders gut erhalten. Auf Grund von Versuchen und Erfahrungen mit
der Beimengung von Magermilch oder Milchgerinnsel (Käsequark) empfiehlt
Prof. Nußbaum nun für den Innenputz von Räumen, die eine künst-
lerische Ausmalung erhalten sollen, ausschließlich Milchputz zu verwenden.
Dieser bietet, selbst über sofort nach der Fertigstellung ringsum geputztem
Zementmauerwerk, einen haltbaren Schutz gegen
von außen durchdringende Feuchtigkeit und da-
durch hervorgerufene Ausblühungen, ja bei den- im
kleinen Maßstabe angestellten Versuchen blieb trotz
dauernder Feuchthaltung der Versuchsstücke die
Malerei nicht nur tadellos, sondern sie zeigte nach
dem Trocknen eine höhere Farbenfrische, als es über
gewöhnlichem Kalkputz der Fall zu sein pflegt. Für
den Milchputzmörtel wird folgende Herstellungs-
weise empfohlen: gelöschter Weißkalk und Sand
werden mit wenig Wasser sorgfältig zu einem ganz
steifen Brei vermengt, der einige Tage lagern kann.
Von ihm wird stets nur so viel entnommen, wie
etwa in einer Stunde verarbeitet wird, mit Mager-
milch schlank gemacht und dabei nochmals gründ-
lich durchgemengt. Käsequark wird zweckmäßig
gleich von vornherein zugesetzt und besonders
sorgfältig vermischt, damit alle Kalkteile mit Eiweiß-
teilen in innige Berührung kommen. Auf einen
Raumteil Kalkbrei ist etwa ein Raumteil Quark er-
forderlich. Der Sandzusatz darf nicht mehr als 2:1 betragen, wenn aus-
reichende Undurchlässigkeit erzielt werden soll. Für besondere Zwecke
kann man der obersten feinen Verputzschicht Erdfarbe zusetzen.
Auch für Außenwandputz macht Milchkalkmörtel die Malerei wesent-
lich haltbarer als ge-
wöhnlicher Kalkmörtel,
wenn der ganze Ver-
putz mit Milchkalk-
mörtel hergestellt wird
und nicht bloß eine
Deckschicht. Fettteile
dürfen nicht in der zu
verwendenden Milch
zurückgeblieben sein,
weil Fett die innige Ver-
bindung des Ätzkalkes
mit dem Eiweiß hindert,
indem er mit diesem
sich verseift. Nußbaum
empfiehlt schließlich,
die Malereien innen wie
außen sofort auf der
frischen Putzfläche aus-
führen zu lassen, bevor
Milcheiweiß und Ätz-
kalk sich völlig ver-
bunden haben, weil
dann die Farbe sich weit inniger mit der Putzfläche verbindet, als wenn
die Oberfläche der letztem bereits völlig erhärtet ist.
Auch die Kalkfarbe muß für Malerei auf Außenflächen Magermilch-
zusatz erhalten. Die (höchste Haltbarkeit wird durch Alfrescomalerei mit
Milchkalkfarbe auf Milchkalkverputz erzielt. Auf fester Putzkruste herge-
stellte Malereien vermögen mit der Zeit abzublättern.
Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittelzimmer, mit angebautem Wohnflügel für 2 Lehrer-
wohnungen. ■— Nach dem Modell. _
Architekten: Baurat G. Weidenbach & Tschammer in Leipzig.
Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittel- und 1 Schulausschußzimmer, mit Lehrerwohngebäude
und Wandelhalle (Bärenstein i. Erzg.). — Nach dem Modell.
Architekt: August Grothe in Dresden.
Schule mit 4 Lehr-, 2 Lehrmittelzimmern und 1 Handfertigkeitsraum, mit 2 eingebauten y
Lehrerwohnungen (für Gebirgsgegend). — Nach dem Modell.
Architekt: Baurat Kurt Diestel in Dresden.
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 10
Schule mit 4 Lehr- und 2 Lehrmittelzimmern mit angebautem Wohnflügel. Baukosten
38 518 Mark. — Nach dem Modell.
Architekt: August Grothe in Dresden.
Die Aborte der Wohnungen befinden sich im Hause, die für die
Schulkinder außerhalb, mit dem Schulgebäude durch überdeckten Gang
verbunden.
Durch die Unterbringung der Wohnungen in einem besonderen
Flügel konnten die
Unterschiede zwischen
Schul- und Wohnräu¬
men in Bezug auf Höhe
u. s. w. voll berücksich¬
tigt und letztere sehr
behaglich und traulich
ausgestaltet werden.
Die Anordnung und
Ausstattung der Wohn¬
räume findet allgemein
wohlverdiente Aner¬
kennung, ebenso die
von Architekt Ernst
Kühn selbst entwor¬
fenen und von ver¬
schiedenen sächsischen
Meistern ausgeführten
Möbel. Die zweckdien¬
liche Gestaltung des
Innern findet auch im Äußern leicht Ausdruck, das dieses mit geringen
Mitteln, schlicht und ehrlich, in der Umgebung von Bäumen und Sträuchern
erstellte Gebäude als geistigen Mittelpunkt des Ortes kennzeichnet.
Die Baukosten betragen nach ungefähren Ermittlungen: für das
Wohnhaus (1081 cbm zu 14 Mk.) 15 134 Mk.; für
die Schule (1276 cbm zu 13 Mk.) 16588 Mk.; für
das Türmchen 600 Mk. und für das Abort¬
gebäude mit Gruben (120 cbm zu 8 Mk.)
960 Mk.; zusammen 33282 Mk.
In dem zweiten Klassenzimmer dieses Muster¬
gebäudes hat der Ausschuß zur Pflege hei¬
matlicher Kunst und Bauweise in Sachsen
und Thüringen (Vorsitzender Oberbaurat Karl
Schmid) eine weitere Schulausstellung ver¬
anstaltet, bestehend aus zahlreichen Plänen und
Modellen für Dorf- und Kleinstadtschulen der ver¬
schiedensten Gegenden. Sie veranschaulichen in
überzeugender Weise die rührigen und von besten
Erfolgen gekrönten Bestrebungen, diese Schulbauten
besser als bisher künstlerisch und wirtschaftlich zu
gestalten und sie vor allem der ländlichen Um¬
gebung anzupassen. In einer höchst lehrreichen Zu¬
sammenstellung photographischer Aufnahmen von
in den letzten Jahren in Sachsen erbauten Dorf¬
schulen weist Oberbaurat Schmid nach, wie un¬
glaublich damit an dem Charakter der Dörfer ge¬
sündigt worden ist und wie dringend die Besserung
nottut, welche die neuen Vorbilder so verheißungsvoll anbahnen. Diese
stellen Schulbauten verschiedenster Größe dar, von der kleinen einklassigen
Schule für bis zu 24 Schülern, mit Lehrerwohnung, wie sie z. B. vom
Landbauamt Plauen i. V. 1904 für den Waldflecken Kottenhaide i. V. mit
nur 8780 Mk. Gesamtbaukosten errichtet worden ist, oder von Oberbaurat
Schmid mit Lehrerwohnung und Lehrmittelzimmer für den Bezirk Dippoldis-
walde und andere und von Regierungsbaumeister A. Pusch in mehreren
Formen geplant ist, bis zur vierklassigen Schule mit zwei Lehrmittel-
zimmern und angebautem Wohnflüge!. Einige der größeren Modelle sind
nebenstehend abgebildet. Die oberbayrische Dorfschule mit Gemeindeamt
und Lehrerwohnung ist durch ein Modell von Architekt Schweighardt in
München dargestellt.— Unter den Entwürfen ist Prof. Theodor Fischer
in Stuttgart mit drei Schulen für Höfen, Friedrichshafen und Binsdorf ver-
treten, Architekt Fr. Zell mit der kürzlich in der »Siidd. Bauzeitung«
ausführlich geschilderten Schule in Feilnbach, Prof. Aug. Thierseh mit
oberbayrischen Schulen, Prof. Dr. Vetterling in Darmstadt mit dem
Entwurf für die Schule in Büdingen. Daran schließen sich weitere Ent-
würfe für sächsische Schulbauten von Prof. Tscharmann und den Ar-
chitekten O. Menzel, K. S. Scherz und Aug. Grothe. Vortrefflich paßt
in diesen Rahmen auch Prof. Fischers prächtige Dorfkirche für Gaggstadt.
Mag auch hie und da weitere Vervollkommnung in der Durchbildung
der Einzelheiten erforderlich sein, bis man zu der für Fischers Entwürfe
so außerordentlich bezeichnenden Selbstverständlichkeit der höchsten Ein-
fachheit und Sachlichkeit durchgedrungen ist, die zugleich die ureigenste
künstlerische Stimmung in sich schließt — das Gesamtbild dieser Schul-
gruppe fügt sich würdig in den großen Rahmen der Dresdener Ausstellung
ein. Möchten die vortrefflichen Anregungen, die sie gibt, recht bald gründ-
lichste Beachtung und Verwertung finden im ganzen deutschen Vaterlande!
Putz als Malgrund auf zeitweilig feuchten oder Außenwänden.
Die Zerstörung der Malerei auf dauernd oder längere Zeit feucht bleiben-
den Flächen und auf zeitweilig durchfeuchteten Wänden liegt nach einer
Ausführung von Prof. Nußbaum im Zentralblatt d. Bauverwaltung weit
weniger an den Malmitteln als am Putz, dessen Auswitterungen die Farbe
zerstören, sobald er nicht vollkommen gegen die Wandfeuchtigkeit isoliert
ist. Das ist aber sehr schwierig, weil die Alkalien des Kalks und vor allem
des Zementkalkputzes die Öle des Teers, Gudrons u. s. w. rasch verseifen und
damit durchlässig machen. Bei der Untersuchung der Mörtelzusammen-
setzung mittelalterlicher Bauwerke in Nord- und Ostdeutschland hatte
Prof. Nußbaum sowohl im Mauermörtel von Bruchsteinmauerwerk als in
dessen Innenverputz organische Säuren festgestellt, die auf Zusatz von
Milcheiweiß schließen ließen. Gerade in diesen Gebäuden war die Malerei
besonders gut erhalten. Auf Grund von Versuchen und Erfahrungen mit
der Beimengung von Magermilch oder Milchgerinnsel (Käsequark) empfiehlt
Prof. Nußbaum nun für den Innenputz von Räumen, die eine künst-
lerische Ausmalung erhalten sollen, ausschließlich Milchputz zu verwenden.
Dieser bietet, selbst über sofort nach der Fertigstellung ringsum geputztem
Zementmauerwerk, einen haltbaren Schutz gegen
von außen durchdringende Feuchtigkeit und da-
durch hervorgerufene Ausblühungen, ja bei den- im
kleinen Maßstabe angestellten Versuchen blieb trotz
dauernder Feuchthaltung der Versuchsstücke die
Malerei nicht nur tadellos, sondern sie zeigte nach
dem Trocknen eine höhere Farbenfrische, als es über
gewöhnlichem Kalkputz der Fall zu sein pflegt. Für
den Milchputzmörtel wird folgende Herstellungs-
weise empfohlen: gelöschter Weißkalk und Sand
werden mit wenig Wasser sorgfältig zu einem ganz
steifen Brei vermengt, der einige Tage lagern kann.
Von ihm wird stets nur so viel entnommen, wie
etwa in einer Stunde verarbeitet wird, mit Mager-
milch schlank gemacht und dabei nochmals gründ-
lich durchgemengt. Käsequark wird zweckmäßig
gleich von vornherein zugesetzt und besonders
sorgfältig vermischt, damit alle Kalkteile mit Eiweiß-
teilen in innige Berührung kommen. Auf einen
Raumteil Kalkbrei ist etwa ein Raumteil Quark er-
forderlich. Der Sandzusatz darf nicht mehr als 2:1 betragen, wenn aus-
reichende Undurchlässigkeit erzielt werden soll. Für besondere Zwecke
kann man der obersten feinen Verputzschicht Erdfarbe zusetzen.
Auch für Außenwandputz macht Milchkalkmörtel die Malerei wesent-
lich haltbarer als ge-
wöhnlicher Kalkmörtel,
wenn der ganze Ver-
putz mit Milchkalk-
mörtel hergestellt wird
und nicht bloß eine
Deckschicht. Fettteile
dürfen nicht in der zu
verwendenden Milch
zurückgeblieben sein,
weil Fett die innige Ver-
bindung des Ätzkalkes
mit dem Eiweiß hindert,
indem er mit diesem
sich verseift. Nußbaum
empfiehlt schließlich,
die Malereien innen wie
außen sofort auf der
frischen Putzfläche aus-
führen zu lassen, bevor
Milcheiweiß und Ätz-
kalk sich völlig ver-
bunden haben, weil
dann die Farbe sich weit inniger mit der Putzfläche verbindet, als wenn
die Oberfläche der letztem bereits völlig erhärtet ist.
Auch die Kalkfarbe muß für Malerei auf Außenflächen Magermilch-
zusatz erhalten. Die (höchste Haltbarkeit wird durch Alfrescomalerei mit
Milchkalkfarbe auf Milchkalkverputz erzielt. Auf fester Putzkruste herge-
stellte Malereien vermögen mit der Zeit abzublättern.
Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittelzimmer, mit angebautem Wohnflügel für 2 Lehrer-
wohnungen. ■— Nach dem Modell. _
Architekten: Baurat G. Weidenbach & Tschammer in Leipzig.
Schule mit 2 Lehr-, 1 Lehrmittel- und 1 Schulausschußzimmer, mit Lehrerwohngebäude
und Wandelhalle (Bärenstein i. Erzg.). — Nach dem Modell.
Architekt: August Grothe in Dresden.
Schule mit 4 Lehr-, 2 Lehrmittelzimmern und 1 Handfertigkeitsraum, mit 2 eingebauten y
Lehrerwohnungen (für Gebirgsgegend). — Nach dem Modell.
Architekt: Baurat Kurt Diestel in Dresden.