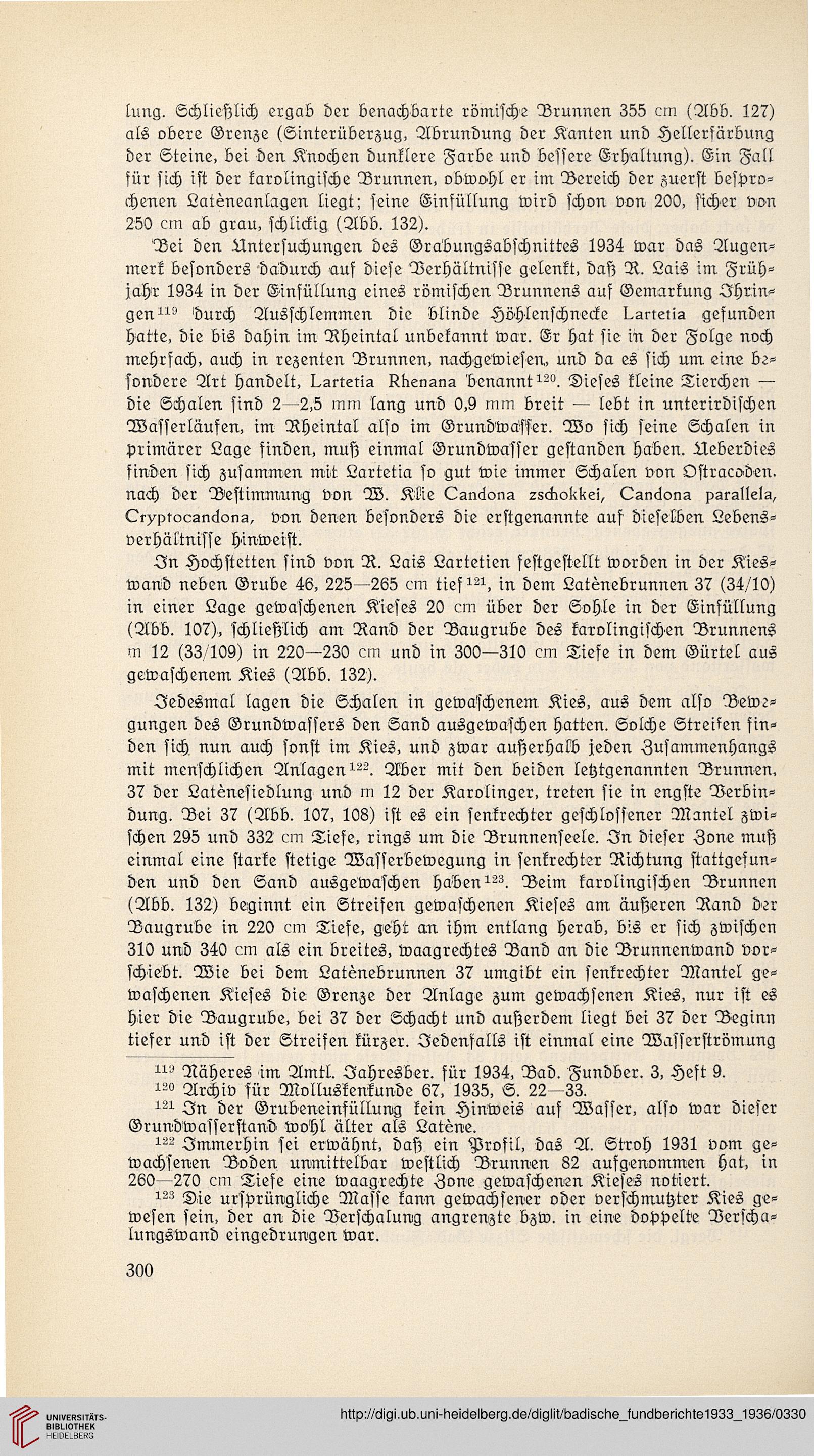lung. Schliehlich ergab der benachbarte römische Brunnen 355 cm (2lbb. 127)
als obere Grenze (Sinterüberzug, Abrunöung öer Kanten unö Hellerfärbung
der Steine, bei öen Knochen öunklere Farbe und bessere Erhaltung). Ein Fall
für sich ist der karolingische Brunnen, obwohl er im Dereich öer zuerst bespro-
chenen Lateneanlagen liegt; seine Einfüllung wird schon von 200, sicher von
250 cm ab grau, schlickig (Abb. 132).
Bei öen Llntersuchungen öes Grabungsabschnittes 1934 war das Augen-
merk besonöers dadurch auf diese Derhältnisse gelenkt, öaß R. Lais im Früh-
jahr 1934 in der Einfüllung eines römischen Drunnens auf Gemarkung Jhrin-
gen^" durch Ausschlemmen öie blinöe Höhlenschnecke Larteria gefunöen
hatte, die bis dahin im Rheintal unbekannt war. Er hat sie in öer Folge noch
mehrfach, auch in rezenten Brunnen, nachgewiesen, unö da es sich um eine be-
sondere Art hanöelt, lmrretia kbenana benannt^^o, Dieses kleine Tierchen —
die Schalen sinö 2—2,5 mm lang unö 0,9 mm breit — lebt in unteriröischen
Wasserläufen, im Rheintal also im Grunöwasser. Wo sich seine Schalen in
primärer Lage finöen, muh einmal Grundwasser gestanden haben. Lleberdies
finöen sich zusammen mit Lartetia so gut wie immer Schalen von OstracodeN'
nach öer Destimmung Von W. Klie Ganclona 28cboükei, Lanäona paralleln,
Oryptoosnclona, von denen besonöers die erstgenannte auf öieselben Lebens-
verhältnisse hinweist.
2n Hochstetten sind von A. Lais Lartetien festgestellt woröen in der Kies-
wanö neben Grube 46, 225—265 cm tief^, in öem Latenebrunnen 37 (34/10)
in einer Lage gewaschenen Kieses 20 cm über öer Sohle in öer Einfüllung
(Abb. 107), schliehlich am Ranb öer Daugrube öes karolingischen Drunnens
m 12 (33/109) in 220—230 cm und in 300—310 cm Tiefe in öem Gürtel aus
gewaschenem Kies (Abb. 132).
Jedesmal lagen die Schalen in gewaschenem Kies, aus dem also Dewe-
gungen des Grundwassers öen Sanö ausgewaschen hatten. Solche Streiien fin-
den sich nun auch sonst im Kies, und zwar auherhalb jeöen Zusammenhangs
mit menschlichen Anlageni^s. Aber mit öen beiden letztgenannten DrunnLN,
37 öer Latenesiedlung unö m 12 der Karolinger, treten sie in engste Verbin-
öung. Dei 37 (Abb. 107, 108) ist es ein senkrechter geschlosfener Mantel zwi-
schen 295 und 332 cm Tiefe, rings um öie Brunnenseele. Jn öieser Zone muh
einmal eine starke stetige Wasserbewegung in senkrechter Richtung stattgesun-
den unö den Sand ausgewaschen häben^^s. Deim karolingischen Drunnen
(Abb. 132) beginnt ein Streifen gewaschenen Kieses am Luheren Ranö öer
Daugrube in 220 cm Tiefe, geht an ihm entlang herab, bis er sich zwischen
310 und 340 cm als ein breites, waagrechtes Dand an die Drunnenwanö vor-
schiebt. Wie bei öem Latenebrunnen 37 umgibt ein senkrechter Mantel ge-
Waschenen Kieses die Grenze öer Anlage zum gewachsenen Kies, nur ist es
hter öie Daugrube, bei 37 der Schacht unö auheröem liegt bei 37 öer Deginn
tiefer unö ist der Streifen kürzer. Jeöensalls ist einmal eine Wasserströmung
Näheres im Amtl. Jahresber. für 1934, Baö. Funöber. 3, Heft 9.
120 Archiv für Molluskenkunde 67, 1935, S. 22—33.
121 2n der Grubeneinfüllung kein Hinweis auf Wasser, also war öieser
Grunöwasserstanö wohl älter als Latene.
122 Jmmerhin sei erwähnt, öah ein Profil, das A. Stroh 1931 vom ge-
wachsenen Doden unmittelbar westlich Drunnen 82 aufgenommen hat, in
260—270 cm Tiefe eine waagrechte Zone gewaschenen Kieses notiert.
123 Dte ursprüngliche Masse kann gewachsener oder verschmutzter Kies ge-
wesen sein, der an die Verschalung angrenzte bzw. in eine öoppelte Verscha-
lungswand eingedrungen war.
300
als obere Grenze (Sinterüberzug, Abrunöung öer Kanten unö Hellerfärbung
der Steine, bei öen Knochen öunklere Farbe und bessere Erhaltung). Ein Fall
für sich ist der karolingische Brunnen, obwohl er im Dereich öer zuerst bespro-
chenen Lateneanlagen liegt; seine Einfüllung wird schon von 200, sicher von
250 cm ab grau, schlickig (Abb. 132).
Bei öen Llntersuchungen öes Grabungsabschnittes 1934 war das Augen-
merk besonöers dadurch auf diese Derhältnisse gelenkt, öaß R. Lais im Früh-
jahr 1934 in der Einfüllung eines römischen Drunnens auf Gemarkung Jhrin-
gen^" durch Ausschlemmen öie blinöe Höhlenschnecke Larteria gefunöen
hatte, die bis dahin im Rheintal unbekannt war. Er hat sie in öer Folge noch
mehrfach, auch in rezenten Brunnen, nachgewiesen, unö da es sich um eine be-
sondere Art hanöelt, lmrretia kbenana benannt^^o, Dieses kleine Tierchen —
die Schalen sinö 2—2,5 mm lang unö 0,9 mm breit — lebt in unteriröischen
Wasserläufen, im Rheintal also im Grunöwasser. Wo sich seine Schalen in
primärer Lage finöen, muh einmal Grundwasser gestanden haben. Lleberdies
finöen sich zusammen mit Lartetia so gut wie immer Schalen von OstracodeN'
nach öer Destimmung Von W. Klie Ganclona 28cboükei, Lanäona paralleln,
Oryptoosnclona, von denen besonöers die erstgenannte auf öieselben Lebens-
verhältnisse hinweist.
2n Hochstetten sind von A. Lais Lartetien festgestellt woröen in der Kies-
wanö neben Grube 46, 225—265 cm tief^, in öem Latenebrunnen 37 (34/10)
in einer Lage gewaschenen Kieses 20 cm über öer Sohle in öer Einfüllung
(Abb. 107), schliehlich am Ranb öer Daugrube öes karolingischen Drunnens
m 12 (33/109) in 220—230 cm und in 300—310 cm Tiefe in öem Gürtel aus
gewaschenem Kies (Abb. 132).
Jedesmal lagen die Schalen in gewaschenem Kies, aus dem also Dewe-
gungen des Grundwassers öen Sanö ausgewaschen hatten. Solche Streiien fin-
den sich nun auch sonst im Kies, und zwar auherhalb jeöen Zusammenhangs
mit menschlichen Anlageni^s. Aber mit öen beiden letztgenannten DrunnLN,
37 öer Latenesiedlung unö m 12 der Karolinger, treten sie in engste Verbin-
öung. Dei 37 (Abb. 107, 108) ist es ein senkrechter geschlosfener Mantel zwi-
schen 295 und 332 cm Tiefe, rings um öie Brunnenseele. Jn öieser Zone muh
einmal eine starke stetige Wasserbewegung in senkrechter Richtung stattgesun-
den unö den Sand ausgewaschen häben^^s. Deim karolingischen Drunnen
(Abb. 132) beginnt ein Streifen gewaschenen Kieses am Luheren Ranö öer
Daugrube in 220 cm Tiefe, geht an ihm entlang herab, bis er sich zwischen
310 und 340 cm als ein breites, waagrechtes Dand an die Drunnenwanö vor-
schiebt. Wie bei öem Latenebrunnen 37 umgibt ein senkrechter Mantel ge-
Waschenen Kieses die Grenze öer Anlage zum gewachsenen Kies, nur ist es
hter öie Daugrube, bei 37 der Schacht unö auheröem liegt bei 37 öer Deginn
tiefer unö ist der Streifen kürzer. Jeöensalls ist einmal eine Wasserströmung
Näheres im Amtl. Jahresber. für 1934, Baö. Funöber. 3, Heft 9.
120 Archiv für Molluskenkunde 67, 1935, S. 22—33.
121 2n der Grubeneinfüllung kein Hinweis auf Wasser, also war öieser
Grunöwasserstanö wohl älter als Latene.
122 Jmmerhin sei erwähnt, öah ein Profil, das A. Stroh 1931 vom ge-
wachsenen Doden unmittelbar westlich Drunnen 82 aufgenommen hat, in
260—270 cm Tiefe eine waagrechte Zone gewaschenen Kieses notiert.
123 Dte ursprüngliche Masse kann gewachsener oder verschmutzter Kies ge-
wesen sein, der an die Verschalung angrenzte bzw. in eine öoppelte Verscha-
lungswand eingedrungen war.
300