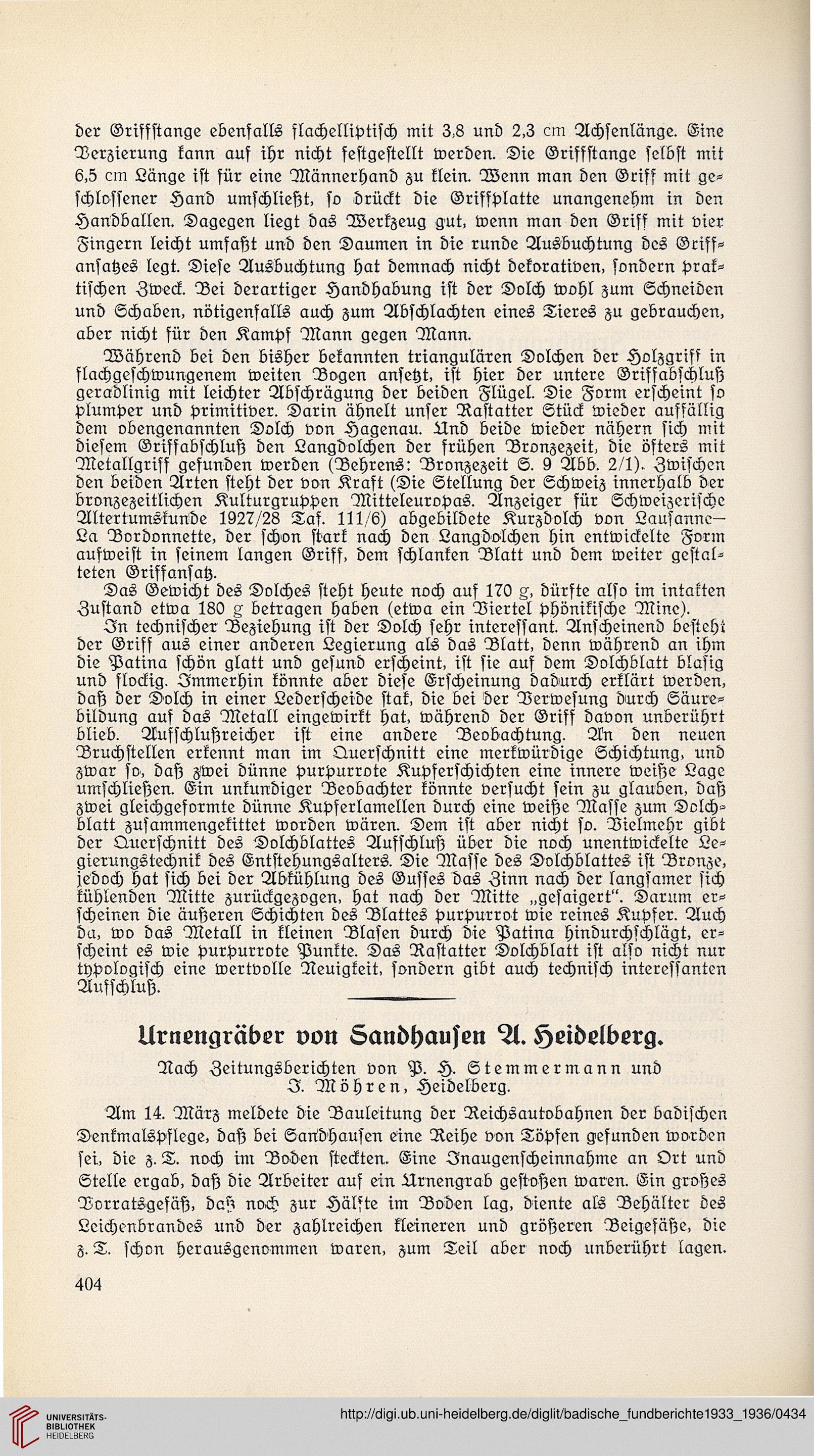der Griffstange ebenfalls flachelliptisch mit 3,8 und 2,3 cin Achsenlänge. Eine
Aerzierung kann auf ihr nicht festgestellt weröen. Die Griffstange felbst mit
6,5 cm Länge ist sür eine Männerhanö zu klein. Wenn man den Griff mit ge-
schlvssener Hand umfchlieht, so drückt öie Griffplatte unangenehm in öen
Handballen. Dagegen liegt das Werkzeug gut, wenn man den Griff mit vier
Fingern leicht umfaht und den Daumen in die runde Ausbuchtung öcs Gciff-
anfatzes legt. Diese Ausbuchtung hat demnach nicht öekorativen, sondern prak-
tischen Zweck. Bei derartiger Handhabung ist der Dolch wohl zum Schneiöen
und Schaben, nötigenfalls auch zum Abschlachten eines Tieres zu gebrauchen,
aber nicht für den Kampf Mann gegen Mann.
Während bei den bisher bekannten triangulären Dolchen öer Holzgrifl in
slachgeschwungenem weiten Bogen ansetzt, ist hier der untere Griffabfchluh
geradlinig mit leichter Abschrägung der beiden Flügel. Die Form erscheint so
plumper und primitiver. Darin ähnelt unser Aastatter Stück wieder auffällig
dem obengenannten Dolch von Hagenau. Llnd beide wieöer nähern fich mit
diesem Griffabfchluß den Langdolchen der frühen Bronzezeit, öie öfters mit
Metallgrisf gefunöen werden (Behrens: Bronzezeit S. 9 Abb. 2/1). Zwischen
den beiden Arten fteht der von Kraft (Die Stellung öer Schweiz innerhalb der
bronzezeitlichen Kulturgruppen Mitteleuropas. Anzeiger für Schweizerifche
Altertumskunde 1927/28 Taf. 111/6) abgebildete Kurzdolch von Lausanne—
La Bordonnette, der schon stark nach den Langdolchen hin entwickelte Form
aufweist in seinem langen Griff, dem schlanken Blatt und dem weiter gestal-
teten Griffansatz.
Das Gewicht des Dolches steht heute noch auf 170 §. dürfte also im intakten
Zustand etwa 180 § betragen haben (etwa ein Biertel phönikische Mine).
Hn technischer Beziehung ist der Dolch sehr interessant. Anscheinend bestehL
der Griff aus einer anderen Legierung als das Blatt, öenn während an ihm
die Patina schön glatt und gesund erscheint, ist sie auf dem Dolchblatt blafig
und flockig. Hmmerhin könnte aber diese Srscheinung dadurch erklärt werden,
dah der Dolch in einer Lederscheide stak, die bei der Derwesung durch Säure-
bildung auf das Metall eingewirkt hat, während der Griff davon unberührt
blieb. Aufschlußreicher ift eine anöere Beobachtung. An öen neuen
Bruchstellen erkennt man im Querschnitt eine merkwürdige Schichtung, und
zwar so> daß zwei dünne purpurrote Kupferschichten eine innere weihe Lage
umfchliehen. Ein unkunöiger Beobachter könnte versucht sein zu glauben, dah
zwei gleichgeformte öünne Kupferlamellen durch eine weihe Masse zum Dolch-
blatt zufammengekittet worden wären. Dem ist aber nicht so. Dielmehr gibt
der Querschnitt des Dolchblattes Aufschluh über öie noch unentwickelte Le-
gierungstechnik des Entstehungsalters. Die Mafse des Dolchblattes ist Bronze,
jedoch hat sich bei der Abkühlung des Gusfes das Zinn nach der langsamer sich
kühlenden Mitte zurückgezogen, hat nach der Mitte „gesaigert". Darum er-
scheinen die äußeren Schichten des Blattes purpurrot wie reines Kupfer. Auch
da, wo das Metall in kleinen Blasen durch die Patina hindurchfchlägt, er-
scheint es wie purpurrote Punkte. Das Aastatter Dolchblatt ist also nicht nur
typologisch eine wertvolle Aeuigkeit, fondern gibt auch technisch interessanten
Auffchluh. _
Urnengräber von Landhausen A. Heidelberg.
Aach Zeitungsberichten von P. H. Stemmermann unö
2. Möhren, Heiöelberg.
Am 14. März meldete die Bauleitung der Reichsautobahnen der baöischen
Denkmalspflege, dah bei Sandhaufen eine Reihe von Töpfen gefunden worden
sei, die z. T. noch im Boden steckten. Eine Hnaugenscheinnahme an Ort und
Stelle ergab, dah öie Arbeiter auf ein älrnengrab gestohen waren. Ein grohes
Borratsgefäh, dah noch zur Hälfte im Boden lag, diente als Behälter öes
Leichenbranöes und der zahlreichen kleineren und gröheren Beigefähe, die
z. T. schon herausgenommen waren, zum Teil aber noch unberührt lagen.
404
Aerzierung kann auf ihr nicht festgestellt weröen. Die Griffstange felbst mit
6,5 cm Länge ist sür eine Männerhanö zu klein. Wenn man den Griff mit ge-
schlvssener Hand umfchlieht, so drückt öie Griffplatte unangenehm in öen
Handballen. Dagegen liegt das Werkzeug gut, wenn man den Griff mit vier
Fingern leicht umfaht und den Daumen in die runde Ausbuchtung öcs Gciff-
anfatzes legt. Diese Ausbuchtung hat demnach nicht öekorativen, sondern prak-
tischen Zweck. Bei derartiger Handhabung ist der Dolch wohl zum Schneiöen
und Schaben, nötigenfalls auch zum Abschlachten eines Tieres zu gebrauchen,
aber nicht für den Kampf Mann gegen Mann.
Während bei den bisher bekannten triangulären Dolchen öer Holzgrifl in
slachgeschwungenem weiten Bogen ansetzt, ist hier der untere Griffabfchluh
geradlinig mit leichter Abschrägung der beiden Flügel. Die Form erscheint so
plumper und primitiver. Darin ähnelt unser Aastatter Stück wieder auffällig
dem obengenannten Dolch von Hagenau. Llnd beide wieöer nähern fich mit
diesem Griffabfchluß den Langdolchen der frühen Bronzezeit, öie öfters mit
Metallgrisf gefunöen werden (Behrens: Bronzezeit S. 9 Abb. 2/1). Zwischen
den beiden Arten fteht der von Kraft (Die Stellung öer Schweiz innerhalb der
bronzezeitlichen Kulturgruppen Mitteleuropas. Anzeiger für Schweizerifche
Altertumskunde 1927/28 Taf. 111/6) abgebildete Kurzdolch von Lausanne—
La Bordonnette, der schon stark nach den Langdolchen hin entwickelte Form
aufweist in seinem langen Griff, dem schlanken Blatt und dem weiter gestal-
teten Griffansatz.
Das Gewicht des Dolches steht heute noch auf 170 §. dürfte also im intakten
Zustand etwa 180 § betragen haben (etwa ein Biertel phönikische Mine).
Hn technischer Beziehung ist der Dolch sehr interessant. Anscheinend bestehL
der Griff aus einer anderen Legierung als das Blatt, öenn während an ihm
die Patina schön glatt und gesund erscheint, ist sie auf dem Dolchblatt blafig
und flockig. Hmmerhin könnte aber diese Srscheinung dadurch erklärt werden,
dah der Dolch in einer Lederscheide stak, die bei der Derwesung durch Säure-
bildung auf das Metall eingewirkt hat, während der Griff davon unberührt
blieb. Aufschlußreicher ift eine anöere Beobachtung. An öen neuen
Bruchstellen erkennt man im Querschnitt eine merkwürdige Schichtung, und
zwar so> daß zwei dünne purpurrote Kupferschichten eine innere weihe Lage
umfchliehen. Ein unkunöiger Beobachter könnte versucht sein zu glauben, dah
zwei gleichgeformte öünne Kupferlamellen durch eine weihe Masse zum Dolch-
blatt zufammengekittet worden wären. Dem ist aber nicht so. Dielmehr gibt
der Querschnitt des Dolchblattes Aufschluh über öie noch unentwickelte Le-
gierungstechnik des Entstehungsalters. Die Mafse des Dolchblattes ist Bronze,
jedoch hat sich bei der Abkühlung des Gusfes das Zinn nach der langsamer sich
kühlenden Mitte zurückgezogen, hat nach der Mitte „gesaigert". Darum er-
scheinen die äußeren Schichten des Blattes purpurrot wie reines Kupfer. Auch
da, wo das Metall in kleinen Blasen durch die Patina hindurchfchlägt, er-
scheint es wie purpurrote Punkte. Das Aastatter Dolchblatt ist also nicht nur
typologisch eine wertvolle Aeuigkeit, fondern gibt auch technisch interessanten
Auffchluh. _
Urnengräber von Landhausen A. Heidelberg.
Aach Zeitungsberichten von P. H. Stemmermann unö
2. Möhren, Heiöelberg.
Am 14. März meldete die Bauleitung der Reichsautobahnen der baöischen
Denkmalspflege, dah bei Sandhaufen eine Reihe von Töpfen gefunden worden
sei, die z. T. noch im Boden steckten. Eine Hnaugenscheinnahme an Ort und
Stelle ergab, dah öie Arbeiter auf ein älrnengrab gestohen waren. Ein grohes
Borratsgefäh, dah noch zur Hälfte im Boden lag, diente als Behälter öes
Leichenbranöes und der zahlreichen kleineren und gröheren Beigefähe, die
z. T. schon herausgenommen waren, zum Teil aber noch unberührt lagen.
404