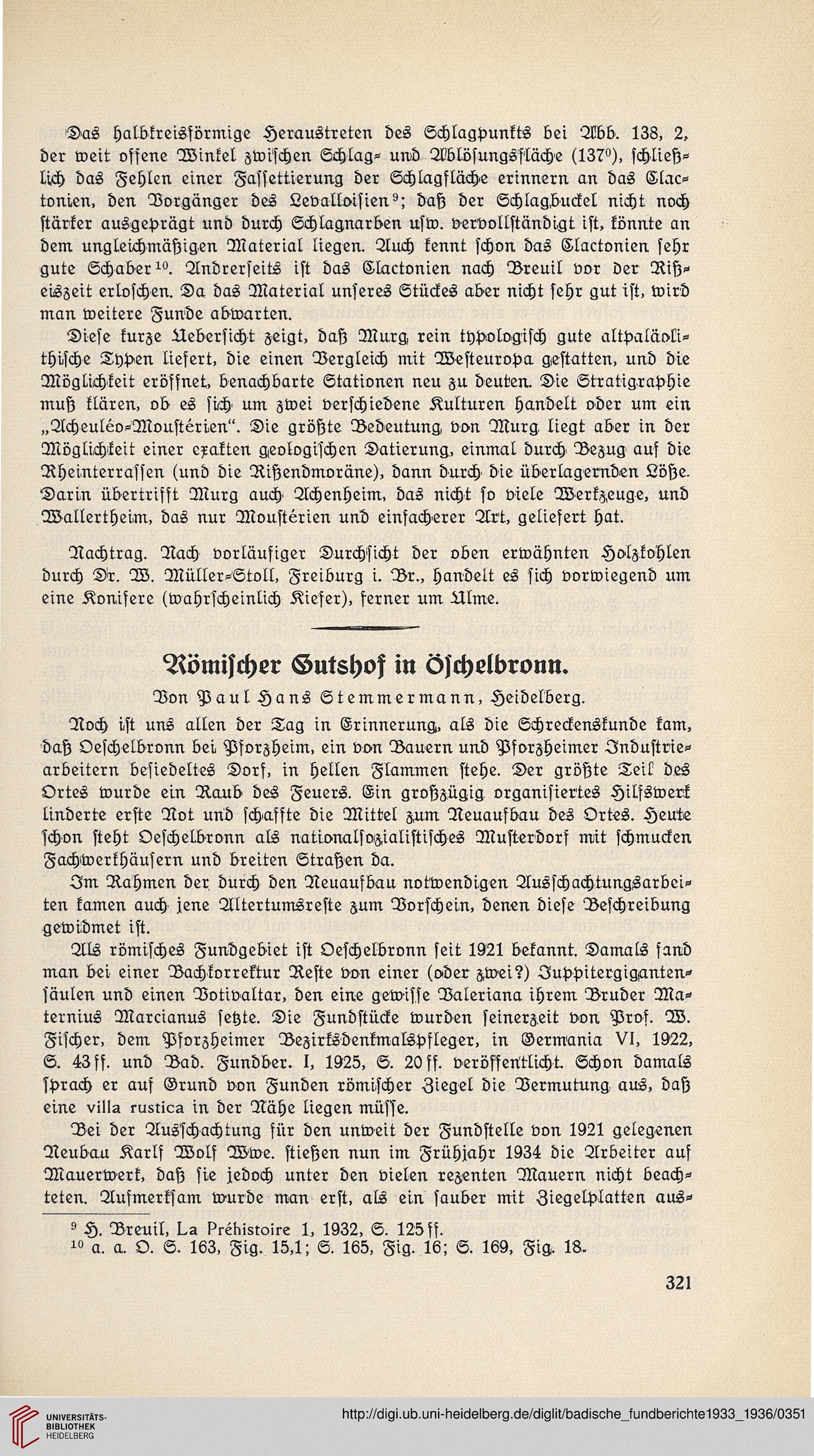'Das halbkreisförmige Heraustreten des Schlagpunkts bei 2lbb. 138, 2,
der weit offene Winkel zwifchen Schlag-- und Ublösungsfläche (137°), schlieh-
lich das Fehlen einer Fassettierung der Schlagfläche erinnern an das Clac-
tonien, den Dorgänger des Levalloisien^; daß der Schlaghuckel nicht noch
ftärker ausgeprägt und durch Schlagnarben usw. vervollständigt ist, könnte an
dem ungleichmähigen Material liegen. Auch kennt schon das Clactonien sehr
gute Schaber". Andrerseits ist öas Clactonien nach Dreuil vor der Rih-
eiszeit erloschen. Da das Material unseres Stückes aber nicht sehr gut ist, wirö
man weitere Funde abwarten.
Diese kurze älebersicht zeigt, daß Murg rein typologisch gute altpaläoli-
thische Typen liefert, die einen Dergleich mit Westeuropa gestatten, und die
Möglichkeit eröffnet, benachbarte Stationen neu zu deuten. Die Stratigraphie
muh klären, ob es sich um zwei verschiedene Kulturen handelt oder um ein
„Acheuleo-Mousterien". Die gröhte Deöeutung von Murg liegt aber in der
Möglichkeit einer exakten geologischen Datierung, einmal durch Dezug auf die
Rheinterrassen (und die Aihendmoräne), dann durch die überlagernden Löhe.
Darin übertrifft Murg auch Achenheim, das nicht so viele Werkzeuge, und
Wallertheim, das nur Mousterien und einfacherer Art, geliefert hat.
Aachtrag. Aach vorläufiger Durchsicht der oben erwähnten Holzkohlen
durch Dr. W. Müller-Stoll, Freiburg i. Dr., handelt es sich vorwiegend um
eine Konifere (Wahrscheinlich Kiefer), ferner um ällme.
MmLscher Gulshof in Öjchelbronn.
Don PaulHans Stemmermann, Heidelberg.
Aoch ist uns allen der Tag in Erinnerung, als die Schreckenskunde kam,
dah Oeschelbronn bei Pforzheim, ein von Dauern und Pforzheimer lZndustrie-
arbeitern besiedeltes Dorf, in hellen Flammen stehe. Der gröhte Teil des
Ortes wurde ein Aaub des Feuers. Ein grohzügig organisiertes Hilfswerk
linderte erste Aot und schaffte die Mittel zum Aeuaufbau öes Ortes. Heute
fchon steht Oeschelbronn als nationalsozialistisches Musterdorf mit schmucken
Fachwerkhäufern und breiten Strahen da.
Jm Rahmen öer durch den Aeuaufbau notwendigen Ausschachtungsarbei-
ten kamen auch jene Altertumsreste zum Dorschein, öenen diese Deschreibung
gewidmet ift.
Als römisches Fundgebiet ist Oeschelbronn seit 1921 bekannt. Damals fand
man bei einer Dachkorrektur Reste von einer (oder zwei?) Juppitergiganten-
säulen und einen Dotivaltar, den eine gewisse Daleriana ihrem Druöer Ma-
ternius Marcianus sehte. Die Fundstücke wurden seinerzeit von Prof. W.
Fischer, dem Pforzheimer Dezirksdenkmalspfleger, in Germania VI, 1922,
S. 43 ff. und Dad. Fundber. I, 1925, S. 20 ff. verösfentlicht. Schon damals
fprach er auf Grund von Funden römischer Ziegel die Dermutung aus, daß
eine villa rusrica in der Aähe liegen müsfe.
Dei der Ausfchachtung für Len unweit der Fundstelle von 1921 gelegenen
Aeubau Karlf Wolf Wwe. stießen nun im Frühjahr 1934 die Arbeiter auf
Mauerwerk, dah sie jedoch unter den vielen rezenten Mauern nicht beach-
teten. Aufmerksam wurde man erst, als ein sauber mit Ziegelplatten aus-
^ H. Dreuil, ba ?rebi8toire 1, 1932, S. 125 ff.
a. a. O. S. 163, Fig. 15,1; S. 165, Fig. 16; S. 169, Fig. 18.
321
der weit offene Winkel zwifchen Schlag-- und Ublösungsfläche (137°), schlieh-
lich das Fehlen einer Fassettierung der Schlagfläche erinnern an das Clac-
tonien, den Dorgänger des Levalloisien^; daß der Schlaghuckel nicht noch
ftärker ausgeprägt und durch Schlagnarben usw. vervollständigt ist, könnte an
dem ungleichmähigen Material liegen. Auch kennt schon das Clactonien sehr
gute Schaber". Andrerseits ist öas Clactonien nach Dreuil vor der Rih-
eiszeit erloschen. Da das Material unseres Stückes aber nicht sehr gut ist, wirö
man weitere Funde abwarten.
Diese kurze älebersicht zeigt, daß Murg rein typologisch gute altpaläoli-
thische Typen liefert, die einen Dergleich mit Westeuropa gestatten, und die
Möglichkeit eröffnet, benachbarte Stationen neu zu deuten. Die Stratigraphie
muh klären, ob es sich um zwei verschiedene Kulturen handelt oder um ein
„Acheuleo-Mousterien". Die gröhte Deöeutung von Murg liegt aber in der
Möglichkeit einer exakten geologischen Datierung, einmal durch Dezug auf die
Rheinterrassen (und die Aihendmoräne), dann durch die überlagernden Löhe.
Darin übertrifft Murg auch Achenheim, das nicht so viele Werkzeuge, und
Wallertheim, das nur Mousterien und einfacherer Art, geliefert hat.
Aachtrag. Aach vorläufiger Durchsicht der oben erwähnten Holzkohlen
durch Dr. W. Müller-Stoll, Freiburg i. Dr., handelt es sich vorwiegend um
eine Konifere (Wahrscheinlich Kiefer), ferner um ällme.
MmLscher Gulshof in Öjchelbronn.
Don PaulHans Stemmermann, Heidelberg.
Aoch ist uns allen der Tag in Erinnerung, als die Schreckenskunde kam,
dah Oeschelbronn bei Pforzheim, ein von Dauern und Pforzheimer lZndustrie-
arbeitern besiedeltes Dorf, in hellen Flammen stehe. Der gröhte Teil des
Ortes wurde ein Aaub des Feuers. Ein grohzügig organisiertes Hilfswerk
linderte erste Aot und schaffte die Mittel zum Aeuaufbau öes Ortes. Heute
fchon steht Oeschelbronn als nationalsozialistisches Musterdorf mit schmucken
Fachwerkhäufern und breiten Strahen da.
Jm Rahmen öer durch den Aeuaufbau notwendigen Ausschachtungsarbei-
ten kamen auch jene Altertumsreste zum Dorschein, öenen diese Deschreibung
gewidmet ift.
Als römisches Fundgebiet ist Oeschelbronn seit 1921 bekannt. Damals fand
man bei einer Dachkorrektur Reste von einer (oder zwei?) Juppitergiganten-
säulen und einen Dotivaltar, den eine gewisse Daleriana ihrem Druöer Ma-
ternius Marcianus sehte. Die Fundstücke wurden seinerzeit von Prof. W.
Fischer, dem Pforzheimer Dezirksdenkmalspfleger, in Germania VI, 1922,
S. 43 ff. und Dad. Fundber. I, 1925, S. 20 ff. verösfentlicht. Schon damals
fprach er auf Grund von Funden römischer Ziegel die Dermutung aus, daß
eine villa rusrica in der Aähe liegen müsfe.
Dei der Ausfchachtung für Len unweit der Fundstelle von 1921 gelegenen
Aeubau Karlf Wolf Wwe. stießen nun im Frühjahr 1934 die Arbeiter auf
Mauerwerk, dah sie jedoch unter den vielen rezenten Mauern nicht beach-
teten. Aufmerksam wurde man erst, als ein sauber mit Ziegelplatten aus-
^ H. Dreuil, ba ?rebi8toire 1, 1932, S. 125 ff.
a. a. O. S. 163, Fig. 15,1; S. 165, Fig. 16; S. 169, Fig. 18.
321