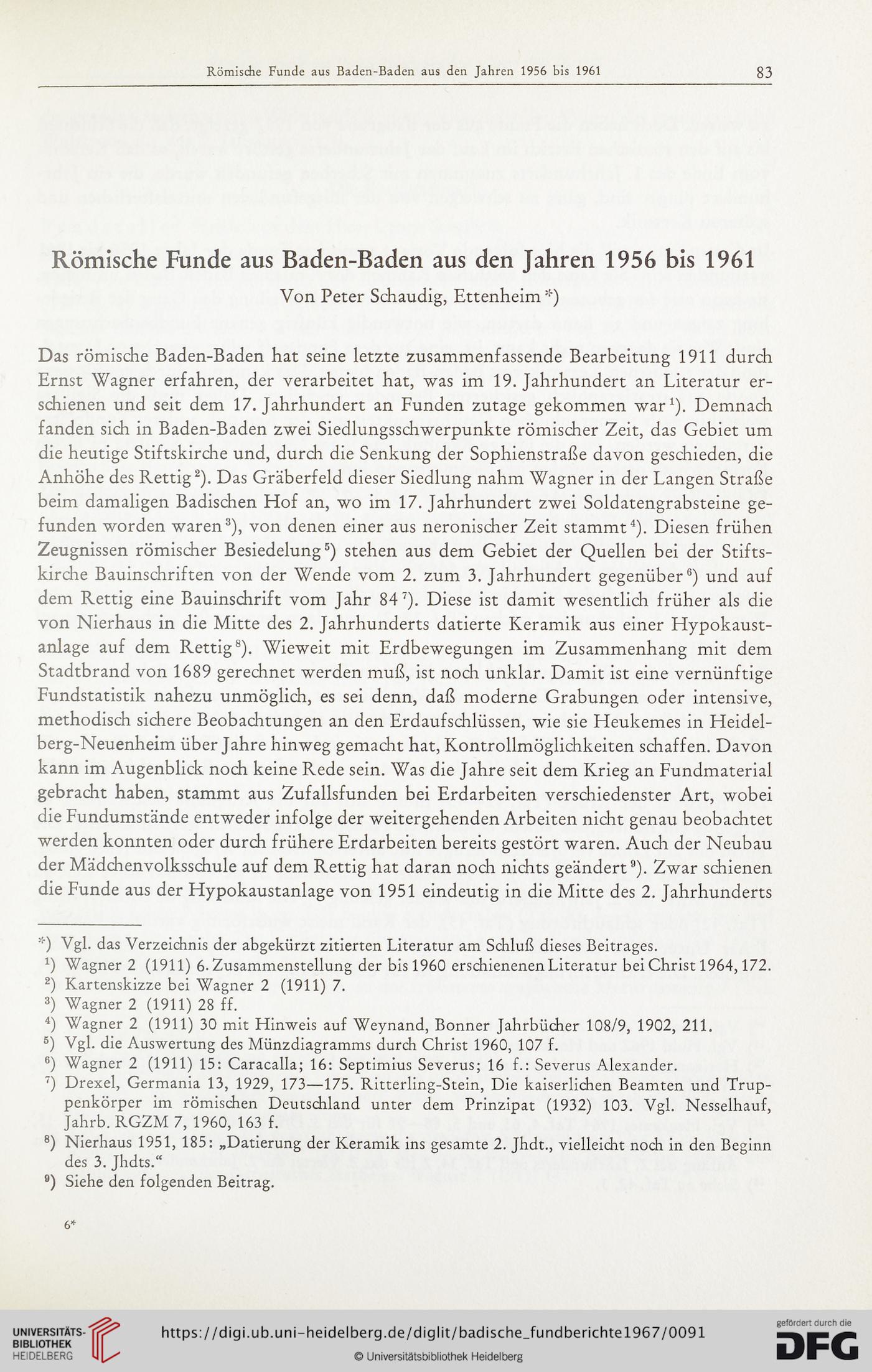Römische Funde aus Baden-Baden aus den Jahren 1956 bis 1961
83
Römische Funde aus Baden-Baden aus den Jahren 1956 bis 1961
Von Peter Schaudig, Ettenheim *)
Das römische Baden-Baden hat seine letzte zusammenfassende Bearbeitung 1911 durch
Ernst Wagner erfahren, der verarbeitet hat, was im 19. Jahrhundert an Literatur er-
schienen und seit dem 17. Jahrhundert an Funden zutage gekommen war1). Demnach
fanden sich in Baden-Baden zwei Siedlungsschwerpunkte römischer Zeit, das Gebiet um
die heutige Stiftskirche und, durch die Senkung der Sophienstraße davon geschieden, die
Anhöhe des Rettig2). Das Gräberfeld dieser Siedlung nahm Wagner in der Langen Straße
beim damaligen Badischen Hof an, wo im 17. Jahrhundert zwei Soldatengrabsteine ge-
funden worden waren3), von denen einer aus neronischer Zeit stammt4). Diesen frühen
Zeugnissen römischer Besiedelung5) stehen aus dem Gebiet der Quellen bei der Stifts-
kirche Bauinschriften von der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert gegenüber6) und auf
dem Rettig eine Bauinschrift vom Jahr 84 7). Diese ist damit wesentlich früher als die
von Nierhaus in die Mitte des 2. Jahrhunderts datierte Keramik aus einer Hypokaust-
anlage auf dem Rettig8). Wieweit mit Erdbewegungen im Zusammenhang mit dem
Stadtbrand von 1689 gerechnet werden muß, ist noch unklar. Damit ist eine vernünftige
Fundstatistik nahezu unmöglich, es sei denn, daß moderne Grabungen oder intensive,
methodisch sichere Beobachtungen an den Erdaufschlüssen, wie sie Heukemes in Heidel-
berg-Neuenheim über Jahre hinweg gemacht hat, Kontrollmöglichkeiten schaffen. Davon
kann im Augenblick noch keine Rede sein. Was die Jahre seit dem Krieg an Fundmaterial
gebracht haben, stammt aus Zufallsfunden bei Erdarbeiten verschiedenster Art, wobei
die Fundumstände entweder infolge der weitergehenden Arbeiten nicht genau beobachtet
werden konnten oder durch frühere Erdarbeiten bereits gestört waren. Auch der Neubau
der Mädchenvolksschule auf dem Rettig hat daran noch nichts geändert9). Zwar schienen
die Funde aus der Hypokaustanlage von 1951 eindeutig in die Mitte des 2. Jahrhunderts
*) Vgl. das Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur am Schluß dieses Beitrages.
4) Wagner 2 (1911) 6. Zusammenstellung der bis 1960 erschienenen Literatur bei Christ 1964,172.
2) Kartenskizze bei Wagner 2 (1911) 7.
3) Wagner 2 (1911) 28 ff.
4) Wagner 2 (1911) 30 mit Hinweis auf Weynand, Bonner Jahrbücher 108/9, 1902, 211.
5) Vgl. die Auswertung des Münzdiagramms durch Christ 1960, 107 f.
6) Wagner 2 (1911) 15: Caracalla; 16: Septimius Severus; 16 f.: Severus Alexander.
7) Drexel, Germania 13, 1929, 173—175. Ritterling-Stein, Die kaiserlichen Beamten und Trup-
penkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat (1932) 103. Vgl. Nesselhauf,
Jahrb. RGZM 7, 1960, 163 f.
8) Nierhaus 1951, 185: „Datierung der Keramik ins gesamte 2. Jhdt., vielleicht noch in den Beginn
des 3. Jhdts.“
®) Siehe den folgenden Beitrag.
6*
83
Römische Funde aus Baden-Baden aus den Jahren 1956 bis 1961
Von Peter Schaudig, Ettenheim *)
Das römische Baden-Baden hat seine letzte zusammenfassende Bearbeitung 1911 durch
Ernst Wagner erfahren, der verarbeitet hat, was im 19. Jahrhundert an Literatur er-
schienen und seit dem 17. Jahrhundert an Funden zutage gekommen war1). Demnach
fanden sich in Baden-Baden zwei Siedlungsschwerpunkte römischer Zeit, das Gebiet um
die heutige Stiftskirche und, durch die Senkung der Sophienstraße davon geschieden, die
Anhöhe des Rettig2). Das Gräberfeld dieser Siedlung nahm Wagner in der Langen Straße
beim damaligen Badischen Hof an, wo im 17. Jahrhundert zwei Soldatengrabsteine ge-
funden worden waren3), von denen einer aus neronischer Zeit stammt4). Diesen frühen
Zeugnissen römischer Besiedelung5) stehen aus dem Gebiet der Quellen bei der Stifts-
kirche Bauinschriften von der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert gegenüber6) und auf
dem Rettig eine Bauinschrift vom Jahr 84 7). Diese ist damit wesentlich früher als die
von Nierhaus in die Mitte des 2. Jahrhunderts datierte Keramik aus einer Hypokaust-
anlage auf dem Rettig8). Wieweit mit Erdbewegungen im Zusammenhang mit dem
Stadtbrand von 1689 gerechnet werden muß, ist noch unklar. Damit ist eine vernünftige
Fundstatistik nahezu unmöglich, es sei denn, daß moderne Grabungen oder intensive,
methodisch sichere Beobachtungen an den Erdaufschlüssen, wie sie Heukemes in Heidel-
berg-Neuenheim über Jahre hinweg gemacht hat, Kontrollmöglichkeiten schaffen. Davon
kann im Augenblick noch keine Rede sein. Was die Jahre seit dem Krieg an Fundmaterial
gebracht haben, stammt aus Zufallsfunden bei Erdarbeiten verschiedenster Art, wobei
die Fundumstände entweder infolge der weitergehenden Arbeiten nicht genau beobachtet
werden konnten oder durch frühere Erdarbeiten bereits gestört waren. Auch der Neubau
der Mädchenvolksschule auf dem Rettig hat daran noch nichts geändert9). Zwar schienen
die Funde aus der Hypokaustanlage von 1951 eindeutig in die Mitte des 2. Jahrhunderts
*) Vgl. das Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur am Schluß dieses Beitrages.
4) Wagner 2 (1911) 6. Zusammenstellung der bis 1960 erschienenen Literatur bei Christ 1964,172.
2) Kartenskizze bei Wagner 2 (1911) 7.
3) Wagner 2 (1911) 28 ff.
4) Wagner 2 (1911) 30 mit Hinweis auf Weynand, Bonner Jahrbücher 108/9, 1902, 211.
5) Vgl. die Auswertung des Münzdiagramms durch Christ 1960, 107 f.
6) Wagner 2 (1911) 15: Caracalla; 16: Septimius Severus; 16 f.: Severus Alexander.
7) Drexel, Germania 13, 1929, 173—175. Ritterling-Stein, Die kaiserlichen Beamten und Trup-
penkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat (1932) 103. Vgl. Nesselhauf,
Jahrb. RGZM 7, 1960, 163 f.
8) Nierhaus 1951, 185: „Datierung der Keramik ins gesamte 2. Jhdt., vielleicht noch in den Beginn
des 3. Jhdts.“
®) Siehe den folgenden Beitrag.
6*