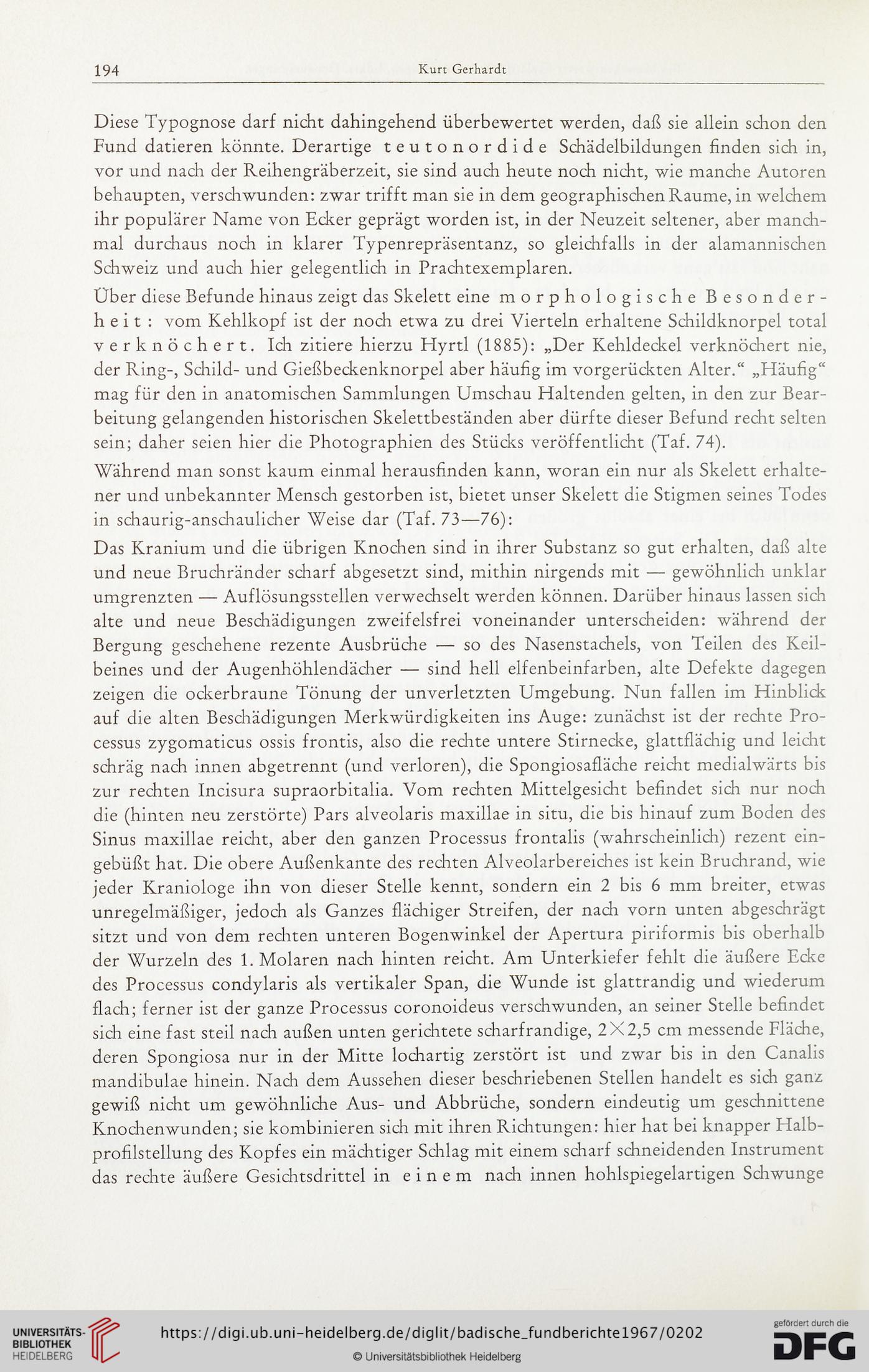194
Kurt Gerhardt
Diese Typognose darf nicht dahingehend überbewertet werden, daß sie allein schon den
Fund datieren könnte. Derartige teutonordide Schädelbildungen finden sich in,
vor und nach der Reihengräberzeit, sie sind auch heute noch nicht, wie manche Autoren
behaupten, verschwunden: zwar trifft man sie in dem geographischen Raume, in welchem
ihr populärer Name von Ecker geprägt worden ist, in der Neuzeit seltener, aber manch-
mal durchaus noch in klarer Typenrepräsentanz, so gleichfalls in der alamannischen
Schweiz und auch hier gelegentlich in Prachtexemplaren.
Über diese Befunde hinaus zeigt das Skelett eine morphologische Besonder-
heit: vom Kehlkopf ist der noch etwa zu drei Vierteln erhaltene Schildknorpel total
verknöchert. Ich zitiere hierzu Hyrtl (1885): „Der Kehldeckel verknöchert nie,
der Ring-, Schild- und Gießbeckenknorpel aber häufig im vorgerückten Alter.“ „Häufig“
mag für den in anatomischen Sammlungen Umschau Haltenden gelten, in den zur Bear-
beitung gelangenden historischen Skelettbeständen aber dürfte dieser Befund recht selten
sein; daher seien hier die Photographien des Stücks veröffentlicht (Taf. 74).
Während man sonst kaum einmal herausfinden kann, woran ein nur als Skelett erhalte-
ner und unbekannter Mensch gestorben ist, bietet unser Skelett die Stigmen seines Todes
in schaurig-anschaulicher Weise dar (Taf. 73—76):
Das Kranium und die übrigen Knochen sind in ihrer Substanz so gut erhalten, daß alte
und neue Bruchränder scharf abgesetzt sind, mithin nirgends mit — gewöhnlich unklar
umgrenzten — Auflösungsstellen verwechselt werden können. Darüber hinaus lassen sich
alte und neue Beschädigungen zweifelsfrei voneinander unterscheiden: während der
Bergung geschehene rezente Ausbrüche — so des Nasenstachels, von Teilen des Keil-
beines und der Augenhöhlendächer — sind hell elfenbeinfarben, alte Defekte dagegen
zeigen die ockerbraune Tönung der unverletzten Umgebung. Nun fallen im Hinblick
auf die alten Beschädigungen Merkwürdigkeiten ins Auge: zunächst ist der rechte Pro-
cessus zygomaticus ossis frontis, also die rechte untere Stirnecke, glattflächig und leicht
schräg nach innen abgetrennt (und verloren), die Spongiosafläche reicht medialwärts bis
zur rechten Incisura supraorbitalia. Vom rechten Mittelgesicht befindet sich nur noch
die (hinten neu zerstörte) Pars alveolaris maxillae in situ, die bis hinauf zum Boden des
Sinus maxillae reicht, aber den ganzen Processus frontalis (wahrscheinlich) rezent ein-
gebüßt hat. Die obere Außenkante des rechten Alveolarbereiches ist kein Bruchrand, wie
jeder Kraniologe ihn von dieser Stelle kennt, sondern ein 2 bis 6 mm breiter, etwas
unregelmäßiger, jedoch als Ganzes flächiger Streifen, der nach vorn unten abgeschrägt
sitzt und von dem rechten unteren Bogenwinkel der Apertura piriformis bis oberhalb
der Wurzeln des 1. Molaren nach hinten reicht. Am Unterkiefer fehlt die äußere Ecke
des Processus condylaris als vertikaler Span, die Wunde ist glattrandig und wiederum
flach; ferner ist der ganze Processus coronoideus verschwunden, an seiner Stelle befindet
sich eine fast steil nach außen unten gerichtete scharfrandige, 2X2,5 cm messende Fläche,
deren Spongiosa nur in der Mitte lochartig zerstört ist und zwar bis in den Canalis
mandibulae hinein. Nach dem Aussehen dieser beschriebenen Stellen handelt es sich ganz
gewiß nicht um gewöhnliche Aus- und Abbrüche, sondern eindeutig um geschnittene
Knochenwunden; sie kombinieren sich mit ihren Richtungen: hier hat bei knapper Halb-
profilstellung des Kopfes ein mächtiger Schlag mit einem scharf schneidenden Instrument
das rechte äußere Gesichtsdrittel in einem nach innen hohlspiegelartigen Schwünge
Kurt Gerhardt
Diese Typognose darf nicht dahingehend überbewertet werden, daß sie allein schon den
Fund datieren könnte. Derartige teutonordide Schädelbildungen finden sich in,
vor und nach der Reihengräberzeit, sie sind auch heute noch nicht, wie manche Autoren
behaupten, verschwunden: zwar trifft man sie in dem geographischen Raume, in welchem
ihr populärer Name von Ecker geprägt worden ist, in der Neuzeit seltener, aber manch-
mal durchaus noch in klarer Typenrepräsentanz, so gleichfalls in der alamannischen
Schweiz und auch hier gelegentlich in Prachtexemplaren.
Über diese Befunde hinaus zeigt das Skelett eine morphologische Besonder-
heit: vom Kehlkopf ist der noch etwa zu drei Vierteln erhaltene Schildknorpel total
verknöchert. Ich zitiere hierzu Hyrtl (1885): „Der Kehldeckel verknöchert nie,
der Ring-, Schild- und Gießbeckenknorpel aber häufig im vorgerückten Alter.“ „Häufig“
mag für den in anatomischen Sammlungen Umschau Haltenden gelten, in den zur Bear-
beitung gelangenden historischen Skelettbeständen aber dürfte dieser Befund recht selten
sein; daher seien hier die Photographien des Stücks veröffentlicht (Taf. 74).
Während man sonst kaum einmal herausfinden kann, woran ein nur als Skelett erhalte-
ner und unbekannter Mensch gestorben ist, bietet unser Skelett die Stigmen seines Todes
in schaurig-anschaulicher Weise dar (Taf. 73—76):
Das Kranium und die übrigen Knochen sind in ihrer Substanz so gut erhalten, daß alte
und neue Bruchränder scharf abgesetzt sind, mithin nirgends mit — gewöhnlich unklar
umgrenzten — Auflösungsstellen verwechselt werden können. Darüber hinaus lassen sich
alte und neue Beschädigungen zweifelsfrei voneinander unterscheiden: während der
Bergung geschehene rezente Ausbrüche — so des Nasenstachels, von Teilen des Keil-
beines und der Augenhöhlendächer — sind hell elfenbeinfarben, alte Defekte dagegen
zeigen die ockerbraune Tönung der unverletzten Umgebung. Nun fallen im Hinblick
auf die alten Beschädigungen Merkwürdigkeiten ins Auge: zunächst ist der rechte Pro-
cessus zygomaticus ossis frontis, also die rechte untere Stirnecke, glattflächig und leicht
schräg nach innen abgetrennt (und verloren), die Spongiosafläche reicht medialwärts bis
zur rechten Incisura supraorbitalia. Vom rechten Mittelgesicht befindet sich nur noch
die (hinten neu zerstörte) Pars alveolaris maxillae in situ, die bis hinauf zum Boden des
Sinus maxillae reicht, aber den ganzen Processus frontalis (wahrscheinlich) rezent ein-
gebüßt hat. Die obere Außenkante des rechten Alveolarbereiches ist kein Bruchrand, wie
jeder Kraniologe ihn von dieser Stelle kennt, sondern ein 2 bis 6 mm breiter, etwas
unregelmäßiger, jedoch als Ganzes flächiger Streifen, der nach vorn unten abgeschrägt
sitzt und von dem rechten unteren Bogenwinkel der Apertura piriformis bis oberhalb
der Wurzeln des 1. Molaren nach hinten reicht. Am Unterkiefer fehlt die äußere Ecke
des Processus condylaris als vertikaler Span, die Wunde ist glattrandig und wiederum
flach; ferner ist der ganze Processus coronoideus verschwunden, an seiner Stelle befindet
sich eine fast steil nach außen unten gerichtete scharfrandige, 2X2,5 cm messende Fläche,
deren Spongiosa nur in der Mitte lochartig zerstört ist und zwar bis in den Canalis
mandibulae hinein. Nach dem Aussehen dieser beschriebenen Stellen handelt es sich ganz
gewiß nicht um gewöhnliche Aus- und Abbrüche, sondern eindeutig um geschnittene
Knochenwunden; sie kombinieren sich mit ihren Richtungen: hier hat bei knapper Halb-
profilstellung des Kopfes ein mächtiger Schlag mit einem scharf schneidenden Instrument
das rechte äußere Gesichtsdrittel in einem nach innen hohlspiegelartigen Schwünge