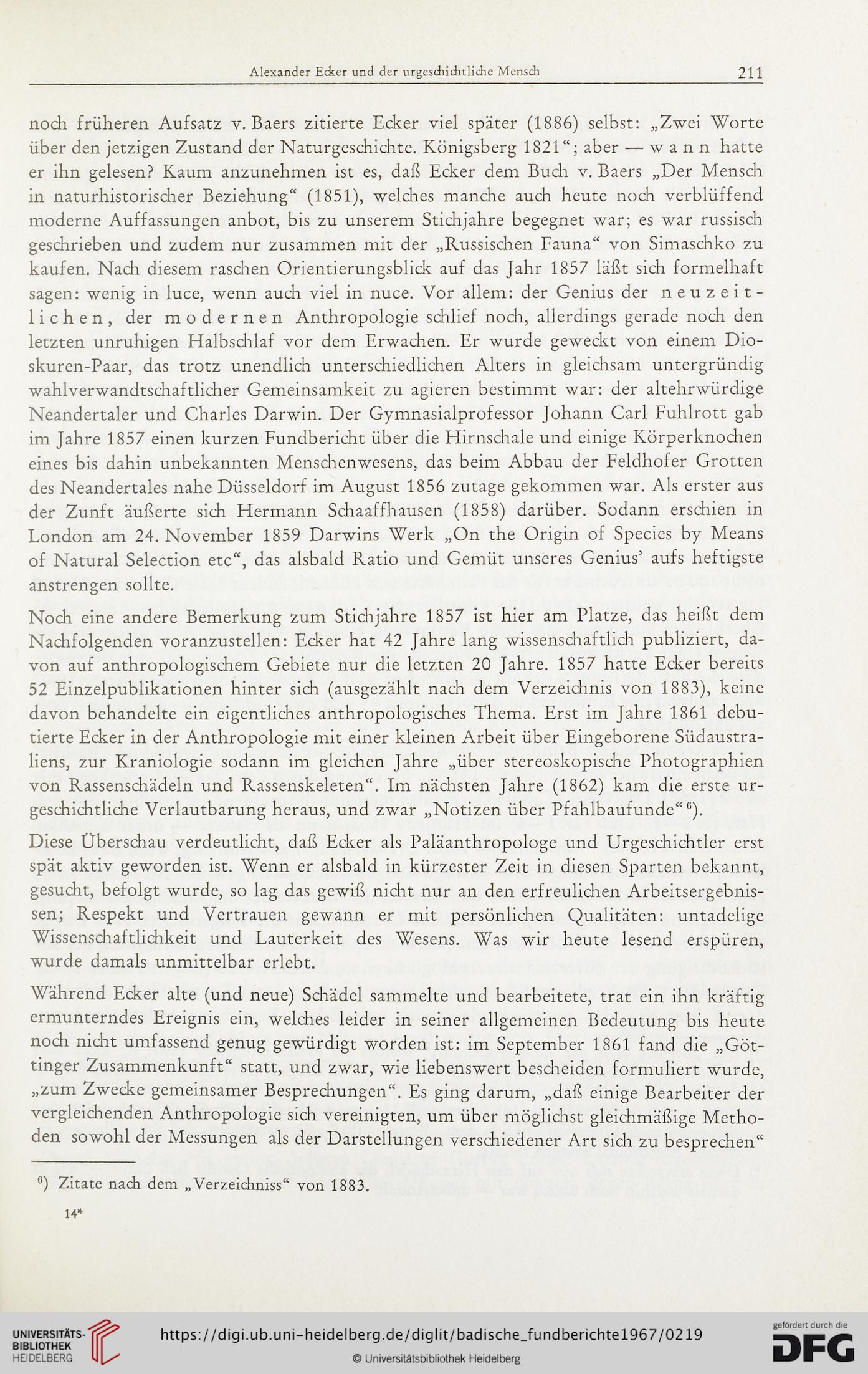Alexander Ecker und der urgeschichtliche Mensch
211
noch früheren Aufsatz v. Baers zitierte Ecker viel später (1886) selbst: „Zwei Worte
über den jetzigen Zustand der Naturgeschichte. Königsberg 1821“; aber — wann hatte
er ihn gelesen? Kaum anzunehmen ist es, daß Ecker dem Buch v. Baers „Der Mensch
in naturhistorischer Beziehung“ (1851), welches manche auch heute noch verblüffend
moderne Auffassungen anbot, bis zu unserem Stichjahre begegnet war; es war russisch
geschrieben und zudem nur zusammen mit der „Russischen Fauna“ von Simaschko zu
kaufen. Nach diesem raschen Orientierungsblick auf das Jahr 1857 läßt sich formelhaft
sagen: wenig in luce, wenn auch viel in nuce. Vor allem: der Genius der neuzeit-
lichen, der modernen Anthropologie schlief noch, allerdings gerade noch den
letzten unruhigen Halbschlaf vor dem Erwachen. Er wurde geweckt von einem Dio-
skuren-Paar, das trotz unendlich unterschiedlichen Alters in gleichsam untergründig
wahlverwandtschaftlicher Gemeinsamkeit zu agieren bestimmt war: der altehrwürdige
Neandertaler und Charles Darwin. Der Gymnasialprofessor Johann Carl Fuhlrott gab
im Jahre 1857 einen kurzen Fundbericht über die Hirnschale und einige Körperknochen
eines bis dahin unbekannten Menschenwesens, das beim Abbau der Feldhofer Grotten
des Neandertales nahe Düsseldorf im August 1856 zutage gekommen war. Als erster aus
der Zunft äußerte sich Hermann Schaaffhausen (1858) darüber. Sodann erschien in
London am 24. November 1859 Darwins Werk „On the Origin of Species by Means
of Natural Selection etc“, das alsbald Ratio und Gemüt unseres Genius’ aufs heftigste
anstrengen sollte.
Noch eine andere Bemerkung zum Stichjahre 1857 ist hier am Platze, das heißt dem
Nachfolgenden voranzustellen: Ecker hat 42 Jahre lang wissenschaftlich publiziert, da-
von auf anthropologischem Gebiete nur die letzten 20 Jahre. 1857 hatte Ecker bereits
52 Einzelpublikationen hinter sich (ausgezählt nach dem Verzeichnis von 1883), keine
davon behandelte ein eigentliches anthropologisches Thema. Erst im Jahre 1861 debü-
tierte Ecker in der Anthropologie mit einer kleinen Arbeit über Eingeborene Südaustra-
liens, zur Kraniologie sodann im gleichen Jahre „über stereoskopische Photographien
von Rassenschädeln und Rassenskeleten“. Im nächsten Jahre (1862) kam die erste ur-
geschichtliche Verlautbarung heraus, und zwar „Notizen über Pfahlbaufunde“6).
Diese Überschau verdeutlicht, daß Ecker als Paläanthropologe und Urgeschichtler erst
spät aktiv geworden ist. Wenn er alsbald in kürzester Zeit in diesen Sparten bekannt,
gesucht, befolgt wurde, so lag das gewiß nicht nur an den erfreulichen Arbeitsergebnis-
sen; Respekt und Vertrauen gewann er mit persönlichen Qualitäten: untadelige
Wissenschaftlichkeit und Lauterkeit des Wesens. Was wir heute lesend erspüren,
wurde damals unmittelbar erlebt.
Während Ecker alte (und neue) Schädel sammelte und bearbeitete, trat ein ihn kräftig
ermunterndes Ereignis ein, welches leider in seiner allgemeinen Bedeutung bis heute
noch nicht umfassend genug gewürdigt worden ist: im September 1861 fand die „Göt-
tinger Zusammenkunft“ statt, und zwar, wie liebenswert bescheiden formuliert wurde,
„zum Zwecke gemeinsamer Besprechungen“. Es ging darum, „daß einige Bearbeiter der
vergleichenden Anthropologie sich vereinigten, um über möglichst gleichmäßige Metho-
den sowohl der Messungen als der Darstellungen verschiedener Art sich zu besprechen“
6) Zitate nach dem „Verzeichniss“ von 1883.
14*
211
noch früheren Aufsatz v. Baers zitierte Ecker viel später (1886) selbst: „Zwei Worte
über den jetzigen Zustand der Naturgeschichte. Königsberg 1821“; aber — wann hatte
er ihn gelesen? Kaum anzunehmen ist es, daß Ecker dem Buch v. Baers „Der Mensch
in naturhistorischer Beziehung“ (1851), welches manche auch heute noch verblüffend
moderne Auffassungen anbot, bis zu unserem Stichjahre begegnet war; es war russisch
geschrieben und zudem nur zusammen mit der „Russischen Fauna“ von Simaschko zu
kaufen. Nach diesem raschen Orientierungsblick auf das Jahr 1857 läßt sich formelhaft
sagen: wenig in luce, wenn auch viel in nuce. Vor allem: der Genius der neuzeit-
lichen, der modernen Anthropologie schlief noch, allerdings gerade noch den
letzten unruhigen Halbschlaf vor dem Erwachen. Er wurde geweckt von einem Dio-
skuren-Paar, das trotz unendlich unterschiedlichen Alters in gleichsam untergründig
wahlverwandtschaftlicher Gemeinsamkeit zu agieren bestimmt war: der altehrwürdige
Neandertaler und Charles Darwin. Der Gymnasialprofessor Johann Carl Fuhlrott gab
im Jahre 1857 einen kurzen Fundbericht über die Hirnschale und einige Körperknochen
eines bis dahin unbekannten Menschenwesens, das beim Abbau der Feldhofer Grotten
des Neandertales nahe Düsseldorf im August 1856 zutage gekommen war. Als erster aus
der Zunft äußerte sich Hermann Schaaffhausen (1858) darüber. Sodann erschien in
London am 24. November 1859 Darwins Werk „On the Origin of Species by Means
of Natural Selection etc“, das alsbald Ratio und Gemüt unseres Genius’ aufs heftigste
anstrengen sollte.
Noch eine andere Bemerkung zum Stichjahre 1857 ist hier am Platze, das heißt dem
Nachfolgenden voranzustellen: Ecker hat 42 Jahre lang wissenschaftlich publiziert, da-
von auf anthropologischem Gebiete nur die letzten 20 Jahre. 1857 hatte Ecker bereits
52 Einzelpublikationen hinter sich (ausgezählt nach dem Verzeichnis von 1883), keine
davon behandelte ein eigentliches anthropologisches Thema. Erst im Jahre 1861 debü-
tierte Ecker in der Anthropologie mit einer kleinen Arbeit über Eingeborene Südaustra-
liens, zur Kraniologie sodann im gleichen Jahre „über stereoskopische Photographien
von Rassenschädeln und Rassenskeleten“. Im nächsten Jahre (1862) kam die erste ur-
geschichtliche Verlautbarung heraus, und zwar „Notizen über Pfahlbaufunde“6).
Diese Überschau verdeutlicht, daß Ecker als Paläanthropologe und Urgeschichtler erst
spät aktiv geworden ist. Wenn er alsbald in kürzester Zeit in diesen Sparten bekannt,
gesucht, befolgt wurde, so lag das gewiß nicht nur an den erfreulichen Arbeitsergebnis-
sen; Respekt und Vertrauen gewann er mit persönlichen Qualitäten: untadelige
Wissenschaftlichkeit und Lauterkeit des Wesens. Was wir heute lesend erspüren,
wurde damals unmittelbar erlebt.
Während Ecker alte (und neue) Schädel sammelte und bearbeitete, trat ein ihn kräftig
ermunterndes Ereignis ein, welches leider in seiner allgemeinen Bedeutung bis heute
noch nicht umfassend genug gewürdigt worden ist: im September 1861 fand die „Göt-
tinger Zusammenkunft“ statt, und zwar, wie liebenswert bescheiden formuliert wurde,
„zum Zwecke gemeinsamer Besprechungen“. Es ging darum, „daß einige Bearbeiter der
vergleichenden Anthropologie sich vereinigten, um über möglichst gleichmäßige Metho-
den sowohl der Messungen als der Darstellungen verschiedener Art sich zu besprechen“
6) Zitate nach dem „Verzeichniss“ von 1883.
14*