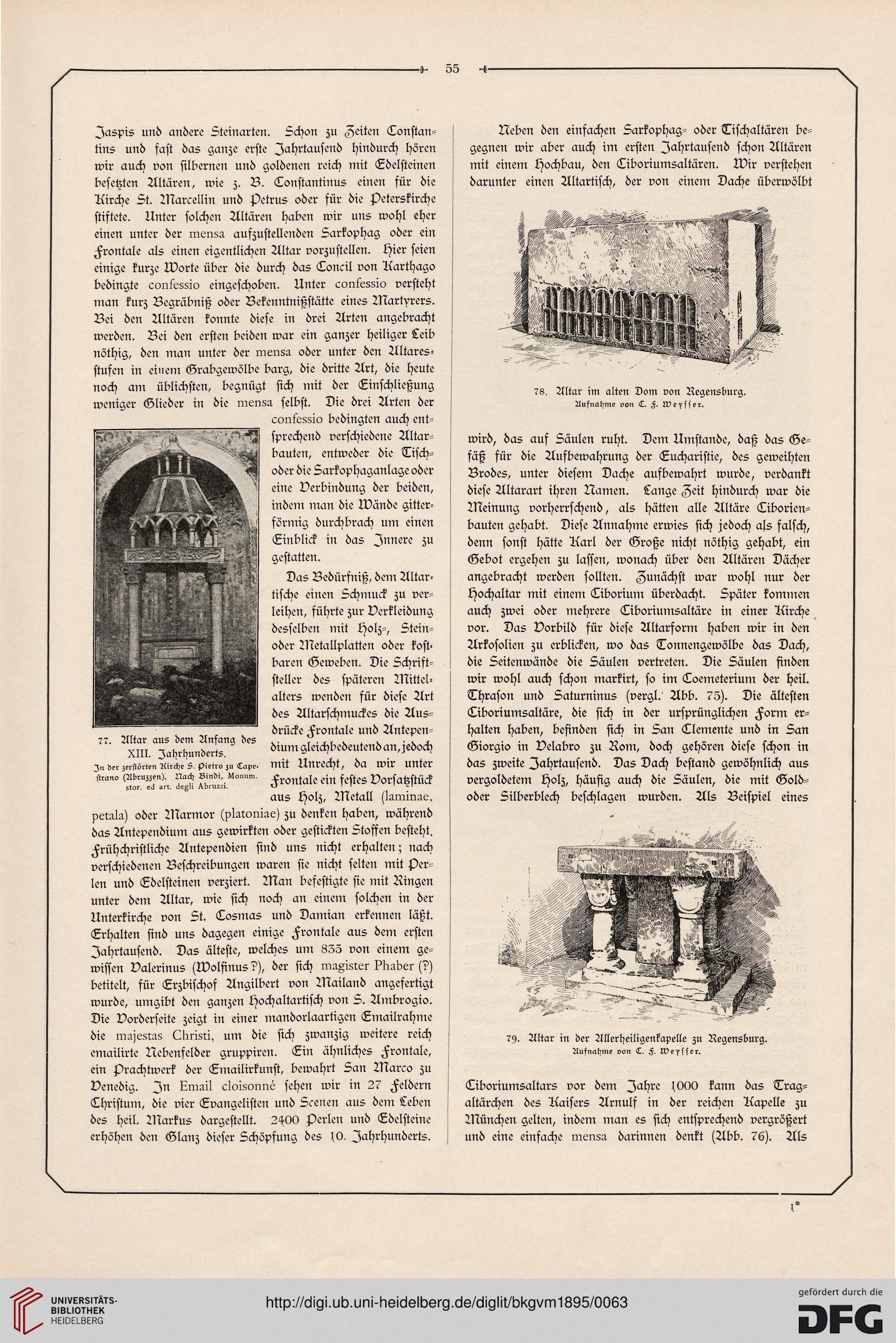Jaspis und andere Steinarten. Schon zu Zeiten Lonstan-
tins und fast das ganze erste Jahrtausend hindurch hören
wir auch von silbernen und goldenen reich mit Edelsteinen
besetzten Altären, wie z. B. Tonstantinus einen für die
Kirche St. Marcellin und Petrus oder für die Peterskirche
stiftete. Unter solchen Altären haben wir uns wohl eher
einen unter der mensa aufzustellenden Sarkophag oder ein
Frontale als einen eigentlichen Altar vorzustcllen. £)ier feien
einige kurze Worte über die durch das Toncil von Karthago
bedingte contessio eingeschoben. Unter contessio versteht
man kurz Begräbniß oder Bekenntnißstätte eines Märtyrers.
Bei den Altären konnte diese in drei Arten angebracht
werden. Bei den ersten beiden war ein ganzer heiliger Leib
nöthig, den man unter der mensa oder unter den Altares-
stufen in einem Grabgewölbe barg, die dritte Art, die heute
noch am üblichsten, begnügt sich mit der Einschließung
weniger Glieder in die mensa selbst. Die drei Arten der
confessio bedingten auch ent-
sprechend verschiedene Altar-
bauten, entweder die Tisch-
oder die Sarkophaganlage oder
eine Verbindung der beiden,
indem man die Wände gitter-
förmig durchbrach um einen
Einblick in das Innere zu
gestatten.
Das Bedürfniß, dem Altar-
tische einen Schmuck zu ver-
leihen, führte zur Verkleidung
desselben mit Holz-, Stein-
oder Metallplatten oder kost-
baren Geweben. Die Schrift-
steller des späteren Mittel-
alters wenden für diese Art
des Altarschmuckes die Aus-
drücke Frontale und Antepen-
dium gleichbedeutend an,jedoch
mit Unrecht, da wir unter
Frontale ein festes Vorsatzstück
aus Holz, Metall (laminae,
petala) oder Marmor (platoniae) zu denken haben, während
das Antependium aus gewirkten oder gestickten Stoffen besteht.
Frühchristliche Antependien sind uns nicht erhalten; nach
verschiedenen Beschreibungen waren sic nicht selten mit per-
len und Edelsteinen verziert. Man befestigte sie mit Ringen
unter den: Altar, wie sich noch an einem solchen in der
Unterkirche von St. Eosmas und Damian erkennen läßt.
Erhalten sind uns dagegen einige Frontale aus de,n ersten
Jahrtausend. Das älteste, welches um 835 von einem ge-
wissen valerinus (wolfinus?), der sich magister Phaber (?)
betitelt, für Erzbischof Angilbert von Mailand angefertigt
wurde, umgibt den ganzen Hochaltartisch von S. Ambrogio.
Die Vorderseite zeigt in einer mandorlaartigcn Lmailrahme
die majesras Christi, um die sich zwanzig weitere reich
emailirte Nebenfelder gruppiren. Ein ähnliches Frontale,
ein Prachtwerk der Emailirkunft, bewahrt San Marco zu
Venedig. In Email cloisonn£ sehen wir in 27 Feldern
Ehristum, die vier Evangelisten und Scenen aus dem Leben
des heil. Markus dargestellt. 2f(00 perlen und Edelsteine
erhöhen den Glanz dieser Schöpfung des (0. Jahrhunderts.
77. Altar aus dem Anfang des
XIII. Jahrhunderts.
In der zerstörten Kirche S. Pietro zu Lape-
strano (Abruzzen). Nach Bindi, Monum.
stör, ed art. degli Abruzzi.
Neben den einfachen Sarkophag- oder Tischaltären be-
gegnen wir aber auch im ersten Jahrtausend schon Altären
mit einem Hochbau, den Tiboriumsaltären. Wir verstehen
darunter einen Altartisch, der von einem Dache überwölbt
78. Altar im alten Dom von Regensburg.
Aufnahme von €. F. weysser.
wird, das auf Säulen ruht. Dem Umstande, daß das Ge-
fäß für die Aufbewahrung der Eucharistie, des geweihten
Brodes, unter diesem Dache aufbewahrt wurde, verdankt
diese Altarart ihren Namen. Lange Zeit hindurch war die
Meinung vorherrschend, als hätten alle Altäre Tiborien-
bauten gehabt. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch,
denn sonst hätte Karl der Große nicht nöthig gehabt, ein
Gebot ergehen zu lassen, wonach über den Altären Dächer
angebracht werden sollten. Zunächst war wohl nur der
Hochaltar mit einem Tiborium überdacht. Später kommen
auch zwei oder mehrere Tiboriumsaltäre in einer Kirche
vor. Das Vorbild für diese Altarform haben wir in den
Arkosolien zu erblicken, wo das Tonnengewölbe das Dach,
die Seitenwände die Säulen vertreten. Die Säulen finden
wir wohl auch schon markirt, so im Toemeterium der heil.
Thrason und Saturninus (vergl. Abb. 75). Die ältesten
Tiboriumsaltäre, die sich in der ursprünglichen Form er-
halten haben, befinden sich in San Elemente und in San
Giorgio in Velabro zu Rom, doch gehören diese schon in
das zweite Jahrtausend. Das Dach bestand gewöhnlich aus
vergoldetem Holz, häufig auch die Säulen, die mit Gold-
oder Silberblech beschlagen wurden. Als Beispiel eines
79. Altar in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg.
Aufnahme von C. F. weysser.
Tiboriumsaltars vor dem Jahre (000 kann das Trag-
altärchen des Kaisers Arnulf in der reichen Kapelle zu
München gelten, indem man es sich entsprechend vergrößert
und eine einfache mensa darinnen denkt (Abb. 76). Als
tins und fast das ganze erste Jahrtausend hindurch hören
wir auch von silbernen und goldenen reich mit Edelsteinen
besetzten Altären, wie z. B. Tonstantinus einen für die
Kirche St. Marcellin und Petrus oder für die Peterskirche
stiftete. Unter solchen Altären haben wir uns wohl eher
einen unter der mensa aufzustellenden Sarkophag oder ein
Frontale als einen eigentlichen Altar vorzustcllen. £)ier feien
einige kurze Worte über die durch das Toncil von Karthago
bedingte contessio eingeschoben. Unter contessio versteht
man kurz Begräbniß oder Bekenntnißstätte eines Märtyrers.
Bei den Altären konnte diese in drei Arten angebracht
werden. Bei den ersten beiden war ein ganzer heiliger Leib
nöthig, den man unter der mensa oder unter den Altares-
stufen in einem Grabgewölbe barg, die dritte Art, die heute
noch am üblichsten, begnügt sich mit der Einschließung
weniger Glieder in die mensa selbst. Die drei Arten der
confessio bedingten auch ent-
sprechend verschiedene Altar-
bauten, entweder die Tisch-
oder die Sarkophaganlage oder
eine Verbindung der beiden,
indem man die Wände gitter-
förmig durchbrach um einen
Einblick in das Innere zu
gestatten.
Das Bedürfniß, dem Altar-
tische einen Schmuck zu ver-
leihen, führte zur Verkleidung
desselben mit Holz-, Stein-
oder Metallplatten oder kost-
baren Geweben. Die Schrift-
steller des späteren Mittel-
alters wenden für diese Art
des Altarschmuckes die Aus-
drücke Frontale und Antepen-
dium gleichbedeutend an,jedoch
mit Unrecht, da wir unter
Frontale ein festes Vorsatzstück
aus Holz, Metall (laminae,
petala) oder Marmor (platoniae) zu denken haben, während
das Antependium aus gewirkten oder gestickten Stoffen besteht.
Frühchristliche Antependien sind uns nicht erhalten; nach
verschiedenen Beschreibungen waren sic nicht selten mit per-
len und Edelsteinen verziert. Man befestigte sie mit Ringen
unter den: Altar, wie sich noch an einem solchen in der
Unterkirche von St. Eosmas und Damian erkennen läßt.
Erhalten sind uns dagegen einige Frontale aus de,n ersten
Jahrtausend. Das älteste, welches um 835 von einem ge-
wissen valerinus (wolfinus?), der sich magister Phaber (?)
betitelt, für Erzbischof Angilbert von Mailand angefertigt
wurde, umgibt den ganzen Hochaltartisch von S. Ambrogio.
Die Vorderseite zeigt in einer mandorlaartigcn Lmailrahme
die majesras Christi, um die sich zwanzig weitere reich
emailirte Nebenfelder gruppiren. Ein ähnliches Frontale,
ein Prachtwerk der Emailirkunft, bewahrt San Marco zu
Venedig. In Email cloisonn£ sehen wir in 27 Feldern
Ehristum, die vier Evangelisten und Scenen aus dem Leben
des heil. Markus dargestellt. 2f(00 perlen und Edelsteine
erhöhen den Glanz dieser Schöpfung des (0. Jahrhunderts.
77. Altar aus dem Anfang des
XIII. Jahrhunderts.
In der zerstörten Kirche S. Pietro zu Lape-
strano (Abruzzen). Nach Bindi, Monum.
stör, ed art. degli Abruzzi.
Neben den einfachen Sarkophag- oder Tischaltären be-
gegnen wir aber auch im ersten Jahrtausend schon Altären
mit einem Hochbau, den Tiboriumsaltären. Wir verstehen
darunter einen Altartisch, der von einem Dache überwölbt
78. Altar im alten Dom von Regensburg.
Aufnahme von €. F. weysser.
wird, das auf Säulen ruht. Dem Umstande, daß das Ge-
fäß für die Aufbewahrung der Eucharistie, des geweihten
Brodes, unter diesem Dache aufbewahrt wurde, verdankt
diese Altarart ihren Namen. Lange Zeit hindurch war die
Meinung vorherrschend, als hätten alle Altäre Tiborien-
bauten gehabt. Diese Annahme erwies sich jedoch als falsch,
denn sonst hätte Karl der Große nicht nöthig gehabt, ein
Gebot ergehen zu lassen, wonach über den Altären Dächer
angebracht werden sollten. Zunächst war wohl nur der
Hochaltar mit einem Tiborium überdacht. Später kommen
auch zwei oder mehrere Tiboriumsaltäre in einer Kirche
vor. Das Vorbild für diese Altarform haben wir in den
Arkosolien zu erblicken, wo das Tonnengewölbe das Dach,
die Seitenwände die Säulen vertreten. Die Säulen finden
wir wohl auch schon markirt, so im Toemeterium der heil.
Thrason und Saturninus (vergl. Abb. 75). Die ältesten
Tiboriumsaltäre, die sich in der ursprünglichen Form er-
halten haben, befinden sich in San Elemente und in San
Giorgio in Velabro zu Rom, doch gehören diese schon in
das zweite Jahrtausend. Das Dach bestand gewöhnlich aus
vergoldetem Holz, häufig auch die Säulen, die mit Gold-
oder Silberblech beschlagen wurden. Als Beispiel eines
79. Altar in der Allerheiligenkapelle zu Regensburg.
Aufnahme von C. F. weysser.
Tiboriumsaltars vor dem Jahre (000 kann das Trag-
altärchen des Kaisers Arnulf in der reichen Kapelle zu
München gelten, indem man es sich entsprechend vergrößert
und eine einfache mensa darinnen denkt (Abb. 76). Als