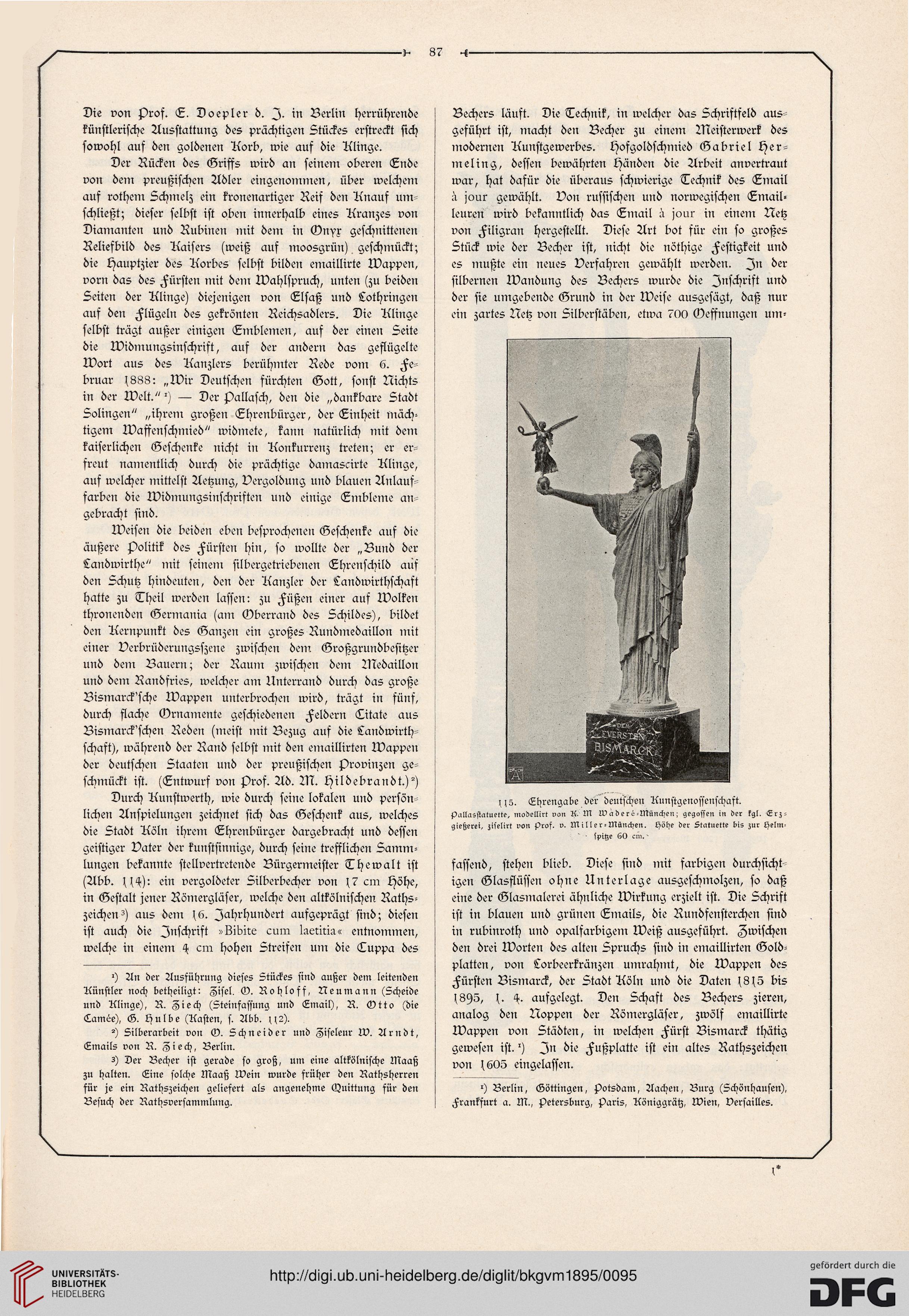Die von Prof. <£. Doepler d. J. in Berlin herrührende
künstlerische Ausstattung des prächtigen Stückes erstreckt sich
sowohl aus den goldenen Korb, wie aus die Klinge.
Der Rücken des Griffs wird an seinem oberen Ende
von dem preußischen Adler eingenommen, über welchem
aus rothem Schmelz ein kronenartiger Reif den Knauf um-
schließt; dieser selbst ist oben innerhalb eines Kranzes von
Diamanten und Rubinen mit dem in Onyx geschnittenen
Reliefbild des Kaisers (weiß auf moosgrün) geschmückt;
die hauptzier des Korbes selbst bilden eniaillirte Wappen,
vorn das des Fürsten mit dein Wahlspruch, unten (zu beiden
Seiten der Klinge) diejenigen von Elsaß und Lothringen
auf den Flügeln des gekrönten Reichsadlers. Die Klinge
selbst trägt außer einigen Emblemen, auf der einen Seite
die Widmungsinschrift, auf der andern das geflügelte
Wort aus des Kanzlers berühmter Rede vom 6. Fe-
bruar (888: „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst Nichts
in der Welt."') — Der Pallasch, den die „dankbare Stadt
Solingen" „ihrem großen Ehrenbürger, der Einheit mäch-
tigem Waffenschmied" widmete, kann natürlich mit dem
kaiserlichen Geschenke nicht in Konkurrenz treten; er er-
freut namentlich durch die prächtige damascirte Klinge,
auf welcher mittelst Aetzung, Vergoldung und blauen Anlauf-
farben die Widmungsinschriften und einige Embleme an-
gebracht sind.
Weisen die beiden eben besprochenen Geschenke auf die
äußere Politik des Fürsten hin, so wollte der „Bund der
Landwirthe" mit seinen! silbergetriebenen Ehrenschild aus
den Schutz hindeuten, den der Kanzler der Landwirthschaft
hatte zu Theil werden lassen: zu Füßen einer aus Wolken
thronenden Germania (am Oberrand des Schildes), bildet
den Kernpunkt des Ganzen ein großes Rundmedaillon init
einer Verbrüderungsszene zwischen dem Großgrundbesitzer
und dem Bauern; der Rauni zwischen dem Medaillon
und dem Randfries, welcher am Knterrand durch das große
Bismarck'schc Wappen unterbrochen wird, trägt in fünf,
durch flache Ornamente geschiedenen Feldern Eitate aus
Bismarck'schen Reden (meist init Bezug auf die Landwirth-
schaft), während der Rand selbst mit den emaillirten Wappen
der deutschen Staaten und der preußischen Provinzen ge-
schmückt ist. (Entwurf von prof. Ad. M. Hildebrandt.) fl
Durch Kunstwerth, wie durch seine lokalen und persön-
lichen Anspielungen zeichnet sich das Geschenk aus, welches
die Stadt Köln ihrem Ehrenbürger dargebracht und dessen
geistiger Vater der kunstsinnige, durch seine trefflichen Samm-
lungen bekannte stellvertretende Bürgermeister Thewalt ist
(Abb. f(4): ein vergoldeter Silberbecher von (7 cm höhe,
in Gestalt jener Römergläser, welche den altkölnischen Raths-
zeichen fl aus dem (6. Jahrhundert ausgeprägt sind; diesen
ist auch die Inschrift »Bibite cum laetitia« entnommen,
welche in einem 4 cm hohen Streifen um die Euppa des *)
*) An der Ausführung dieses Stückes sind außer dem leitenden
Künstler noch betheiligt: Zisel. <D. Rohlofs, Neumann (Scheide
und Klinge), R. Ziech (Steinfassung und Email), R. Mtto (die
LamLe), <8. ffulbe (Kasten, s. Abb. ;;2).
2) Silberarbeit von ©. Schneider und Ziseleur w. Arndt,
Emails von R. Ziech, Berlin.
3) Der Becher ist gerade so groß, um eine altkölnische !Naaß
zu halten. Line solche Maaß wein wurde früher den Rathsherren
für je ein Rathszeichen geliefert als angenehme ©uittung für den
Besuch der Rathsversammlung.
Bechers läuft. Die Technik, in welcher das Schriftfeld aus-
geführt ist, niacht den Becher zu einem Meisterwerk des
modernen Kunstgewerbes, Hofgoldschmied Gabriel Her-
meling, dessen bewährten fänden die Arbeit anvertraut
war, hat dafür die überaus schwierige Technik des Email
ä jour gewählt. Von russischen und norwegischen Email-
leuren wird bekanntlich das Einail ä jour in einem Netz
von Filigran hergestellt. Diese Art bot für ein so großes
Stück wie der Becher ist, nicht die nöthige Festigkeit und
es mußte ein neues Verfahren gewählt werden. 3n der
silbernen Wandung des Bechers wurde die Inschrift und
der sie umgebende Grund in der Weise ausgesägt, daß nur
ein zartes Netz von Silberstäben, etwa 700 Oeffnungen um-
j!5. Ehrengabe der deutschen Kunstgenossenschaft.
pullasstatuette, modellirt von R. M wädere-München; gegossen in der kgl. Lrz-
gießerei, ziselirt von ssrof. v. Miller-München. Höhe der Statuette bis zur Helm-
- spitze 60 cm. -
fassend, stehen blieb. Diese sind ,nit farbigen durchsicht
igen Glasflüssen ohne Unterlage ausgeschmolzen, so daß
eine der Glasmalerei ähnliche Wirkung erzielt ist. Die Schrift
ist in blauen und grünen Emails, die Rundfensterchen sind
in rubinroth und opalfarbigein Weiß ausgeführt. Zwischen
den drei Worten des alten Spruchs sind in emaillirten Gold-
platten, von Lorbeerkränzen umrahmt, die Wappen des
Fürsten Bismarck, der Stadt Köln und die Daten (8(5 bis
(895, (. 4. aufgelegt. Den Schaft des Bechers zieren,
analog den Noppen der Römergläser, zwölf emaillirte
Wappen von Städten, in welchen Fürst Bismarck thätig
gewesen ist. fl In die Fußplatte ist ein altes Rathszeichen
von (605 eingelassen.
fl Berlin, Göttingen, Potsdam, Aachen, Burg (Schönhausen),
Frankfurt a. M., Petersburg, Paris, Königgrätz, Wien, Versailles.
künstlerische Ausstattung des prächtigen Stückes erstreckt sich
sowohl aus den goldenen Korb, wie aus die Klinge.
Der Rücken des Griffs wird an seinem oberen Ende
von dem preußischen Adler eingenommen, über welchem
aus rothem Schmelz ein kronenartiger Reif den Knauf um-
schließt; dieser selbst ist oben innerhalb eines Kranzes von
Diamanten und Rubinen mit dem in Onyx geschnittenen
Reliefbild des Kaisers (weiß auf moosgrün) geschmückt;
die hauptzier des Korbes selbst bilden eniaillirte Wappen,
vorn das des Fürsten mit dein Wahlspruch, unten (zu beiden
Seiten der Klinge) diejenigen von Elsaß und Lothringen
auf den Flügeln des gekrönten Reichsadlers. Die Klinge
selbst trägt außer einigen Emblemen, auf der einen Seite
die Widmungsinschrift, auf der andern das geflügelte
Wort aus des Kanzlers berühmter Rede vom 6. Fe-
bruar (888: „Wir Deutschen fürchten Gott, sonst Nichts
in der Welt."') — Der Pallasch, den die „dankbare Stadt
Solingen" „ihrem großen Ehrenbürger, der Einheit mäch-
tigem Waffenschmied" widmete, kann natürlich mit dem
kaiserlichen Geschenke nicht in Konkurrenz treten; er er-
freut namentlich durch die prächtige damascirte Klinge,
auf welcher mittelst Aetzung, Vergoldung und blauen Anlauf-
farben die Widmungsinschriften und einige Embleme an-
gebracht sind.
Weisen die beiden eben besprochenen Geschenke auf die
äußere Politik des Fürsten hin, so wollte der „Bund der
Landwirthe" mit seinen! silbergetriebenen Ehrenschild aus
den Schutz hindeuten, den der Kanzler der Landwirthschaft
hatte zu Theil werden lassen: zu Füßen einer aus Wolken
thronenden Germania (am Oberrand des Schildes), bildet
den Kernpunkt des Ganzen ein großes Rundmedaillon init
einer Verbrüderungsszene zwischen dem Großgrundbesitzer
und dem Bauern; der Rauni zwischen dem Medaillon
und dem Randfries, welcher am Knterrand durch das große
Bismarck'schc Wappen unterbrochen wird, trägt in fünf,
durch flache Ornamente geschiedenen Feldern Eitate aus
Bismarck'schen Reden (meist init Bezug auf die Landwirth-
schaft), während der Rand selbst mit den emaillirten Wappen
der deutschen Staaten und der preußischen Provinzen ge-
schmückt ist. (Entwurf von prof. Ad. M. Hildebrandt.) fl
Durch Kunstwerth, wie durch seine lokalen und persön-
lichen Anspielungen zeichnet sich das Geschenk aus, welches
die Stadt Köln ihrem Ehrenbürger dargebracht und dessen
geistiger Vater der kunstsinnige, durch seine trefflichen Samm-
lungen bekannte stellvertretende Bürgermeister Thewalt ist
(Abb. f(4): ein vergoldeter Silberbecher von (7 cm höhe,
in Gestalt jener Römergläser, welche den altkölnischen Raths-
zeichen fl aus dem (6. Jahrhundert ausgeprägt sind; diesen
ist auch die Inschrift »Bibite cum laetitia« entnommen,
welche in einem 4 cm hohen Streifen um die Euppa des *)
*) An der Ausführung dieses Stückes sind außer dem leitenden
Künstler noch betheiligt: Zisel. <D. Rohlofs, Neumann (Scheide
und Klinge), R. Ziech (Steinfassung und Email), R. Mtto (die
LamLe), <8. ffulbe (Kasten, s. Abb. ;;2).
2) Silberarbeit von ©. Schneider und Ziseleur w. Arndt,
Emails von R. Ziech, Berlin.
3) Der Becher ist gerade so groß, um eine altkölnische !Naaß
zu halten. Line solche Maaß wein wurde früher den Rathsherren
für je ein Rathszeichen geliefert als angenehme ©uittung für den
Besuch der Rathsversammlung.
Bechers läuft. Die Technik, in welcher das Schriftfeld aus-
geführt ist, niacht den Becher zu einem Meisterwerk des
modernen Kunstgewerbes, Hofgoldschmied Gabriel Her-
meling, dessen bewährten fänden die Arbeit anvertraut
war, hat dafür die überaus schwierige Technik des Email
ä jour gewählt. Von russischen und norwegischen Email-
leuren wird bekanntlich das Einail ä jour in einem Netz
von Filigran hergestellt. Diese Art bot für ein so großes
Stück wie der Becher ist, nicht die nöthige Festigkeit und
es mußte ein neues Verfahren gewählt werden. 3n der
silbernen Wandung des Bechers wurde die Inschrift und
der sie umgebende Grund in der Weise ausgesägt, daß nur
ein zartes Netz von Silberstäben, etwa 700 Oeffnungen um-
j!5. Ehrengabe der deutschen Kunstgenossenschaft.
pullasstatuette, modellirt von R. M wädere-München; gegossen in der kgl. Lrz-
gießerei, ziselirt von ssrof. v. Miller-München. Höhe der Statuette bis zur Helm-
- spitze 60 cm. -
fassend, stehen blieb. Diese sind ,nit farbigen durchsicht
igen Glasflüssen ohne Unterlage ausgeschmolzen, so daß
eine der Glasmalerei ähnliche Wirkung erzielt ist. Die Schrift
ist in blauen und grünen Emails, die Rundfensterchen sind
in rubinroth und opalfarbigein Weiß ausgeführt. Zwischen
den drei Worten des alten Spruchs sind in emaillirten Gold-
platten, von Lorbeerkränzen umrahmt, die Wappen des
Fürsten Bismarck, der Stadt Köln und die Daten (8(5 bis
(895, (. 4. aufgelegt. Den Schaft des Bechers zieren,
analog den Noppen der Römergläser, zwölf emaillirte
Wappen von Städten, in welchen Fürst Bismarck thätig
gewesen ist. fl In die Fußplatte ist ein altes Rathszeichen
von (605 eingelassen.
fl Berlin, Göttingen, Potsdam, Aachen, Burg (Schönhausen),
Frankfurt a. M., Petersburg, Paris, Königgrätz, Wien, Versailles.