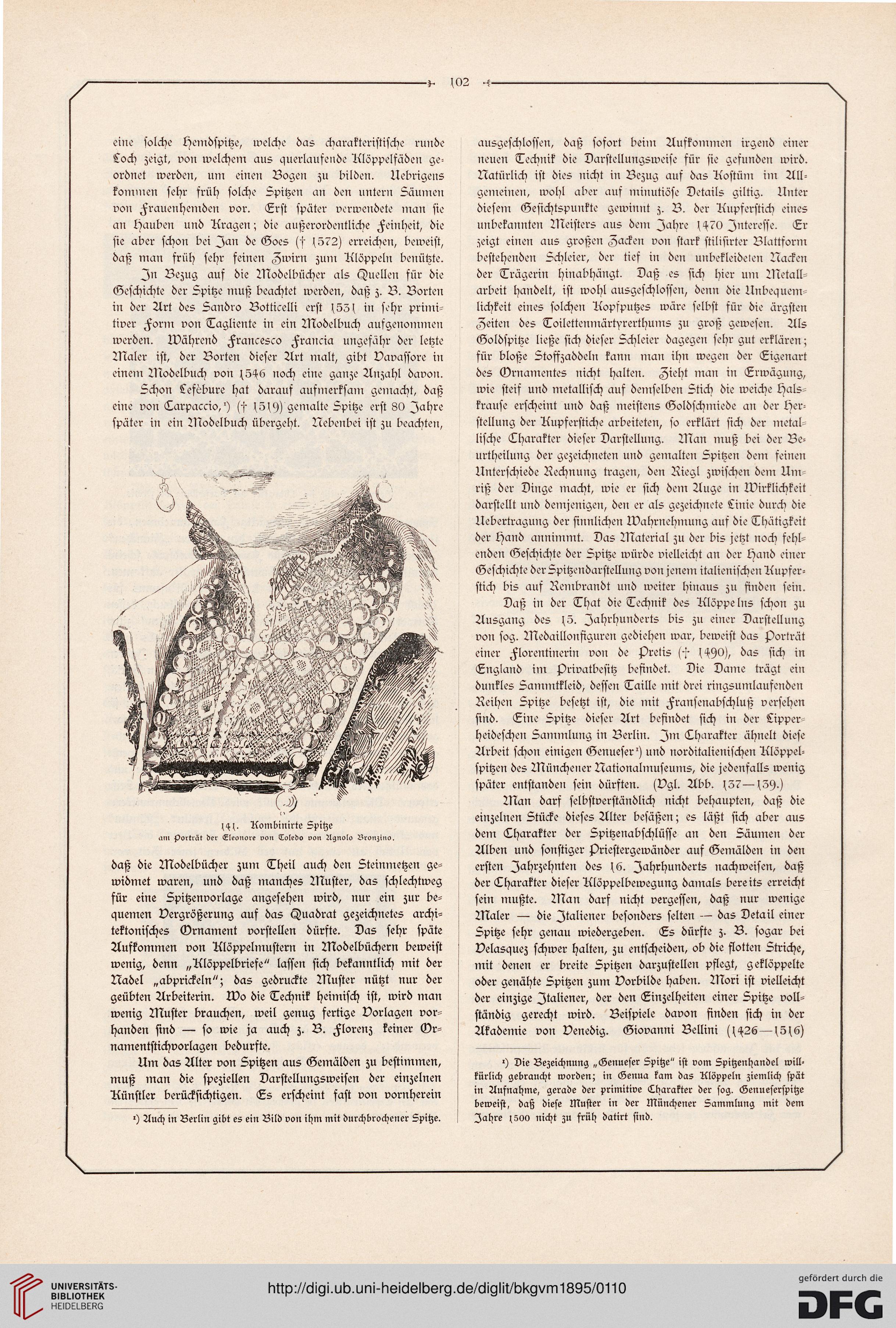eine solche hemdspitze, welche das charakteristische runde
Loch zeigt, von welchem aus querlaufende Alöppelfäden ge-
ordnet werden, um einen Bogen zu bilden. Uebrigens
kommen sehr früh solche Spitzen an den untern Säumen
von Frauenhemden vor. Erst später verwendete man sie
an Hauben und Aragen; die außerordentliche Feinheit, die
sie aber schon bei j^an de Goes ff {572) erreichen, beweist,
daß man früh sehr feinen Zwirn zum Alöppeln benützte.
In Bezug auf die Modelbücher als Quellen für die
Geschichte der Spitze muß beachtet werden, daß z. B. Borten
in der Art des Sandro Botticelli erst s53s in sehr primi-
tiver Form von Tagliente in ein Modelbuch ausgenommen
werden. Während Francesco Francia ungefähr der letzte
Maler ist, der Borten dieser Art uralt, gibt Vavassore in
einem Modelbuch von ^5^6 noch eine ganze Anzahl davon.
Schon Lefebure hat daraus aufmerksam geinacht, daß
eine von Carpaccio,') (f fäsß) gemalte Spitze erst 80 Jahre
später in ein Modelbuch übergeht. Nebenbei ist zu beachten,
Rombinirte Spitze
am Porträt der Eleonore von Toledo von Agnolo Bronzino.
daß die Modelbücher zum Theil auch den Steinmetzen ge-
widmet waren, und daß manches Muster, das schlechtweg
für eine Spitzenvorlage angesehen wird, nur ein zur be-
quemen Vergrößerung auf das Quadrat gezeichnetes archi-
tektonisches Ornament vorstellen dürfte. Das sehr späte
Aufkommen von Aloppelmustern in Modelbüchern beweist
wenig, denn „Alöppelbriefe" lassen sich bekanntlich mit der
Nadel „abprickeln"; das gedruckte Muster nützt nur der
geübten Arbeiterin. Wo die Technik heimisch ist, wird man
wenig Muster brauchen, weil genug fertige Vorlagen vor-
handen sind — so wie ja auch z. B. Florenz keiner Vr-
namentstichvorlagen bedurfte.
Um das Alter von Spitzen aus Gemälden zu bestimmen,
muß man die speziellen Darstellungsweisen der einzelnen
Aünstler berücksichtigen. Es erscheint fast von vornherein
') Auch in Berlin gibt es ein Bild von ihm mit durchbrochener Spitze.
ausgeschlossen, daß sofort beim Auskommen irgend einer-
neuen Technik die Darstellungsweise für sie gesunden wird.
Natürlich ist dies nicht in Bezug auf das Aostüm inr All-
gemeinen, wohl aber auf minutiöse Details giltig. Unter
diesem Gesichtspunkte gewinnt z. B. der Aupferstich eines
unbekannten Meisters aus dem Zahre Znteresfe. Er
zeigt einen aus großen Zacken von stark ftilisirter Blattform
bestehenden Schleier, der tief in den unbekleideien Nacken
der Trägerin hinabhängt. Daß es sich hier um Metall-
arbeit handelt, ist wohl ausgeschlossen, denn die Unbequem-
lichkeit eines solchen Aopfputzes wäre selbst für die ärgsten
Zeiten des Toilettenmärtyrerthums zu groß gewesen. Als
Goldspitze ließe sich dieser Schleier dagegen sehr gut erklären;
für bloße Stoffzaddeln kann man ihn wegen der Eigenart
des Ornamentes nicht halten. Zieht man in Erwägung,
wie steif und metallisch auf demselben Stich die weiche hals
krause erscheint und daß meistens Goldschmiede an der Her-
stellung der Aupserstiche arbeiteten, so erklärt sich der metal
lische Charakter dieser Darstellung. Man muß bei der Be-
urtheilung der gezeichneten und gemalten Spitzen dem feinen
Unterschiede Rechnung tragen, den Riegl zwischen dem Um-
riß der Dinge macht, wie er sich dem Auge in Wirklichkeit
darstellt und demjenigen, den er als gezeichnete Linie durch die
Uebertragung der sinnlichen Wahrnehmung aus die Thätigkeit
der Hand annimmt. Das Material zu der bis jetzt noch fehl-
enden Geschichte der Spitze würde vielleicht an der Hand einer
Geschichte der Spitzendarstellung von jenem italienischen Aupser-
stich bis auf Rembrandt und weiter hinaus zu finden sein.
Daß in der That die Technik des Alöppe Ins schon zu
Ausgang des sä. Jahrhunderts bis zu einer Darstellung
von sog. Medaillonfiguren gediehen war, beweist das Porträt
einer Florentinerin von de pretis das sich in
England inr privatbesitz befindet. Die Dame trägt ein
dunkles Sammtkleid, dessen Taille mit drei ringsumlaufenden
Reihen Spitze besetzt ist, die mit Fransenabschluß versehen
sind. Eine Spitze dieser Art befindet sich in der Lipper-
heideschen Sainmlung in Berlin. Jm Charakter ähnelt diese
Arbeit schon einigen Genueser ') und norditalienischen Alöppel-
spitzen des Münchener Nationalmuseunrs, die jedenfalls wenig
später entstanden sein dürsten. (Vgl. Abb. {57—sost.)
Man darf selbstverständlich nicht behaupten, daß die
einzelnen Stücke dieses Alter besäßen; es läßt sich aber aus
dem Charakter der Spitzenabschlüsse an den Säumen der
Alben und sonstiger Priestergewänder aus Gemälden in den
ersten Jahrzehnten des f6. Jahrhunderts Nachweisen, daß
der Charakter dieser Alöppelbewegung damals bereits erreicht
sein mußte. Man darf nicht vergessen, daß nur wenige
Maler — die Italiener besonders selten — das Detail einer
Spitze sehr genau wiedergeben. Es dürfte z. B. sogar bei
Velasquez schwer halten, zu entscheiden, ob die flotten Striche,
mit denen er breite Spitzen darzustellen pflegt, geklöppelte
oder genähte Spitzen zum Vorbilde haben. Mori ist vielleicht
der einzige Italiener, der den Einzelheiten einer Spitze voll-
ständig gerecht wird. Beispiele davon finden sich in der
Akademie von Venedig. Giovanni Bellini (^26— s5s6)
■) Die Bezeichnung „Genueser Spitze" ist vom Spitzenhandel will-
kürlich gebraucht worden; in Genua kam das Alöppeln ziemlich spät
in Aufnahme, gerade der primitive Charakter der sog. Genueserspitze
beweist, daß diese Muster in der Münchener Sammlung mit dem
Jahre ;soo nicht zu früh datirt sind.
Loch zeigt, von welchem aus querlaufende Alöppelfäden ge-
ordnet werden, um einen Bogen zu bilden. Uebrigens
kommen sehr früh solche Spitzen an den untern Säumen
von Frauenhemden vor. Erst später verwendete man sie
an Hauben und Aragen; die außerordentliche Feinheit, die
sie aber schon bei j^an de Goes ff {572) erreichen, beweist,
daß man früh sehr feinen Zwirn zum Alöppeln benützte.
In Bezug auf die Modelbücher als Quellen für die
Geschichte der Spitze muß beachtet werden, daß z. B. Borten
in der Art des Sandro Botticelli erst s53s in sehr primi-
tiver Form von Tagliente in ein Modelbuch ausgenommen
werden. Während Francesco Francia ungefähr der letzte
Maler ist, der Borten dieser Art uralt, gibt Vavassore in
einem Modelbuch von ^5^6 noch eine ganze Anzahl davon.
Schon Lefebure hat daraus aufmerksam geinacht, daß
eine von Carpaccio,') (f fäsß) gemalte Spitze erst 80 Jahre
später in ein Modelbuch übergeht. Nebenbei ist zu beachten,
Rombinirte Spitze
am Porträt der Eleonore von Toledo von Agnolo Bronzino.
daß die Modelbücher zum Theil auch den Steinmetzen ge-
widmet waren, und daß manches Muster, das schlechtweg
für eine Spitzenvorlage angesehen wird, nur ein zur be-
quemen Vergrößerung auf das Quadrat gezeichnetes archi-
tektonisches Ornament vorstellen dürfte. Das sehr späte
Aufkommen von Aloppelmustern in Modelbüchern beweist
wenig, denn „Alöppelbriefe" lassen sich bekanntlich mit der
Nadel „abprickeln"; das gedruckte Muster nützt nur der
geübten Arbeiterin. Wo die Technik heimisch ist, wird man
wenig Muster brauchen, weil genug fertige Vorlagen vor-
handen sind — so wie ja auch z. B. Florenz keiner Vr-
namentstichvorlagen bedurfte.
Um das Alter von Spitzen aus Gemälden zu bestimmen,
muß man die speziellen Darstellungsweisen der einzelnen
Aünstler berücksichtigen. Es erscheint fast von vornherein
') Auch in Berlin gibt es ein Bild von ihm mit durchbrochener Spitze.
ausgeschlossen, daß sofort beim Auskommen irgend einer-
neuen Technik die Darstellungsweise für sie gesunden wird.
Natürlich ist dies nicht in Bezug auf das Aostüm inr All-
gemeinen, wohl aber auf minutiöse Details giltig. Unter
diesem Gesichtspunkte gewinnt z. B. der Aupferstich eines
unbekannten Meisters aus dem Zahre Znteresfe. Er
zeigt einen aus großen Zacken von stark ftilisirter Blattform
bestehenden Schleier, der tief in den unbekleideien Nacken
der Trägerin hinabhängt. Daß es sich hier um Metall-
arbeit handelt, ist wohl ausgeschlossen, denn die Unbequem-
lichkeit eines solchen Aopfputzes wäre selbst für die ärgsten
Zeiten des Toilettenmärtyrerthums zu groß gewesen. Als
Goldspitze ließe sich dieser Schleier dagegen sehr gut erklären;
für bloße Stoffzaddeln kann man ihn wegen der Eigenart
des Ornamentes nicht halten. Zieht man in Erwägung,
wie steif und metallisch auf demselben Stich die weiche hals
krause erscheint und daß meistens Goldschmiede an der Her-
stellung der Aupserstiche arbeiteten, so erklärt sich der metal
lische Charakter dieser Darstellung. Man muß bei der Be-
urtheilung der gezeichneten und gemalten Spitzen dem feinen
Unterschiede Rechnung tragen, den Riegl zwischen dem Um-
riß der Dinge macht, wie er sich dem Auge in Wirklichkeit
darstellt und demjenigen, den er als gezeichnete Linie durch die
Uebertragung der sinnlichen Wahrnehmung aus die Thätigkeit
der Hand annimmt. Das Material zu der bis jetzt noch fehl-
enden Geschichte der Spitze würde vielleicht an der Hand einer
Geschichte der Spitzendarstellung von jenem italienischen Aupser-
stich bis auf Rembrandt und weiter hinaus zu finden sein.
Daß in der That die Technik des Alöppe Ins schon zu
Ausgang des sä. Jahrhunderts bis zu einer Darstellung
von sog. Medaillonfiguren gediehen war, beweist das Porträt
einer Florentinerin von de pretis das sich in
England inr privatbesitz befindet. Die Dame trägt ein
dunkles Sammtkleid, dessen Taille mit drei ringsumlaufenden
Reihen Spitze besetzt ist, die mit Fransenabschluß versehen
sind. Eine Spitze dieser Art befindet sich in der Lipper-
heideschen Sainmlung in Berlin. Jm Charakter ähnelt diese
Arbeit schon einigen Genueser ') und norditalienischen Alöppel-
spitzen des Münchener Nationalmuseunrs, die jedenfalls wenig
später entstanden sein dürsten. (Vgl. Abb. {57—sost.)
Man darf selbstverständlich nicht behaupten, daß die
einzelnen Stücke dieses Alter besäßen; es läßt sich aber aus
dem Charakter der Spitzenabschlüsse an den Säumen der
Alben und sonstiger Priestergewänder aus Gemälden in den
ersten Jahrzehnten des f6. Jahrhunderts Nachweisen, daß
der Charakter dieser Alöppelbewegung damals bereits erreicht
sein mußte. Man darf nicht vergessen, daß nur wenige
Maler — die Italiener besonders selten — das Detail einer
Spitze sehr genau wiedergeben. Es dürfte z. B. sogar bei
Velasquez schwer halten, zu entscheiden, ob die flotten Striche,
mit denen er breite Spitzen darzustellen pflegt, geklöppelte
oder genähte Spitzen zum Vorbilde haben. Mori ist vielleicht
der einzige Italiener, der den Einzelheiten einer Spitze voll-
ständig gerecht wird. Beispiele davon finden sich in der
Akademie von Venedig. Giovanni Bellini (^26— s5s6)
■) Die Bezeichnung „Genueser Spitze" ist vom Spitzenhandel will-
kürlich gebraucht worden; in Genua kam das Alöppeln ziemlich spät
in Aufnahme, gerade der primitive Charakter der sog. Genueserspitze
beweist, daß diese Muster in der Münchener Sammlung mit dem
Jahre ;soo nicht zu früh datirt sind.