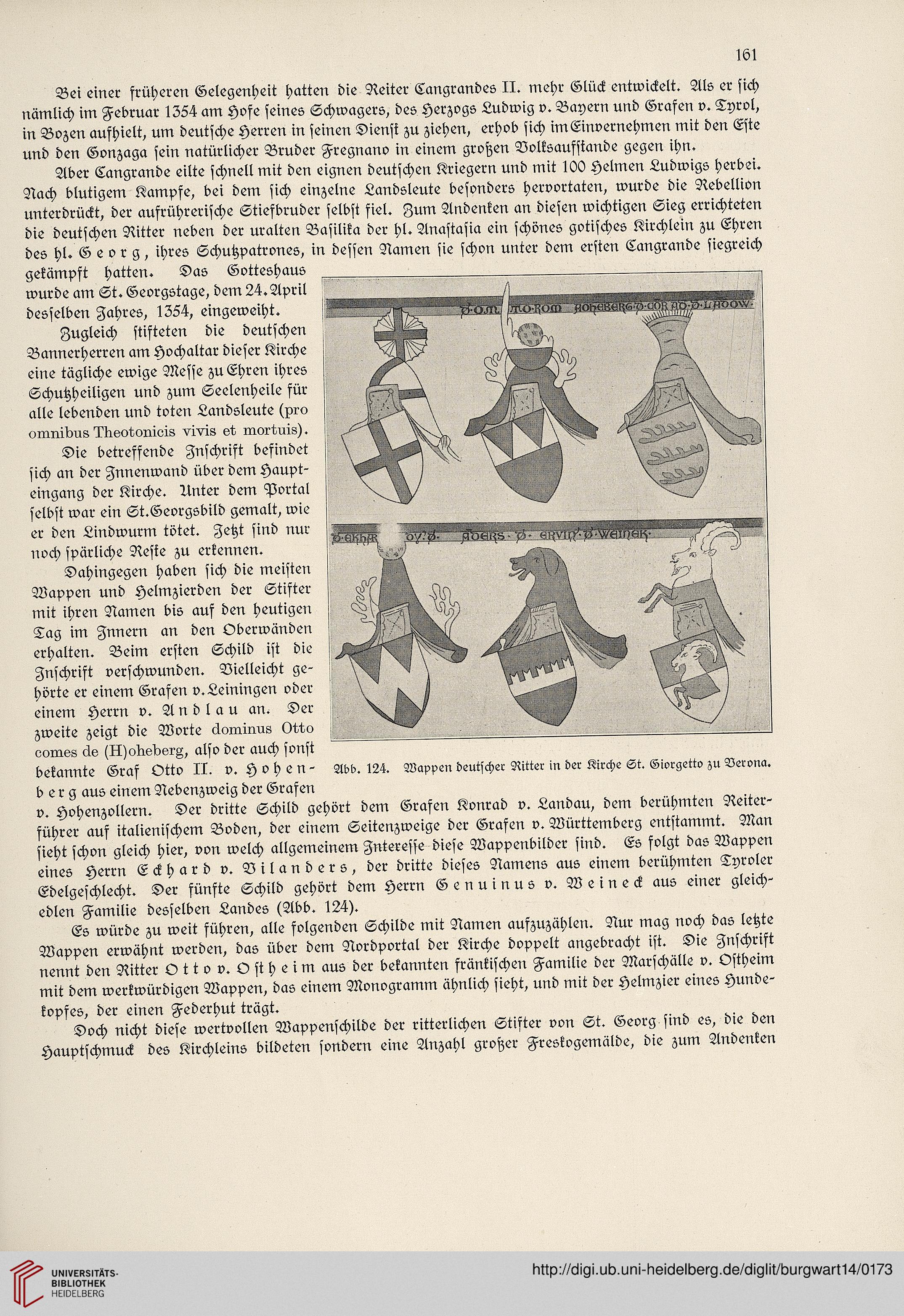1S1
Bei einer srüheren Gelegenheit hatten die Neiter Cangrandes II. mehr Glück entwickelt. Als er sich
nämlich im Februar 1354 am Hofe seines Schwagers, des Herzogs Ludwig v. Bayern und Grafen v. Tyrol,
in Bozen aushielt, um deutsche Herren in seinen Diensi zu ziehen, erhob sich imEinvernehmen mit den Este
und den Gonzaga sein natürlicher Bruder Fregnano in einem grohen Volksaussiande gegen ihn.
Aber Cangrande eilte schnell mit den eignen deutschen Kriegern und mit 1OO Helmen Ludwigs herbei.
Nach blutigem Kampse, bei dem sich einzelne Landsleute besonders hervortaten, wurde die Rebellion
unterdrückt, der ausrührerische Stiesbruder selbst siel. Zum Andenken an diesen wichtigen Sieg errichteten
die deutschen Ritter neben der uralten Basilika der hl. Anastasia ein schönes gotisches Kirchlein zu Ehren
des hl. G e o r g, ihres Schutzpatrones, in dessen Nanren sie schon unter dem ersten Cangrande siegreich
gekämpst hatten. Das Gotteshaus
wurde am St. Georgstage, dem 24.April
desselben Aahres, 1354, eingeweiht.
Zugleich stisteten die deutschen
Bannerherren am Hochaltar dieser Kirche
eine tägliche ewige Messe zu Ehren ihres
Schutzheiligen und zum Seelenheile sür
alle lebenden und toten Landsleute (pro
omnidus 4?Ü60toui6i8 vivi8 ot mortni^).
Die betrefsende Anschrift besindet
sich an der Annenwand über dem Haupt-
eingang der Kirche. Rnter dem Portal
selbst war ein St.Georgsbild gemalt, wie
er den Lindwurm tötet. Aetzt sind nur
noch spärliche Reste zu erkennen.
Dahingegen haben sich die meisten
Wappen und Helmzierden der Stister
mit ihren Namen bis auf den heutigen
Tag im Annern an den Oberwänden
erhalten. Beim ersten Schild ist die
Anschrift verschwunden. Vielleicht ge-
hörte er einem Grasen v.Leiningen oder
einem Herrn v. Andlau an. Der
zweite zeigt die Worte clominu^ Otcko
00M68 Ü6 (H)oÜ6l>6rA, also der auch sonst
bekannte Gras Otto II. v. Hohen-
berg aus einem Nebenzweig der Grasen
v. Hohenzollern. Der dritte Schild gehört dem Grasen Konrad v. Landau, dem berühmten Reiter-
sührer aus italienischem Boden, der einem Seitenzweige der Grafen v. Württemberg entstammt. Man
sieht schon gleich hier, von welch allgemeinem Anteresse diese Wappenbilder sind. Es solgt das Wappen
eines Herrn Eckhard v. Vilanders, der dritte dieses Namens aus einem berühmten Tyroler
Edelgeschlecht. Der fünste Schild gehört dem Herrn Genuinus v. Weineck aus einer gleich-
edlen Familie desselben Landes (Abb. 124).
Cs würde zu weit führen, alle solgenden Schilde mit Namen auszuzählen. Nur mag noch das letzte
Wappen erwähnt werden, das über dem Nordportal der Kirche doppelt angebracht ist. Die Anschrist
nennt den Ritter Ottov. Ostheim aus der bekannten fränkischen Familie der Marschälle v. Ostheim
mit dem werkwürdigen Wappen, das einem Monogramm ähnlich sieht, und mit der Helmzier eines Hunde-
kopses, der einen Federhut trägt.
Doch nicht diese wertvollen Wappenschilde der ritterlichen Stister von St. Georg sind es, die den
Hauptschmuck des Kirchleins bildeten sondern eine Anzahl groher Freskogemälde, die zum Andenken
Bei einer srüheren Gelegenheit hatten die Neiter Cangrandes II. mehr Glück entwickelt. Als er sich
nämlich im Februar 1354 am Hofe seines Schwagers, des Herzogs Ludwig v. Bayern und Grafen v. Tyrol,
in Bozen aushielt, um deutsche Herren in seinen Diensi zu ziehen, erhob sich imEinvernehmen mit den Este
und den Gonzaga sein natürlicher Bruder Fregnano in einem grohen Volksaussiande gegen ihn.
Aber Cangrande eilte schnell mit den eignen deutschen Kriegern und mit 1OO Helmen Ludwigs herbei.
Nach blutigem Kampse, bei dem sich einzelne Landsleute besonders hervortaten, wurde die Rebellion
unterdrückt, der ausrührerische Stiesbruder selbst siel. Zum Andenken an diesen wichtigen Sieg errichteten
die deutschen Ritter neben der uralten Basilika der hl. Anastasia ein schönes gotisches Kirchlein zu Ehren
des hl. G e o r g, ihres Schutzpatrones, in dessen Nanren sie schon unter dem ersten Cangrande siegreich
gekämpst hatten. Das Gotteshaus
wurde am St. Georgstage, dem 24.April
desselben Aahres, 1354, eingeweiht.
Zugleich stisteten die deutschen
Bannerherren am Hochaltar dieser Kirche
eine tägliche ewige Messe zu Ehren ihres
Schutzheiligen und zum Seelenheile sür
alle lebenden und toten Landsleute (pro
omnidus 4?Ü60toui6i8 vivi8 ot mortni^).
Die betrefsende Anschrift besindet
sich an der Annenwand über dem Haupt-
eingang der Kirche. Rnter dem Portal
selbst war ein St.Georgsbild gemalt, wie
er den Lindwurm tötet. Aetzt sind nur
noch spärliche Reste zu erkennen.
Dahingegen haben sich die meisten
Wappen und Helmzierden der Stister
mit ihren Namen bis auf den heutigen
Tag im Annern an den Oberwänden
erhalten. Beim ersten Schild ist die
Anschrift verschwunden. Vielleicht ge-
hörte er einem Grasen v.Leiningen oder
einem Herrn v. Andlau an. Der
zweite zeigt die Worte clominu^ Otcko
00M68 Ü6 (H)oÜ6l>6rA, also der auch sonst
bekannte Gras Otto II. v. Hohen-
berg aus einem Nebenzweig der Grasen
v. Hohenzollern. Der dritte Schild gehört dem Grasen Konrad v. Landau, dem berühmten Reiter-
sührer aus italienischem Boden, der einem Seitenzweige der Grafen v. Württemberg entstammt. Man
sieht schon gleich hier, von welch allgemeinem Anteresse diese Wappenbilder sind. Es solgt das Wappen
eines Herrn Eckhard v. Vilanders, der dritte dieses Namens aus einem berühmten Tyroler
Edelgeschlecht. Der fünste Schild gehört dem Herrn Genuinus v. Weineck aus einer gleich-
edlen Familie desselben Landes (Abb. 124).
Cs würde zu weit führen, alle solgenden Schilde mit Namen auszuzählen. Nur mag noch das letzte
Wappen erwähnt werden, das über dem Nordportal der Kirche doppelt angebracht ist. Die Anschrist
nennt den Ritter Ottov. Ostheim aus der bekannten fränkischen Familie der Marschälle v. Ostheim
mit dem werkwürdigen Wappen, das einem Monogramm ähnlich sieht, und mit der Helmzier eines Hunde-
kopses, der einen Federhut trägt.
Doch nicht diese wertvollen Wappenschilde der ritterlichen Stister von St. Georg sind es, die den
Hauptschmuck des Kirchleins bildeten sondern eine Anzahl groher Freskogemälde, die zum Andenken