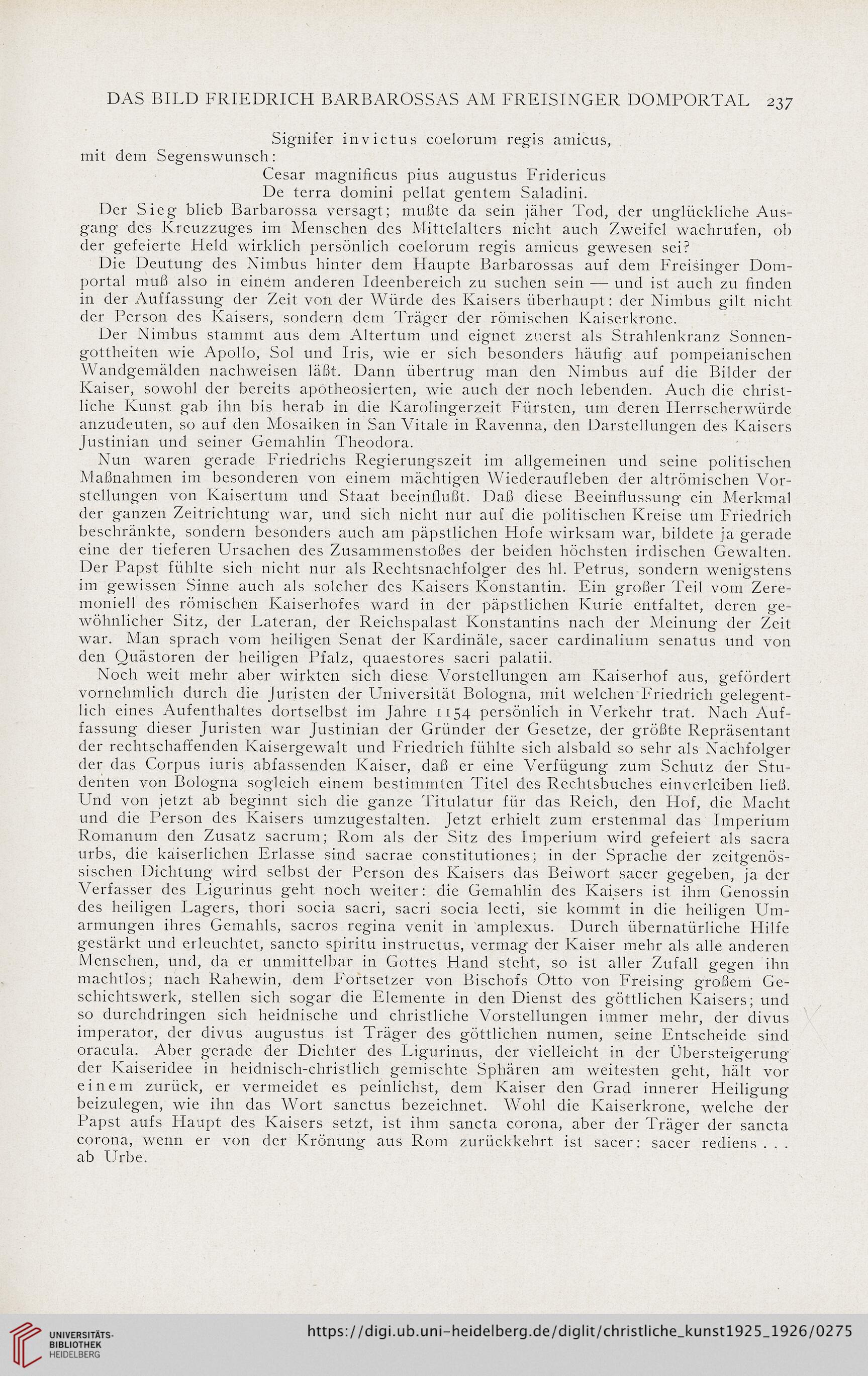DAS BILD FRIEDRICH BARBAROSSAS AM FREISINGER DOMPORTAL 237
Signifer invictus coelorum regis amicus,
mit dem Segenswunsch:
Cesar magnificus pius augustus Fridericus
De terra domini pellat gentem Saladini.
Der Sieg blieb Barbarossa versagt; mußte da sein jäher Tod, der unglückliche Aus-
gang des Kreuzzuges im Menschen des Mittelalters nicht auch Zweifel wachrufen, ob
der gefeierte Held wirklich persönlich coelorum regis amicus gewesen sei?
Die Deutung des Nimbus hinter dem Haupte Barbarossas auf dem Freisinger Dom-
portal muß also in einem anderen Ideenbereich zu suchen sein — und ist auch zu finden
in der Auffassung der Zeit von der Würde des Kaisers überhaupt: der Nimbus gilt nicht
der Person des Kaisers, sondern dem Träger der römischen Kaiserkrone.
Der Nimbus stammt aus dem Altertum und eignet zuerst als Strahlenkranz Sonnen-
gottheiten wie Apollo, Sol und Iris, wie er sich besonders häufig auf pompeianischen
Wandgemälden nachweisen läßt. Dann übertrug man den Nimbus auf die Bilder der
Kaiser, sowohl der bereits apotheosierten, wie auch der noch lebenden. Auch die christ-
liche Kunst gab ihn bis herab in die Karolingerzeit Fürsten, um deren Herrscherwürde
anzudeuten, so auf den Mosaiken in San Vitale in Ravenna, den Darstellungen des Kaisers
Justinian und seiner Gemahlin Theodora.
Nun waren gerade Friedrichs Regierungszeit im allgemeinen und seine politischen
Maßnahmen im besonderen von einem mächtigen Wiederaufleben der altrömischen Vor-
stellungen von Kaisertum und Staat beeinflußt. Daß diese Beeinflussung ein Merkmal
der ganzen Zeitrichtung war, und sich nicht nur auf die politischen Kreise um Friedrich
beschränkte, sondern besonders auch am päpstlichen Hofe wirksam war, bildete ja gerade
eine der tieferen Ursachen des Zusammenstoßes der beiden höchsten irdischen Gewalten.
Der Papst fühlte sich nicht nur als Rechtsnachfolger des hl. Petrus, sondern wenigstens
im gewissen Sinne auch als solcher des Kaisers Konstantin. Ein großer Teil vom Zere-
moniell des römischen Kaiserhofes ward in der päpstlichen Kurie entfaltet, deren ge-
wöhnlicher Sitz, der Lateran, der Reichspalast Konstantins nach der Meinung der Zeit
war. Man sprach vom heiligen Senat der Kardinäle, sacer cardinalium senatus und von
den Quästoren der heiligen Pfalz, quaestores sacri palatii.
Noch weit mehr aber wirkten sich diese Vorstellungen am Kaiserhof aus, gefördert
vornehmlich durch die Juristen der Universität Bologna, mit welchen Friedrich gelegent-
lich eines Aufenthaltes dortselbst im Jahre 1154 persönlich in Verkehr trat. Nach Auf-
fassung dieser Juristen war Justinian der Gründer der Gesetze, der größte Repräsentant
der rechtschaffenden Kaisergewalt und Friedrich fühlte sich alsbald so sehr als Nachfolger
der das Corpus iuris abfassenden Kaiser, daß er eine Verfügung zum Schutz der Stu-
denten von Bologna sogleich einem bestimmten Titel des Rechtsbuches einverleiben ließ.
Und von jetzt ab beginnt sich die ganze Titulatur für das Reich, den Hof, die Macht
und die Person des Kaisers umzugestalten. Jetzt erhielt zum erstenmal das Imperium
Romanum den Zusatz sacrum; Rom als der Sitz des Imperium wird gefeiert als sacra
urbs, die kaiserlichen Erlasse sind sacrae constitutiones; in der Sprache der zeitgenös-
sischen Dichtung wird selbst der Person des Kaisers das Beiwort sacer gegeben, ja der
Verfasser des Ligurinus geht noch weiter: die Gemahlin des Kaisers ist ihm Genossin
des heiligen Lagers, thori socia sacri, sacri socia lecti, sie kommt in die heiligen Um-
armungen ihres Gemahls, sacros regina venit in amplexus. Durch übernatürliche Hilfe
gestärkt und erleuchtet, sancto spiritu instructus, vermag der Kaiser mehr als alle anderen
Menschen, und, da er unmittelbar in Gottes Hand steht, so ist aller Zufall gegen ihn
machtlos; nach Rahewin, dem Fortsetzer von Bischofs Otto von Freising großem Ge-
schichtswerk, stellen sich sogar die Elemente in den Dienst des göttlichen Kaisers; und
so durchdringen sich heidnische und christliche Vorstellungen immer mehr, der divus
imperator, der divus augustus ist Träger des göttlichen numen, seine Entscheide sind
oracula. Aber gerade der Dichter des Ligurinus, der vielleicht in der Übersteigerung
der Kaiseridee in heidnisch-christlich gemischte Sphären am weitesten geht, hält vor
einem zurück, er vermeidet es peinlichst, dem Kaiser den Grad innerer Heiligung
beizulegen, wie ihn das Wort sanctus bezeichnet. Wohl die Kaiserkrone, welche der
Papst aufs Haupt des Kaisers setzt, ist ihm sancta corona, aber der Träger der sancta
corona, wenn er von der Krönung aus Rom zurückkehrt ist sacer: sacer rediens . . .
ab Urbe.
Signifer invictus coelorum regis amicus,
mit dem Segenswunsch:
Cesar magnificus pius augustus Fridericus
De terra domini pellat gentem Saladini.
Der Sieg blieb Barbarossa versagt; mußte da sein jäher Tod, der unglückliche Aus-
gang des Kreuzzuges im Menschen des Mittelalters nicht auch Zweifel wachrufen, ob
der gefeierte Held wirklich persönlich coelorum regis amicus gewesen sei?
Die Deutung des Nimbus hinter dem Haupte Barbarossas auf dem Freisinger Dom-
portal muß also in einem anderen Ideenbereich zu suchen sein — und ist auch zu finden
in der Auffassung der Zeit von der Würde des Kaisers überhaupt: der Nimbus gilt nicht
der Person des Kaisers, sondern dem Träger der römischen Kaiserkrone.
Der Nimbus stammt aus dem Altertum und eignet zuerst als Strahlenkranz Sonnen-
gottheiten wie Apollo, Sol und Iris, wie er sich besonders häufig auf pompeianischen
Wandgemälden nachweisen läßt. Dann übertrug man den Nimbus auf die Bilder der
Kaiser, sowohl der bereits apotheosierten, wie auch der noch lebenden. Auch die christ-
liche Kunst gab ihn bis herab in die Karolingerzeit Fürsten, um deren Herrscherwürde
anzudeuten, so auf den Mosaiken in San Vitale in Ravenna, den Darstellungen des Kaisers
Justinian und seiner Gemahlin Theodora.
Nun waren gerade Friedrichs Regierungszeit im allgemeinen und seine politischen
Maßnahmen im besonderen von einem mächtigen Wiederaufleben der altrömischen Vor-
stellungen von Kaisertum und Staat beeinflußt. Daß diese Beeinflussung ein Merkmal
der ganzen Zeitrichtung war, und sich nicht nur auf die politischen Kreise um Friedrich
beschränkte, sondern besonders auch am päpstlichen Hofe wirksam war, bildete ja gerade
eine der tieferen Ursachen des Zusammenstoßes der beiden höchsten irdischen Gewalten.
Der Papst fühlte sich nicht nur als Rechtsnachfolger des hl. Petrus, sondern wenigstens
im gewissen Sinne auch als solcher des Kaisers Konstantin. Ein großer Teil vom Zere-
moniell des römischen Kaiserhofes ward in der päpstlichen Kurie entfaltet, deren ge-
wöhnlicher Sitz, der Lateran, der Reichspalast Konstantins nach der Meinung der Zeit
war. Man sprach vom heiligen Senat der Kardinäle, sacer cardinalium senatus und von
den Quästoren der heiligen Pfalz, quaestores sacri palatii.
Noch weit mehr aber wirkten sich diese Vorstellungen am Kaiserhof aus, gefördert
vornehmlich durch die Juristen der Universität Bologna, mit welchen Friedrich gelegent-
lich eines Aufenthaltes dortselbst im Jahre 1154 persönlich in Verkehr trat. Nach Auf-
fassung dieser Juristen war Justinian der Gründer der Gesetze, der größte Repräsentant
der rechtschaffenden Kaisergewalt und Friedrich fühlte sich alsbald so sehr als Nachfolger
der das Corpus iuris abfassenden Kaiser, daß er eine Verfügung zum Schutz der Stu-
denten von Bologna sogleich einem bestimmten Titel des Rechtsbuches einverleiben ließ.
Und von jetzt ab beginnt sich die ganze Titulatur für das Reich, den Hof, die Macht
und die Person des Kaisers umzugestalten. Jetzt erhielt zum erstenmal das Imperium
Romanum den Zusatz sacrum; Rom als der Sitz des Imperium wird gefeiert als sacra
urbs, die kaiserlichen Erlasse sind sacrae constitutiones; in der Sprache der zeitgenös-
sischen Dichtung wird selbst der Person des Kaisers das Beiwort sacer gegeben, ja der
Verfasser des Ligurinus geht noch weiter: die Gemahlin des Kaisers ist ihm Genossin
des heiligen Lagers, thori socia sacri, sacri socia lecti, sie kommt in die heiligen Um-
armungen ihres Gemahls, sacros regina venit in amplexus. Durch übernatürliche Hilfe
gestärkt und erleuchtet, sancto spiritu instructus, vermag der Kaiser mehr als alle anderen
Menschen, und, da er unmittelbar in Gottes Hand steht, so ist aller Zufall gegen ihn
machtlos; nach Rahewin, dem Fortsetzer von Bischofs Otto von Freising großem Ge-
schichtswerk, stellen sich sogar die Elemente in den Dienst des göttlichen Kaisers; und
so durchdringen sich heidnische und christliche Vorstellungen immer mehr, der divus
imperator, der divus augustus ist Träger des göttlichen numen, seine Entscheide sind
oracula. Aber gerade der Dichter des Ligurinus, der vielleicht in der Übersteigerung
der Kaiseridee in heidnisch-christlich gemischte Sphären am weitesten geht, hält vor
einem zurück, er vermeidet es peinlichst, dem Kaiser den Grad innerer Heiligung
beizulegen, wie ihn das Wort sanctus bezeichnet. Wohl die Kaiserkrone, welche der
Papst aufs Haupt des Kaisers setzt, ist ihm sancta corona, aber der Träger der sancta
corona, wenn er von der Krönung aus Rom zurückkehrt ist sacer: sacer rediens . . .
ab Urbe.