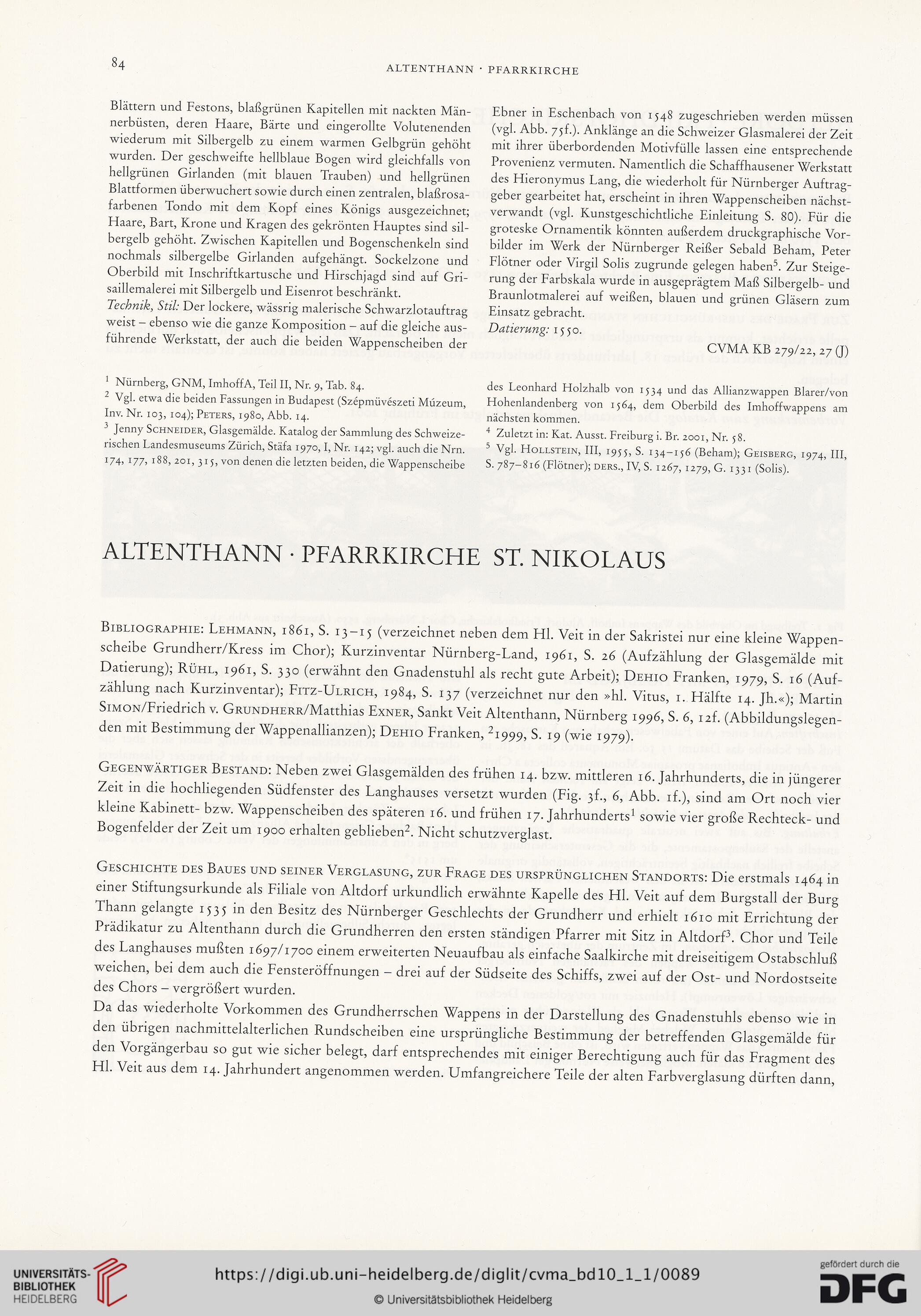84
ALTENTHANN • PFARRKIRCHE
Blättern und Festons, blaßgrünen Kapitellen mit nackten Män-
nerbüsten, deren Haare, Bärte und eingerollte Volutenenden
wiederum mit Silbergelb zu einem warmen Gelbgrün gehöht
wurden. Der geschweifte hellblaue Bogen wird gleichfalls von
hellgrünen Girlanden (mit blauen Trauben) und hellgrünen
Blattformen überwuchert sowie durch einen zentralen, blaßrosa-
farbenen Tondo mit dem Kopf eines Königs ausgezeichnet;
Haare, Bart, Krone und Kragen des gekrönten Hauptes sind sil-
bergelb gehöht. Zwischen Kapitellen und Bogenschenkeln sind
nochmals silbergelbe Girlanden aufgehängt. Sockelzone und
Oberbild mit Inschriftkartusche und Hirschjagd sind auf Gri-
saillemalerei mit Silbergelb und Eisenrot beschränkt.
Technik, Stil: Der lockere, wässrig malerische Schwarzlotauftrag
weist - ebenso wie die ganze Komposition - auf die gleiche aus-
führende Werkstatt, der auch die beiden Wappenscheiben der
1 Nürnberg, GNM, ImhoffA, Teil II, Nr. 9, Tab. 84.
2 Vgl. etwa die beiden Fassungen in Budapest (Szepmüveszeti Muzeum,
Inv. Nr. 103, 104); Peters, 1980, Abb. 14.
3 Jenny Schneider, Glasgemälde. Katalog der Sammlung des Schweize-
rischen Landesmuseums Zürich, Stäfa 1970,1, Nr. 142; vgl. auch die Nrn.
174, 177, 188, 201, 315, von denen die letzten beiden, die Wappenscheibe
Ebner in Eschenbach von 1548 zugeschrieben werden müssen
(vgl. Abb. 7yf.). Anklänge an die Schweizer Glasmalerei der Zeit
mit ihrer überbordenden Motivfülle lassen eine entsprechende
Provenienz vermuten. Namentlich die Schaffhausener Werkstatt
des Hieronymus Lang, die wiederholt für Nürnberger Auftrag-
geber gearbeitet hat, erscheint in ihren Wappenscheiben nächst-
verwandt (vgl. Kunstgeschichtliche Einleitung S. 80). Für die
groteske Ornamentik könnten außerdem druckgraphische Vor-
bilder im Werk der Nürnberger Reißer Sebald Beham, Peter
Flötner oder Virgil Solis zugrunde gelegen haben5. Zur Steige-
rung der Farbskala wurde in ausgeprägtem Maß Silbergelb- und
Braunlotmalerei auf weißen, blauen und grünen Gläsern zum
Einsatz gebracht.
Datierung: 1550.
CVMA KB 279/22, 27 (J)
des Leonhard Holzhalb von 1534 und das Allianzwappen Blarer/von
Hohenlandenberg von 1564, dem Oberbild des Imhoffwappens am
nächsten kommen.
4 Zuletzt in: Kat. Ausst. Freiburg i. Br. 2001, Nr. 58.
5 Vgl. Hollstein, III, 1955, S. 134-156 (Beham); Geisberg, 1974, III,
S. 787-816 (Flötner); ders., IV, S. 1267, 1279, G. 1331 (Solis).
ALTENTHANN • PFARRKIRCHE ST. NIKOLAUS
Bibliographie: Lehmann, 1861, S. 13-15 (verzeichnet neben dem Hl. Veit in der Sakristei nur eine kleine Wappen-
scheibe Grundherr/Kress im Chor); Kurzinventar Nürnberg-Land, 1961, S. 26 (Aufzählung der Glasgemälde mit
Datierung); Rühl, 1961, S. 330 (erwähnt den Gnadenstuhl als recht gute Arbeit); Dehio Franken, 1979, S. 16 (Auf-
zählung nach Kurzinventar); Fitz-Ulrich, 1984, S. 137 (verzeichnet nur den »hl. Vitus, 1. Hälfte 14. Jh.«); Martin
SiMON/Friedrich v. GRUNDHERR/Matthias Exner, Sankt Veit Altenthann, Nürnberg 1996, S. 6, 12E (Abbildungslegen-
den mit Bestimmung der Wappenallianzen); Dehio Franken, 2i999, S. 19 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Neben zwei Glasgemälden des frühen 14. bzw. mittleren 16. Jahrhunderts, die in jüngerer
Zeit in die hochliegenden Südfenster des Langhauses versetzt wurden (Fig. 3E, 6, Abb. if.), sind am Ort noch vier
kleine Kabinett- bzw. Wappenscheiben des späteren 16. und frühen 17. Jahrhunderts1 sowie vier große Rechteck- und
Bogenfelder der Zeit um 1900 erhalten geblieben2. Nicht schutzverglast.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung, zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die erstmals 1464 in
einer Stiftungsurkunde als Filiale von Altdorf urkundlich erwähnte Kapelle des Hl. Veit auf dem Burgstall der Burg
Thann gelangte 1535 in den Besitz des Nürnberger Geschlechts der Grundherr und erhielt 1610 mit Errichtung der
Prädikatur zu Altenthann durch die Grundherren den ersten ständigen Pfarrer mit Sitz in Altdorf3. Chor und Teile
des Langhauses mußten 1697/1700 einem erweiterten Neuaufbau als einfache Saalkirche mit dreiseitigem Ostabschluß
weichen, bei dem auch die Fensteröffnungen - drei auf der Südseite des Schiffs, zwei auf der Ost- und Nordostseite
des Chors - vergrößert wurden.
Da das wiederholte Vorkommen des Grundherrschen Wappens in der Darstellung des Gnadenstuhls ebenso wie in
den übrigen nachmittelalterlichen Rundscheiben eine ursprüngliche Bestimmung der betreffenden Glasgemälde für
den Vorgängerbau so gut wie sicher belegt, darf entsprechendes mit einiger Berechtigung auch für das Fragment des
Hl. Veit aus dem 14. Jahrhundert angenommen werden. Umfangreichere Teile der alten Farbverglasung dürften dann,
ALTENTHANN • PFARRKIRCHE
Blättern und Festons, blaßgrünen Kapitellen mit nackten Män-
nerbüsten, deren Haare, Bärte und eingerollte Volutenenden
wiederum mit Silbergelb zu einem warmen Gelbgrün gehöht
wurden. Der geschweifte hellblaue Bogen wird gleichfalls von
hellgrünen Girlanden (mit blauen Trauben) und hellgrünen
Blattformen überwuchert sowie durch einen zentralen, blaßrosa-
farbenen Tondo mit dem Kopf eines Königs ausgezeichnet;
Haare, Bart, Krone und Kragen des gekrönten Hauptes sind sil-
bergelb gehöht. Zwischen Kapitellen und Bogenschenkeln sind
nochmals silbergelbe Girlanden aufgehängt. Sockelzone und
Oberbild mit Inschriftkartusche und Hirschjagd sind auf Gri-
saillemalerei mit Silbergelb und Eisenrot beschränkt.
Technik, Stil: Der lockere, wässrig malerische Schwarzlotauftrag
weist - ebenso wie die ganze Komposition - auf die gleiche aus-
führende Werkstatt, der auch die beiden Wappenscheiben der
1 Nürnberg, GNM, ImhoffA, Teil II, Nr. 9, Tab. 84.
2 Vgl. etwa die beiden Fassungen in Budapest (Szepmüveszeti Muzeum,
Inv. Nr. 103, 104); Peters, 1980, Abb. 14.
3 Jenny Schneider, Glasgemälde. Katalog der Sammlung des Schweize-
rischen Landesmuseums Zürich, Stäfa 1970,1, Nr. 142; vgl. auch die Nrn.
174, 177, 188, 201, 315, von denen die letzten beiden, die Wappenscheibe
Ebner in Eschenbach von 1548 zugeschrieben werden müssen
(vgl. Abb. 7yf.). Anklänge an die Schweizer Glasmalerei der Zeit
mit ihrer überbordenden Motivfülle lassen eine entsprechende
Provenienz vermuten. Namentlich die Schaffhausener Werkstatt
des Hieronymus Lang, die wiederholt für Nürnberger Auftrag-
geber gearbeitet hat, erscheint in ihren Wappenscheiben nächst-
verwandt (vgl. Kunstgeschichtliche Einleitung S. 80). Für die
groteske Ornamentik könnten außerdem druckgraphische Vor-
bilder im Werk der Nürnberger Reißer Sebald Beham, Peter
Flötner oder Virgil Solis zugrunde gelegen haben5. Zur Steige-
rung der Farbskala wurde in ausgeprägtem Maß Silbergelb- und
Braunlotmalerei auf weißen, blauen und grünen Gläsern zum
Einsatz gebracht.
Datierung: 1550.
CVMA KB 279/22, 27 (J)
des Leonhard Holzhalb von 1534 und das Allianzwappen Blarer/von
Hohenlandenberg von 1564, dem Oberbild des Imhoffwappens am
nächsten kommen.
4 Zuletzt in: Kat. Ausst. Freiburg i. Br. 2001, Nr. 58.
5 Vgl. Hollstein, III, 1955, S. 134-156 (Beham); Geisberg, 1974, III,
S. 787-816 (Flötner); ders., IV, S. 1267, 1279, G. 1331 (Solis).
ALTENTHANN • PFARRKIRCHE ST. NIKOLAUS
Bibliographie: Lehmann, 1861, S. 13-15 (verzeichnet neben dem Hl. Veit in der Sakristei nur eine kleine Wappen-
scheibe Grundherr/Kress im Chor); Kurzinventar Nürnberg-Land, 1961, S. 26 (Aufzählung der Glasgemälde mit
Datierung); Rühl, 1961, S. 330 (erwähnt den Gnadenstuhl als recht gute Arbeit); Dehio Franken, 1979, S. 16 (Auf-
zählung nach Kurzinventar); Fitz-Ulrich, 1984, S. 137 (verzeichnet nur den »hl. Vitus, 1. Hälfte 14. Jh.«); Martin
SiMON/Friedrich v. GRUNDHERR/Matthias Exner, Sankt Veit Altenthann, Nürnberg 1996, S. 6, 12E (Abbildungslegen-
den mit Bestimmung der Wappenallianzen); Dehio Franken, 2i999, S. 19 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Neben zwei Glasgemälden des frühen 14. bzw. mittleren 16. Jahrhunderts, die in jüngerer
Zeit in die hochliegenden Südfenster des Langhauses versetzt wurden (Fig. 3E, 6, Abb. if.), sind am Ort noch vier
kleine Kabinett- bzw. Wappenscheiben des späteren 16. und frühen 17. Jahrhunderts1 sowie vier große Rechteck- und
Bogenfelder der Zeit um 1900 erhalten geblieben2. Nicht schutzverglast.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung, zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die erstmals 1464 in
einer Stiftungsurkunde als Filiale von Altdorf urkundlich erwähnte Kapelle des Hl. Veit auf dem Burgstall der Burg
Thann gelangte 1535 in den Besitz des Nürnberger Geschlechts der Grundherr und erhielt 1610 mit Errichtung der
Prädikatur zu Altenthann durch die Grundherren den ersten ständigen Pfarrer mit Sitz in Altdorf3. Chor und Teile
des Langhauses mußten 1697/1700 einem erweiterten Neuaufbau als einfache Saalkirche mit dreiseitigem Ostabschluß
weichen, bei dem auch die Fensteröffnungen - drei auf der Südseite des Schiffs, zwei auf der Ost- und Nordostseite
des Chors - vergrößert wurden.
Da das wiederholte Vorkommen des Grundherrschen Wappens in der Darstellung des Gnadenstuhls ebenso wie in
den übrigen nachmittelalterlichen Rundscheiben eine ursprüngliche Bestimmung der betreffenden Glasgemälde für
den Vorgängerbau so gut wie sicher belegt, darf entsprechendes mit einiger Berechtigung auch für das Fragment des
Hl. Veit aus dem 14. Jahrhundert angenommen werden. Umfangreichere Teile der alten Farbverglasung dürften dann,