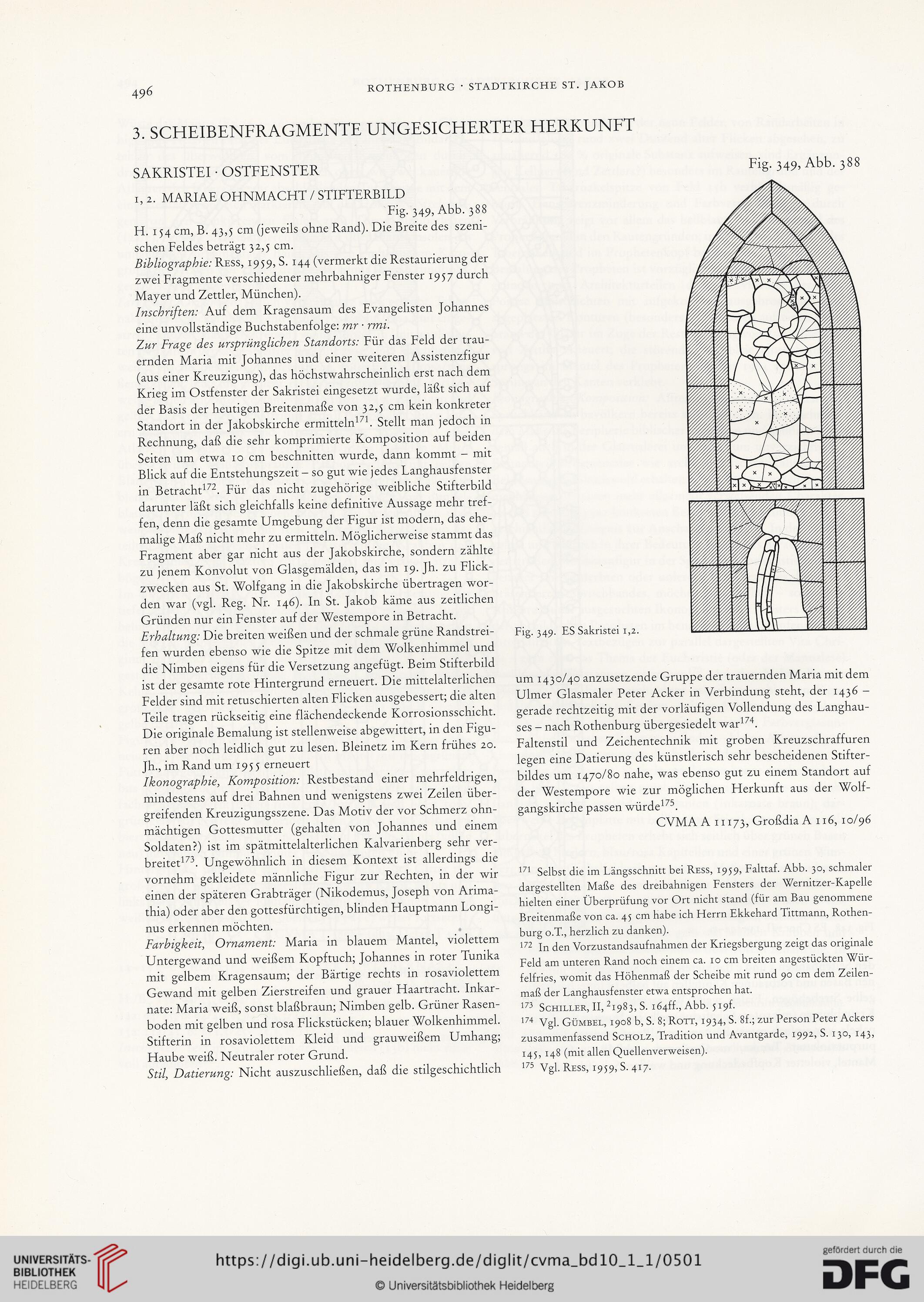496
ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB
3. SCHEIBENFRAGMENTE UNGESICHERTER HERKUNFT
SAKRISTEI • OSTFENSTER
1,2. MARIAE OHNMACHT / STIFTERBILD
Fig. 349, Abb. 388
H. 154 cm, B. 43,5 cm (jeweils ohne Rand). Die Breite des szeni-
schen Feldes beträgt 32,5 cm.
Bibliographie: Ress, 1959, S. 144 (vermerkt die Restaurierung der
zwei Fragmente verschiedener mehrbahniger Fenster 1957 durch
Mayer und Zettler, München).
Inschriften: Auf dem Kragensaum des Evangelisten Johannes
eine unvollständige Buchstabenfolge: mr ■ rmi.
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Für das Feld der trau-
ernden Maria mit Johannes und einer weiteren Assistenzfigur
(aus einer Kreuzigung), das höchstwahrscheinlich erst nach dem
Krieg im Ostfenster der Sakristei eingesetzt wurde, läßt sich auf
der Basis der heutigen Breitenmaße von 32,5 cm kein konkreter
Standort in der Jakobskirche ermitteln171. Stellt man jedoch in
Rechnung, daß die sehr komprimierte Komposition auf beiden
Seiten um etwa 10 cm beschnitten wurde, dann kommt - mit
Blick auf die Entstehungszeit - so gut wie jedes Langhausfenster
in Betracht172. Für das nicht zugehörige weibliche Stifterbild
darunter läßt sich gleichfalls keine definitive Aussage mehr tref-
fen, denn die gesamte Umgebung der Figur ist modern, das ehe-
malige Maß nicht mehr zu ermitteln. Möglicherweise stammt das
Fragment aber gar nicht aus der Jakobskirche, sondern zählte
zu jenem Konvolut von Glasgemälden, das im 19. Jh. zu Flick-
zwecken aus St. Wolfgang in die Jakobskirche übertragen wor-
den war (vgl. Reg. Nr. 146). In St. Jakob käme aus zeitlichen
Gründen nur ein Fenster auf der Westempore in Betracht.
Erhaltung: Die breiten weißen und der schmale grüne Randstrei-
fen wurden ebenso wie die Spitze mit dem Wolkenhimmel und
die Nimben eigens für die Versetzung angefügt. Beim Stifterbild
ist der gesamte rote Hintergrund erneuert. Die mittelalterlichen
Felder sind mit retuschierten alten Flicken ausgebessert; die alten
Teile tragen rückseitig eine flächendeckende Korrosionsschicht.
Die originale Bemalung ist stellenweise abgewittert, in den Figu-
ren aber noch leidlich gut zu lesen. Bleinetz im Kern frühes 20.
Jh., im Rand um 1955 erneuert
Ikonographie, Komposition: Restbestand einer mehrfeldrigen,
mindestens auf drei Bahnen und wenigstens zwei Zeilen über-
greifenden Kreuzigungsszene. Das Motiv der vor Schmerz ohn-
mächtigen Gottesmutter (gehalten von Johannes und einem
Soldaten?) ist im spätmittelalterlichen Kalvarienberg sehr ver-
breitet173. Ungewöhnlich in diesem Kontext ist allerdings die
vornehm gekleidete männliche Figur zur Rechten, in der wir
einen der späteren Grabträger (Nikodemus, Joseph von Arima-
thia) oder aber den gottesfürchtigen, blinden Hauptmann Longi-
nus erkennen möchten.
Farbigkeit, Ornament: Maria in blauem Mantel, violettem
Untergewand und weißem Kopftuch; Johannes in roter Tunika
mit gelbem Kragensaum; der Bärtige rechts in rosaviolettem
Gewand mit gelben Zierstreifen und grauer Haartracht. Inkar-
nate: Maria weiß, sonst blaßbraun; Nimben gelb. Grüner Rasen-
boden mit gelben und rosa Flickstücken; blauer Wolkenhimmel.
Stifterin in rosaviolettem Kleid und grauweißem Umhang;
Haube weiß. Neutraler roter Grund.
Stil, Datierung: Nicht auszuschließen, daß die stilgeschichtlich
Fig. 349. ES Sakristei 1,2.
Fig. 349, Abb. 388
um 1430/40 anzusetzende Gruppe der trauernden Maria mit dem
Ulmer Glasmaler Peter Acker in Verbindung steht, der 1436 —
gerade rechtzeitig mit der vorläufigen Vollendung des Langhau-
ses - nach Rothenburg übergesiedelt war174.
Faltenstil und Zeichentechnik mit groben Kreuzschraffuren
legen eine Datierung des künstlerisch sehr bescheidenen Stifter-
bildes um 1470/80 nahe, was ebenso gut zu einem Standort auf
der Westempore wie zur möglichen Herkunft aus der Wolf-
gangskirche passen würde175.
CVMA A 11173, Großdia A 116, 10/96
171 Selbst die im Längsschnitt bei Ress, 1959, Falttaf. Abb. 30, schmaler
dargestellten Maße des dreibahnigen Fensters der Wernitzer-Kapelle
hielten einer Überprüfung vor Ort nicht stand (für am Bau genommene
Breitenmaße von ca. 45 cm habe ich Herrn Ekkehard Tittmann, Rothen-
burg o.T., herzlich zu danken).
172 In den Vorzustandsaufnahmen der Kriegsbergung zeigt das originale
Feld am unteren Rand noch einem ca. 10 cm breiten angestückten Wür-
felfries, womit das Höhenmaß der Scheibe mit rund 90 cm dem Zeilen-
maß der Langhausfenster etwa entsprochen hat.
173 Schiller, II, 2i983, S. 164(1., Abb. 519h
174 Vgl. Gümbel, 1908 b, S. 8; Rott, 1934, S. 8f.; zur Person Peter Ackers
zusammenfassend Scholz, Tradition und Avantgarde, 1992, S. 130, 143,
145, 148 (mit allen Quellenverweisen).
175 Vgl. Ress, 1959, S. 417.
ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB
3. SCHEIBENFRAGMENTE UNGESICHERTER HERKUNFT
SAKRISTEI • OSTFENSTER
1,2. MARIAE OHNMACHT / STIFTERBILD
Fig. 349, Abb. 388
H. 154 cm, B. 43,5 cm (jeweils ohne Rand). Die Breite des szeni-
schen Feldes beträgt 32,5 cm.
Bibliographie: Ress, 1959, S. 144 (vermerkt die Restaurierung der
zwei Fragmente verschiedener mehrbahniger Fenster 1957 durch
Mayer und Zettler, München).
Inschriften: Auf dem Kragensaum des Evangelisten Johannes
eine unvollständige Buchstabenfolge: mr ■ rmi.
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Für das Feld der trau-
ernden Maria mit Johannes und einer weiteren Assistenzfigur
(aus einer Kreuzigung), das höchstwahrscheinlich erst nach dem
Krieg im Ostfenster der Sakristei eingesetzt wurde, läßt sich auf
der Basis der heutigen Breitenmaße von 32,5 cm kein konkreter
Standort in der Jakobskirche ermitteln171. Stellt man jedoch in
Rechnung, daß die sehr komprimierte Komposition auf beiden
Seiten um etwa 10 cm beschnitten wurde, dann kommt - mit
Blick auf die Entstehungszeit - so gut wie jedes Langhausfenster
in Betracht172. Für das nicht zugehörige weibliche Stifterbild
darunter läßt sich gleichfalls keine definitive Aussage mehr tref-
fen, denn die gesamte Umgebung der Figur ist modern, das ehe-
malige Maß nicht mehr zu ermitteln. Möglicherweise stammt das
Fragment aber gar nicht aus der Jakobskirche, sondern zählte
zu jenem Konvolut von Glasgemälden, das im 19. Jh. zu Flick-
zwecken aus St. Wolfgang in die Jakobskirche übertragen wor-
den war (vgl. Reg. Nr. 146). In St. Jakob käme aus zeitlichen
Gründen nur ein Fenster auf der Westempore in Betracht.
Erhaltung: Die breiten weißen und der schmale grüne Randstrei-
fen wurden ebenso wie die Spitze mit dem Wolkenhimmel und
die Nimben eigens für die Versetzung angefügt. Beim Stifterbild
ist der gesamte rote Hintergrund erneuert. Die mittelalterlichen
Felder sind mit retuschierten alten Flicken ausgebessert; die alten
Teile tragen rückseitig eine flächendeckende Korrosionsschicht.
Die originale Bemalung ist stellenweise abgewittert, in den Figu-
ren aber noch leidlich gut zu lesen. Bleinetz im Kern frühes 20.
Jh., im Rand um 1955 erneuert
Ikonographie, Komposition: Restbestand einer mehrfeldrigen,
mindestens auf drei Bahnen und wenigstens zwei Zeilen über-
greifenden Kreuzigungsszene. Das Motiv der vor Schmerz ohn-
mächtigen Gottesmutter (gehalten von Johannes und einem
Soldaten?) ist im spätmittelalterlichen Kalvarienberg sehr ver-
breitet173. Ungewöhnlich in diesem Kontext ist allerdings die
vornehm gekleidete männliche Figur zur Rechten, in der wir
einen der späteren Grabträger (Nikodemus, Joseph von Arima-
thia) oder aber den gottesfürchtigen, blinden Hauptmann Longi-
nus erkennen möchten.
Farbigkeit, Ornament: Maria in blauem Mantel, violettem
Untergewand und weißem Kopftuch; Johannes in roter Tunika
mit gelbem Kragensaum; der Bärtige rechts in rosaviolettem
Gewand mit gelben Zierstreifen und grauer Haartracht. Inkar-
nate: Maria weiß, sonst blaßbraun; Nimben gelb. Grüner Rasen-
boden mit gelben und rosa Flickstücken; blauer Wolkenhimmel.
Stifterin in rosaviolettem Kleid und grauweißem Umhang;
Haube weiß. Neutraler roter Grund.
Stil, Datierung: Nicht auszuschließen, daß die stilgeschichtlich
Fig. 349. ES Sakristei 1,2.
Fig. 349, Abb. 388
um 1430/40 anzusetzende Gruppe der trauernden Maria mit dem
Ulmer Glasmaler Peter Acker in Verbindung steht, der 1436 —
gerade rechtzeitig mit der vorläufigen Vollendung des Langhau-
ses - nach Rothenburg übergesiedelt war174.
Faltenstil und Zeichentechnik mit groben Kreuzschraffuren
legen eine Datierung des künstlerisch sehr bescheidenen Stifter-
bildes um 1470/80 nahe, was ebenso gut zu einem Standort auf
der Westempore wie zur möglichen Herkunft aus der Wolf-
gangskirche passen würde175.
CVMA A 11173, Großdia A 116, 10/96
171 Selbst die im Längsschnitt bei Ress, 1959, Falttaf. Abb. 30, schmaler
dargestellten Maße des dreibahnigen Fensters der Wernitzer-Kapelle
hielten einer Überprüfung vor Ort nicht stand (für am Bau genommene
Breitenmaße von ca. 45 cm habe ich Herrn Ekkehard Tittmann, Rothen-
burg o.T., herzlich zu danken).
172 In den Vorzustandsaufnahmen der Kriegsbergung zeigt das originale
Feld am unteren Rand noch einem ca. 10 cm breiten angestückten Wür-
felfries, womit das Höhenmaß der Scheibe mit rund 90 cm dem Zeilen-
maß der Langhausfenster etwa entsprochen hat.
173 Schiller, II, 2i983, S. 164(1., Abb. 519h
174 Vgl. Gümbel, 1908 b, S. 8; Rott, 1934, S. 8f.; zur Person Peter Ackers
zusammenfassend Scholz, Tradition und Avantgarde, 1992, S. 130, 143,
145, 148 (mit allen Quellenverweisen).
175 Vgl. Ress, 1959, S. 417.