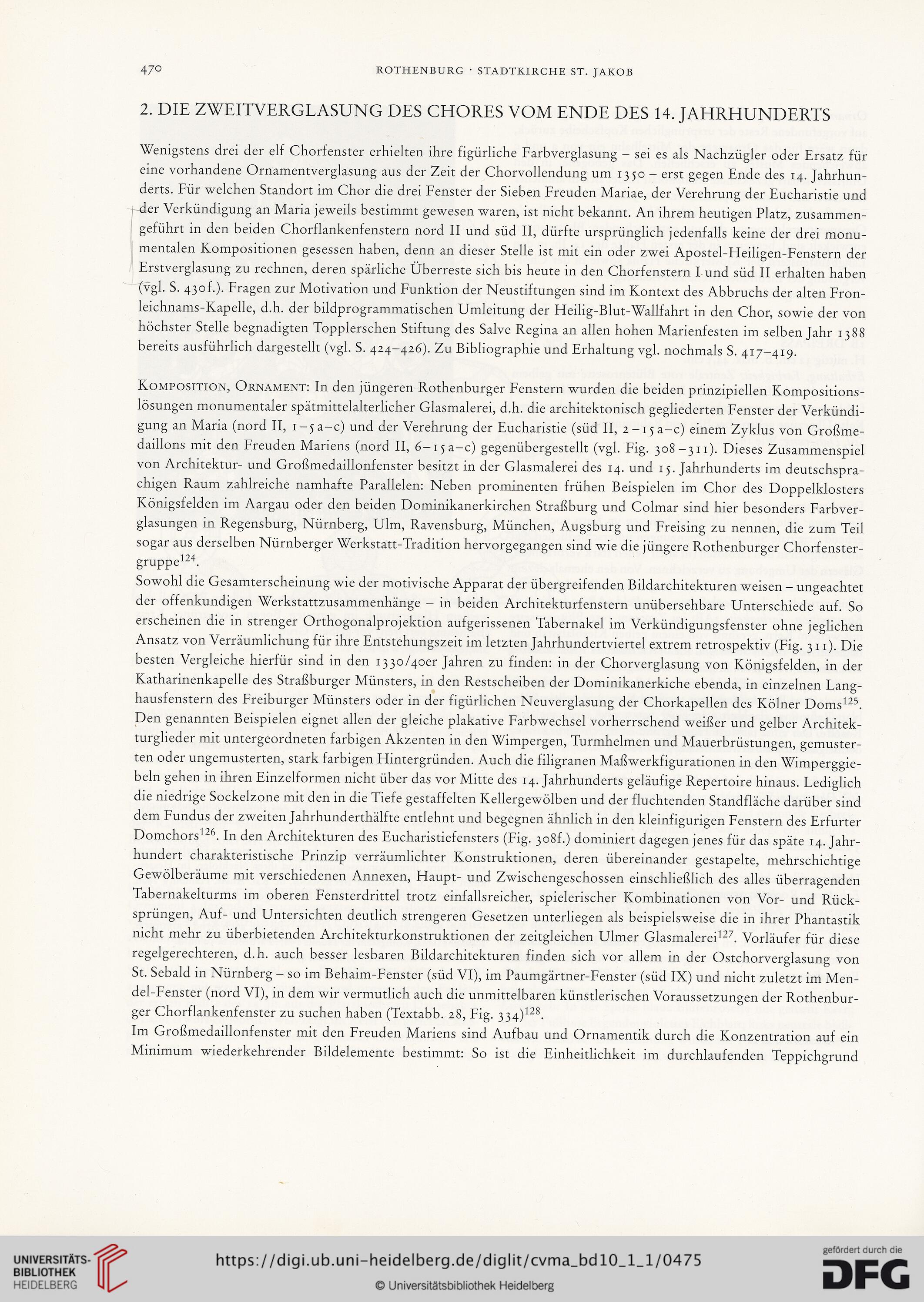47°
ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB
2. DIE ZWEITVERGLASUNG DES CHORES VOM ENDE DES 14. JAHRHUNDERTS
Wenigstens drei der elf Chorfenster erhielten ihre figürliche Farbverglasung - sei es als Nachzügler oder Ersatz für
eine vorhandene Ornamentverglasung aus der Zeit der Chorvollendung um 1350 - erst gegen Ende des 14. Jahrhun-
derts. Für welchen Standort im Chor die drei Fenster der Sieben Freuden Mariae, der Verehrung der Eucharistie und
■der Verkündigung an Maria jeweils bestimmt gewesen waren, ist nicht bekannt. An ihrem heutigen Platz, zusammen-
geführt in den beiden Chorflankenfenstern nord II und süd II, dürfte ursprünglich jedenfalls keine der drei monu-
mentalen Kompositionen gesessen haben, denn an dieser Stelle ist mit ein oder zwei Apostel-Heiligen-Fenstern der
Erstverglasung zu rechnen, deren spärliche Überreste sich bis heute in den Chorfenstern Lund süd II erhalten haben
Hygl- S. 430f.). Fragen zur Motivation und Funktion der Neustiftungen sind im Kontext des Abbruchs der alten Fron-
leichnams-Kapelle, d.h. der bildprogrammatischen Umleitung der Heilig-Blut-Wallfahrt in den Chor, sowie der von
höchster Stelle begnadigten Topplerschen Stiftung des Salve Regina an allen hohen Marienfesten im selben Jahr 1388
bereits ausführlich dargestellt (vgl. S. 424-426). Zu Bibliographie und Erhaltung vgl. nochmals S. 417-419.
Komposition, Ornament: In den jüngeren Rothenburger Fenstern wurden die beiden prinzipiellen Kompositions-
lösungen monumentaler spätmittelalterlicher Glasmalerei, d.h. die architektonisch gegliederten Fenster der Verkündi-
gung an Maria (nord II, i-ja-c) und der Verehrung der Eucharistie (süd II, 2-ija-c) einem Zyklus von Großme-
daillons mit den Freuden Mariens (nord II, 6-ija-c) gegenübergestellt (vgl. Fig. 308-311). Dieses Zusammenspiel
von Architektur- und Großmedaillonfenster besitzt in der Glasmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts im deutschspra-
chigen Raum zahlreiche namhafte Parallelen: Neben prominenten frühen Beispielen im Chor des Doppelklosters
Königsfelden im Aargau oder den beiden Dominikanerkirchen Straßburg und Colmar sind hier besonders Farbver-
glasungen in Regensburg, Nürnberg, Ulm, Ravensburg, München, Augsburg und Freising zu nennen, die zum Teil
sogar aus derselben Nürnberger Werkstatt-Tradition hervorgegangen sind wie die jüngere Rothenburger Chorfenster-
124
gruppe .
Sowohl die Gesamterscheinung wie der motivische Apparat der übergreifenden Bildarchitekturen weisen - ungeachtet
der offenkundigen Werkstattzusammenhänge - in beiden Architekturfenstern unübersehbare Unterschiede auf. So
erscheinen die in strenger Orthogonalprojektion aufgerissenen Tabernakel im Verkündigungsfenster ohne jeglichen
Ansatz von Verräumlichung für ihre Entstehungszeit im letzten Jahrhundertviertel extrem retrospektiv (Fig. 311). Die
besten Vergleiche hierfür sind in den I33o/4oer Jahren zu finden: in der Chorverglasung von Königsfelden, in der
Katharinenkapelle des Straßburger Münsters, in den Restscheiben der Dominikanerkiche ebenda, in einzelnen Lang-
hausfenstern des Freiburger Münsters oder in der figürlichen Neuverglasung der Chorkapellen des Kölner Doms125.
Den genannten Beispielen eignet allen der gleiche plakative Farbwechsel vorherrschend weißer und gelber Architek-
turglieder mit untergeordneten farbigen Akzenten in den Wimpergen, Turmhelmen und Mauerbrüstungen, gemuster-
ten oder ungemusterten, stark farbigen Hintergründen. Auch die filigranen Maßwerkfigurationen in den Wimperggie-
beln gehen in ihren Einzelformen nicht über das vor Mitte des 14. Jahrhunderts geläufige Repertoire hinaus. Lediglich
die niedrige Sockelzone mit den in die Tiefe gestaffelten Kellergewölben und der fluchtenden Standfläche darüber sind
dem Fundus der zweiten Jahrhunderthälfte entlehnt und begegnen ähnlich in den kleinfigurigen Fenstern des Erfurter
Domchors126. In den Architekturen des Eucharistiefensters (Fig. 308E) dominiert dagegen jenes für das späte 14. Jahr-
hundert charakteristische Prinzip verräumlichter Konstruktionen, deren übereinander gestapelte, mehrschichtige
Gewölberäume mit verschiedenen Annexen, Haupt- und Zwischengeschossen einschließlich des alles überragenden
Tabernakelturms im oberen Fensterdrittel trotz einfallsreicher, spielerischer Kombinationen von Vor- und Rück-
sprüngen, Auf- und Untersichten deutlich strengeren Gesetzen unterliegen als beispielsweise die in ihrer Phantastik
nicht mehr zu überbietenden Architekturkonstruktionen der zeitgleichen Ulmer Glasmalerei127. Vorläufer für diese
regelgerechteren, d.h. auch besser lesbaren Bildarchitekturen finden sich vor allem in der Ostchorverglasung von
St. Sebald in Nürnberg - so im Behaim-Fenster (süd VI), im Paumgärtner-Fenster (süd IX) und nicht zuletzt im Men-
del-Fenster (nord VI), in dem wir vermutlich auch die unmittelbaren künstlerischen Voraussetzungen der Rothenbur-
ger Chorflankenfenster zu suchen haben (Textabb. 28, Fig. 334)128.
Im Großmedaillonfenster mit den Freuden Mariens sind Aufbau und Ornamentik durch die Konzentration auf ein
Minimum wiederkehrender Bildelemente bestimmt: So ist die Einheitlichkeit im durchlaufenden Teppichgrund
ROTHENBURG • STADTKIRCHE ST. JAKOB
2. DIE ZWEITVERGLASUNG DES CHORES VOM ENDE DES 14. JAHRHUNDERTS
Wenigstens drei der elf Chorfenster erhielten ihre figürliche Farbverglasung - sei es als Nachzügler oder Ersatz für
eine vorhandene Ornamentverglasung aus der Zeit der Chorvollendung um 1350 - erst gegen Ende des 14. Jahrhun-
derts. Für welchen Standort im Chor die drei Fenster der Sieben Freuden Mariae, der Verehrung der Eucharistie und
■der Verkündigung an Maria jeweils bestimmt gewesen waren, ist nicht bekannt. An ihrem heutigen Platz, zusammen-
geführt in den beiden Chorflankenfenstern nord II und süd II, dürfte ursprünglich jedenfalls keine der drei monu-
mentalen Kompositionen gesessen haben, denn an dieser Stelle ist mit ein oder zwei Apostel-Heiligen-Fenstern der
Erstverglasung zu rechnen, deren spärliche Überreste sich bis heute in den Chorfenstern Lund süd II erhalten haben
Hygl- S. 430f.). Fragen zur Motivation und Funktion der Neustiftungen sind im Kontext des Abbruchs der alten Fron-
leichnams-Kapelle, d.h. der bildprogrammatischen Umleitung der Heilig-Blut-Wallfahrt in den Chor, sowie der von
höchster Stelle begnadigten Topplerschen Stiftung des Salve Regina an allen hohen Marienfesten im selben Jahr 1388
bereits ausführlich dargestellt (vgl. S. 424-426). Zu Bibliographie und Erhaltung vgl. nochmals S. 417-419.
Komposition, Ornament: In den jüngeren Rothenburger Fenstern wurden die beiden prinzipiellen Kompositions-
lösungen monumentaler spätmittelalterlicher Glasmalerei, d.h. die architektonisch gegliederten Fenster der Verkündi-
gung an Maria (nord II, i-ja-c) und der Verehrung der Eucharistie (süd II, 2-ija-c) einem Zyklus von Großme-
daillons mit den Freuden Mariens (nord II, 6-ija-c) gegenübergestellt (vgl. Fig. 308-311). Dieses Zusammenspiel
von Architektur- und Großmedaillonfenster besitzt in der Glasmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts im deutschspra-
chigen Raum zahlreiche namhafte Parallelen: Neben prominenten frühen Beispielen im Chor des Doppelklosters
Königsfelden im Aargau oder den beiden Dominikanerkirchen Straßburg und Colmar sind hier besonders Farbver-
glasungen in Regensburg, Nürnberg, Ulm, Ravensburg, München, Augsburg und Freising zu nennen, die zum Teil
sogar aus derselben Nürnberger Werkstatt-Tradition hervorgegangen sind wie die jüngere Rothenburger Chorfenster-
124
gruppe .
Sowohl die Gesamterscheinung wie der motivische Apparat der übergreifenden Bildarchitekturen weisen - ungeachtet
der offenkundigen Werkstattzusammenhänge - in beiden Architekturfenstern unübersehbare Unterschiede auf. So
erscheinen die in strenger Orthogonalprojektion aufgerissenen Tabernakel im Verkündigungsfenster ohne jeglichen
Ansatz von Verräumlichung für ihre Entstehungszeit im letzten Jahrhundertviertel extrem retrospektiv (Fig. 311). Die
besten Vergleiche hierfür sind in den I33o/4oer Jahren zu finden: in der Chorverglasung von Königsfelden, in der
Katharinenkapelle des Straßburger Münsters, in den Restscheiben der Dominikanerkiche ebenda, in einzelnen Lang-
hausfenstern des Freiburger Münsters oder in der figürlichen Neuverglasung der Chorkapellen des Kölner Doms125.
Den genannten Beispielen eignet allen der gleiche plakative Farbwechsel vorherrschend weißer und gelber Architek-
turglieder mit untergeordneten farbigen Akzenten in den Wimpergen, Turmhelmen und Mauerbrüstungen, gemuster-
ten oder ungemusterten, stark farbigen Hintergründen. Auch die filigranen Maßwerkfigurationen in den Wimperggie-
beln gehen in ihren Einzelformen nicht über das vor Mitte des 14. Jahrhunderts geläufige Repertoire hinaus. Lediglich
die niedrige Sockelzone mit den in die Tiefe gestaffelten Kellergewölben und der fluchtenden Standfläche darüber sind
dem Fundus der zweiten Jahrhunderthälfte entlehnt und begegnen ähnlich in den kleinfigurigen Fenstern des Erfurter
Domchors126. In den Architekturen des Eucharistiefensters (Fig. 308E) dominiert dagegen jenes für das späte 14. Jahr-
hundert charakteristische Prinzip verräumlichter Konstruktionen, deren übereinander gestapelte, mehrschichtige
Gewölberäume mit verschiedenen Annexen, Haupt- und Zwischengeschossen einschließlich des alles überragenden
Tabernakelturms im oberen Fensterdrittel trotz einfallsreicher, spielerischer Kombinationen von Vor- und Rück-
sprüngen, Auf- und Untersichten deutlich strengeren Gesetzen unterliegen als beispielsweise die in ihrer Phantastik
nicht mehr zu überbietenden Architekturkonstruktionen der zeitgleichen Ulmer Glasmalerei127. Vorläufer für diese
regelgerechteren, d.h. auch besser lesbaren Bildarchitekturen finden sich vor allem in der Ostchorverglasung von
St. Sebald in Nürnberg - so im Behaim-Fenster (süd VI), im Paumgärtner-Fenster (süd IX) und nicht zuletzt im Men-
del-Fenster (nord VI), in dem wir vermutlich auch die unmittelbaren künstlerischen Voraussetzungen der Rothenbur-
ger Chorflankenfenster zu suchen haben (Textabb. 28, Fig. 334)128.
Im Großmedaillonfenster mit den Freuden Mariens sind Aufbau und Ornamentik durch die Konzentration auf ein
Minimum wiederkehrender Bildelemente bestimmt: So ist die Einheitlichkeit im durchlaufenden Teppichgrund