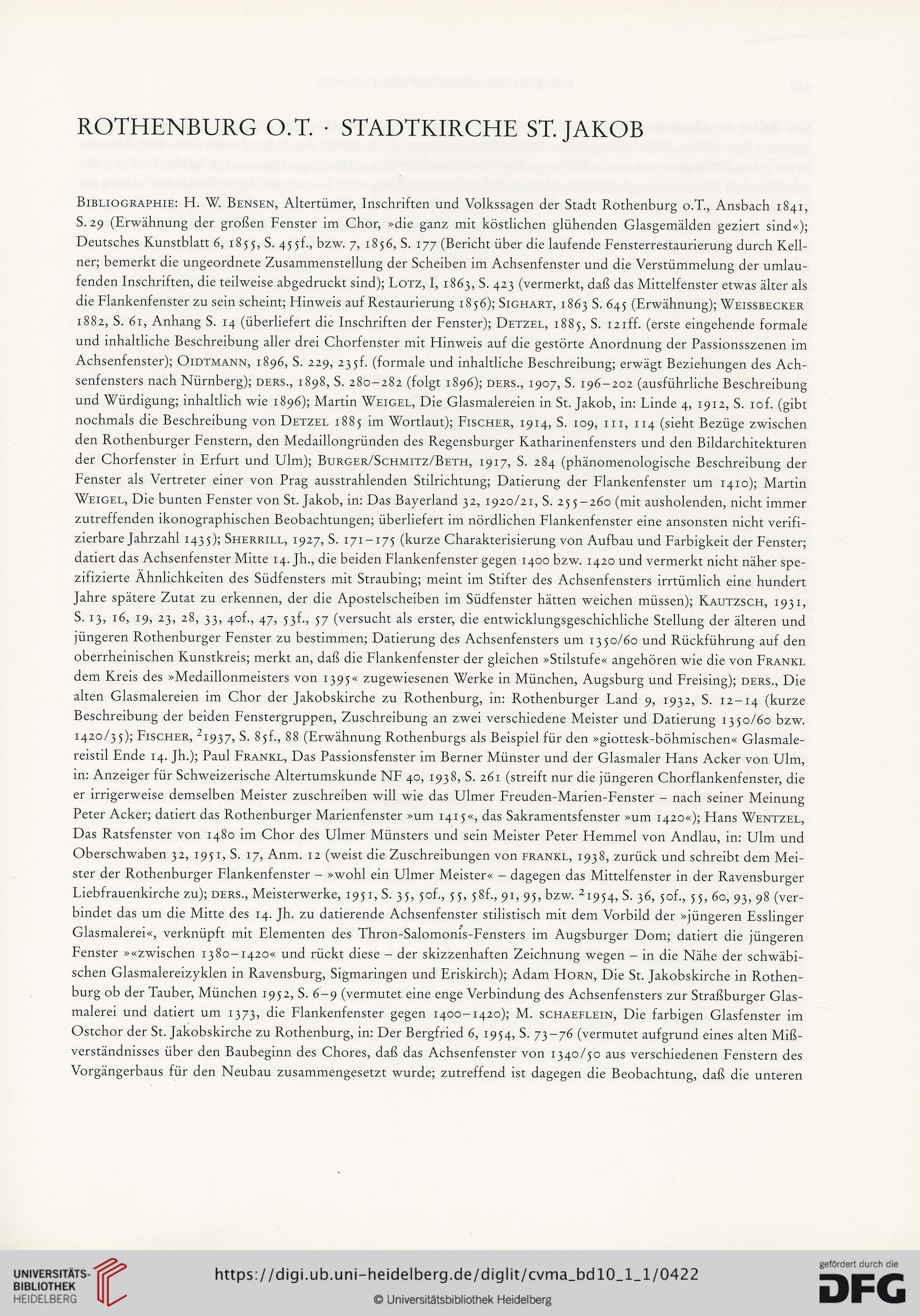ROTHENBURG O.T. ■ STADTKIRCHE ST. JAKOB
Bibliographie: H. W. Bensen, Altertümer, Inschriften und Volkssagen der Stadt Rothenburg o.T., Ansbach 1841,
S. 29 (Erwähnung der großen Fenster im Chor, »die ganz mit köstlichen glühenden Glasgemälden geziert sind«);
Deutsches Kunstblatt 6, 1855, S. 455!., bzw. 7, 1856, S. 177 (Bericht über die laufende Fensterrestaurierung durch Kell-
ner; bemerkt die ungeordnete Zusammenstellung der Scheiben im Achsenfenster und die Verstümmelung der umlau-
fenden Inschriften, die teilweise abgedruckt sind); Lotz, I, 1863, S. 423 (vermerkt, daß das Mittelfenster etwas älter als
die Flankenfenster zu sein scheint; Hinweis auf Restaurierung 1856); Sighart, 1863 S. 645 (Erwähnung); Weissbecker
1882, S. 61, Anhang S. 14 (überliefert die Inschriften der Fenster); Detzel, 1885, S. i2iff. (erste eingehende formale
und inhaltliche Beschreibung aller drei Chorfenster mit Hinweis auf die gestörte Anordnung der Passionsszenen im
Achsenfenster); Oidtmann, 1896, S. 229, 23 jf. (formale und inhaltliche Beschreibung; erwägt Beziehungen des Ach-
senfensters nach Nürnberg); ders., 1898, S. 280-282 (folgt 1896); ders., 1907, S. 196-202 (ausführliche Beschreibung
und Würdigung; inhaltlich wie 1896); Martin Weigel, Die Glasmalereien in St. Jakob, in: Linde 4, 1912, S. lof. (gibt
nochmals die Beschreibung von Detzel 1885 im Wortlaut); Fischer, 1914, S. 109, m, 114 (sieht Bezüge zwischen
den Rothenburger Fenstern, den Medaillongründen des Regensburger Katharinenfensters und den Bildarchitekturen
der Chorfenster in Erfurt und Ulm); Burger/Schmitz/Beth, 1917, S. 284 (phänomenologische Beschreibung der
Fenster als Vertreter einer von Prag ausstrahlenden Stilrichtung; Datierung der Flankenfenster um 1410); Martin
Weigel, Die bunten Fenster von St. Jakob, in: Das Bayerland 32, 1920/21, S. 255-260 (mit ausholenden, nicht immer
zutreffenden ikonographischen Beobachtungen; überliefert im nördlichen Flankenfenster eine ansonsten nicht verifi-
zierbare Jahrzahl 1435); Sherrill, 1927, S. 171-175 (kurze Charakterisierung von Aufbau und Farbigkeit der Fenster;
datiert das Achsenfenster Mitte 14. Jh., die beiden Flankenfenster gegen 1400 bzw. 1420 und vermerkt nicht näher spe-
zifizierte Ähnlichkeiten des Südfensters mit Straubing; meint im Stifter des Achsenfensters irrtümlich eine hundert
Jahre spätere Zutat zu erkennen, der die Apostelscheiben im Südfenster hätten weichen müssen); Kautzsch, 1931,
S. 13, 16, 19, 23, 28, 33, 4of., 47, 53f-, 57 (versucht als erster, die entwicklungsgeschichliche Stellung der älteren und
jüngeren Rothenburger Fenster zu bestimmen; Datierung des Achsenfensters um 1350/60 und Rückführung auf den
oberrheinischen Kunstkreis; merkt an, daß die Flankenfenster der gleichen »Stilstufe« angehören wie die von Frankl
dem Kreis des »Medaillonmeisters von 1395« zugewiesenen Werke in München, Augsburg und Freising); ders., Die
alten Glasmalereien im Chor der Jakobskirche zu Rothenburg, in: Rothenburger Land 9, 1932, S. 12-14 (kurze
Beschreibung der beiden Fenstergruppen, Zuschreibung an zwei verschiedene Meister und Datierung 1350/60 bzw.
1420/35); Fischer, 2i937, S. 85L, 88 (Erwähnung Rothenburgs, als Beispiel für den »giottesk-böhmischen« Glasmale-
reistil Ende 14. Jh.); Paul Frankl, Das Passionsfenster im Berner Münster und der Glasmaler Hans Acker von Ulm,
in: Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde NF 40, 1938, S. 261 (streift nur die jüngeren Chorflankenfenster, die
er irrigerweise demselben Meister zuschreiben will wie das Ulmer Freuden-Marien-Fenster - nach seiner Meinung
Peter Acker; datiert das Rothenburger Marienfenster »um 1415«, das Sakramentsfenster »um 1420«); Hans Wentzel,
Das Ratsfenster von 1480 im Chor des Ulmer Münsters und sein Meister Peter Hemmel von Andlau, in: Ulm und
Oberschwaben 32, 1951, S. 17, Anm. 12 (weist die Zuschreibungen von frankl, 1938, zurück und schreibt dem Mei-
ster der Rothenburger Flankenfenster - »wohl ein Ulmer Meister« - dagegen das Mittelfenster in der Ravensburger
Liebfrauenkirche zu); ders., Meisterwerke, 1951, S. 35, 5of., 55, 58!., 91, 95, bzw. 2i954, S. 36, 50!., 55, 60, 93, 98 (ver-
bindet das um die Mitte des 14. Jh. zu datierende Achsenfenster stilistisch mit dem Vorbild der »jüngeren Esslinger
Glasmalerei«, verknüpft mit Elementen des Thron-Salomonis-Fensters im Augsburger Dom; datiert die jüngeren
Fenster »«zwischen 1380-1420« und rückt diese - der skizzenhaften Zeichnung wegen - in die Nähe der schwäbi-
schen Glasmalereizyklen in Ravensburg, Sigmaringen und Eriskirch); Adam Horn, Die St. Jakobskirche in Rothen-
burg ob der Tauber, München 1952, S. 6-9 (vermutet eine enge Verbindung des Achsenfensters zur Straßburger Glas-
malerei und datiert um 1373, die Flankenfenster gegen 1400-1420); M. schaeflein, Die farbigen Glasfenster im
Ostchor der St. Jakobskirche zu Rothenburg, in: Der Bergfried 6, 1954, S. 73-76 (vermutet aufgrund eines alten Miß-
verständnisses über den Baubeginn des Chores, daß das Achsenfenster von 1340/50 aus verschiedenen Fenstern des
Vorgängerbaus für den Neubau zusammengesetzt wurde; zutreffend ist dagegen die Beobachtung, daß die unteren
Bibliographie: H. W. Bensen, Altertümer, Inschriften und Volkssagen der Stadt Rothenburg o.T., Ansbach 1841,
S. 29 (Erwähnung der großen Fenster im Chor, »die ganz mit köstlichen glühenden Glasgemälden geziert sind«);
Deutsches Kunstblatt 6, 1855, S. 455!., bzw. 7, 1856, S. 177 (Bericht über die laufende Fensterrestaurierung durch Kell-
ner; bemerkt die ungeordnete Zusammenstellung der Scheiben im Achsenfenster und die Verstümmelung der umlau-
fenden Inschriften, die teilweise abgedruckt sind); Lotz, I, 1863, S. 423 (vermerkt, daß das Mittelfenster etwas älter als
die Flankenfenster zu sein scheint; Hinweis auf Restaurierung 1856); Sighart, 1863 S. 645 (Erwähnung); Weissbecker
1882, S. 61, Anhang S. 14 (überliefert die Inschriften der Fenster); Detzel, 1885, S. i2iff. (erste eingehende formale
und inhaltliche Beschreibung aller drei Chorfenster mit Hinweis auf die gestörte Anordnung der Passionsszenen im
Achsenfenster); Oidtmann, 1896, S. 229, 23 jf. (formale und inhaltliche Beschreibung; erwägt Beziehungen des Ach-
senfensters nach Nürnberg); ders., 1898, S. 280-282 (folgt 1896); ders., 1907, S. 196-202 (ausführliche Beschreibung
und Würdigung; inhaltlich wie 1896); Martin Weigel, Die Glasmalereien in St. Jakob, in: Linde 4, 1912, S. lof. (gibt
nochmals die Beschreibung von Detzel 1885 im Wortlaut); Fischer, 1914, S. 109, m, 114 (sieht Bezüge zwischen
den Rothenburger Fenstern, den Medaillongründen des Regensburger Katharinenfensters und den Bildarchitekturen
der Chorfenster in Erfurt und Ulm); Burger/Schmitz/Beth, 1917, S. 284 (phänomenologische Beschreibung der
Fenster als Vertreter einer von Prag ausstrahlenden Stilrichtung; Datierung der Flankenfenster um 1410); Martin
Weigel, Die bunten Fenster von St. Jakob, in: Das Bayerland 32, 1920/21, S. 255-260 (mit ausholenden, nicht immer
zutreffenden ikonographischen Beobachtungen; überliefert im nördlichen Flankenfenster eine ansonsten nicht verifi-
zierbare Jahrzahl 1435); Sherrill, 1927, S. 171-175 (kurze Charakterisierung von Aufbau und Farbigkeit der Fenster;
datiert das Achsenfenster Mitte 14. Jh., die beiden Flankenfenster gegen 1400 bzw. 1420 und vermerkt nicht näher spe-
zifizierte Ähnlichkeiten des Südfensters mit Straubing; meint im Stifter des Achsenfensters irrtümlich eine hundert
Jahre spätere Zutat zu erkennen, der die Apostelscheiben im Südfenster hätten weichen müssen); Kautzsch, 1931,
S. 13, 16, 19, 23, 28, 33, 4of., 47, 53f-, 57 (versucht als erster, die entwicklungsgeschichliche Stellung der älteren und
jüngeren Rothenburger Fenster zu bestimmen; Datierung des Achsenfensters um 1350/60 und Rückführung auf den
oberrheinischen Kunstkreis; merkt an, daß die Flankenfenster der gleichen »Stilstufe« angehören wie die von Frankl
dem Kreis des »Medaillonmeisters von 1395« zugewiesenen Werke in München, Augsburg und Freising); ders., Die
alten Glasmalereien im Chor der Jakobskirche zu Rothenburg, in: Rothenburger Land 9, 1932, S. 12-14 (kurze
Beschreibung der beiden Fenstergruppen, Zuschreibung an zwei verschiedene Meister und Datierung 1350/60 bzw.
1420/35); Fischer, 2i937, S. 85L, 88 (Erwähnung Rothenburgs, als Beispiel für den »giottesk-böhmischen« Glasmale-
reistil Ende 14. Jh.); Paul Frankl, Das Passionsfenster im Berner Münster und der Glasmaler Hans Acker von Ulm,
in: Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde NF 40, 1938, S. 261 (streift nur die jüngeren Chorflankenfenster, die
er irrigerweise demselben Meister zuschreiben will wie das Ulmer Freuden-Marien-Fenster - nach seiner Meinung
Peter Acker; datiert das Rothenburger Marienfenster »um 1415«, das Sakramentsfenster »um 1420«); Hans Wentzel,
Das Ratsfenster von 1480 im Chor des Ulmer Münsters und sein Meister Peter Hemmel von Andlau, in: Ulm und
Oberschwaben 32, 1951, S. 17, Anm. 12 (weist die Zuschreibungen von frankl, 1938, zurück und schreibt dem Mei-
ster der Rothenburger Flankenfenster - »wohl ein Ulmer Meister« - dagegen das Mittelfenster in der Ravensburger
Liebfrauenkirche zu); ders., Meisterwerke, 1951, S. 35, 5of., 55, 58!., 91, 95, bzw. 2i954, S. 36, 50!., 55, 60, 93, 98 (ver-
bindet das um die Mitte des 14. Jh. zu datierende Achsenfenster stilistisch mit dem Vorbild der »jüngeren Esslinger
Glasmalerei«, verknüpft mit Elementen des Thron-Salomonis-Fensters im Augsburger Dom; datiert die jüngeren
Fenster »«zwischen 1380-1420« und rückt diese - der skizzenhaften Zeichnung wegen - in die Nähe der schwäbi-
schen Glasmalereizyklen in Ravensburg, Sigmaringen und Eriskirch); Adam Horn, Die St. Jakobskirche in Rothen-
burg ob der Tauber, München 1952, S. 6-9 (vermutet eine enge Verbindung des Achsenfensters zur Straßburger Glas-
malerei und datiert um 1373, die Flankenfenster gegen 1400-1420); M. schaeflein, Die farbigen Glasfenster im
Ostchor der St. Jakobskirche zu Rothenburg, in: Der Bergfried 6, 1954, S. 73-76 (vermutet aufgrund eines alten Miß-
verständnisses über den Baubeginn des Chores, daß das Achsenfenster von 1340/50 aus verschiedenen Fenstern des
Vorgängerbaus für den Neubau zusammengesetzt wurde; zutreffend ist dagegen die Beobachtung, daß die unteren