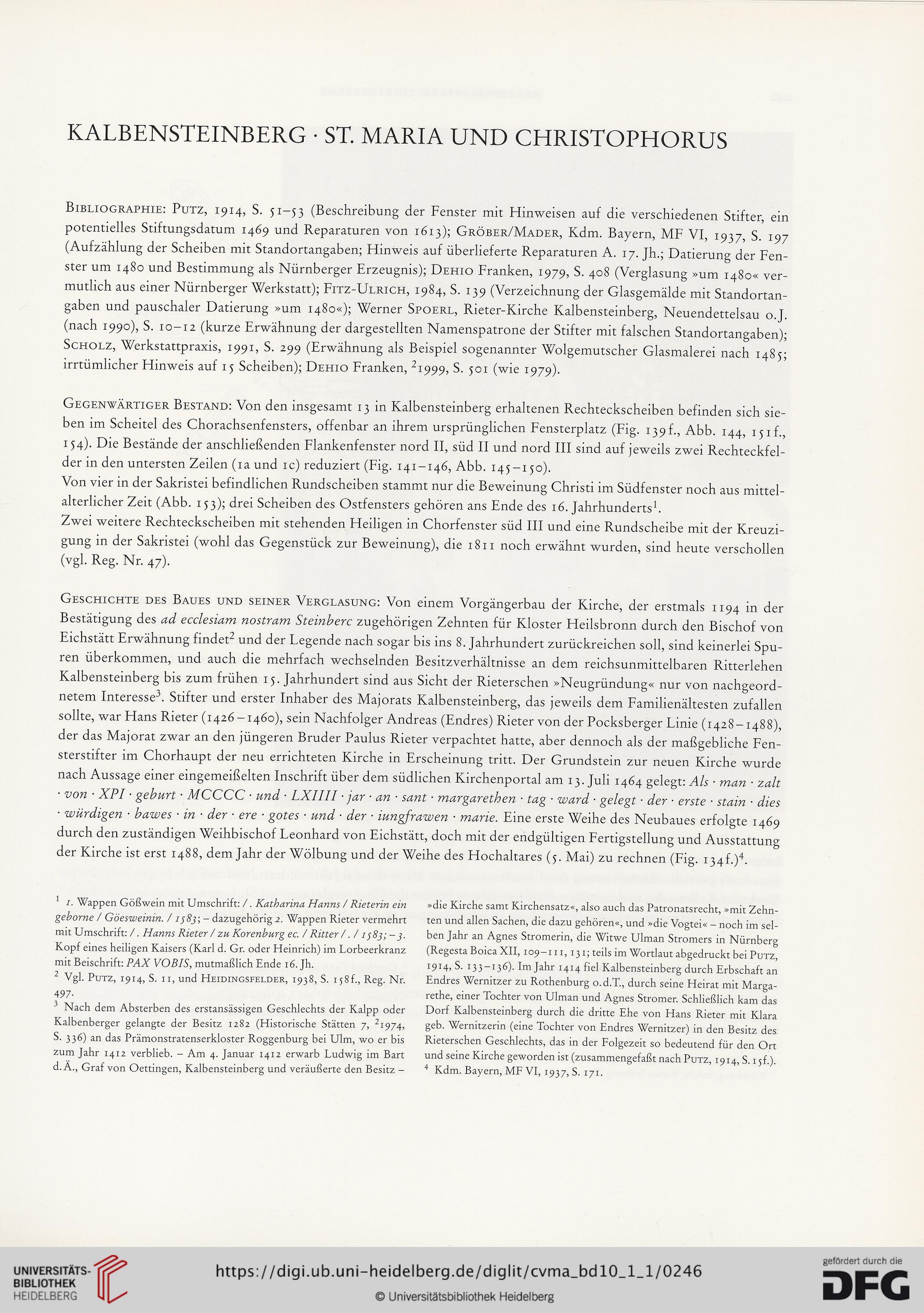KALBENSTEINBERG ■ ST. MARIA UND CHRISTOPHORUS
Bibliographie: Putz, 1914, S. 51—53 (Beschreibung der Fenster mit Hinweisen auf die verschiedenen Stifter, ein
potentielles Stiftungsdatum 1469 und Reparaturen von 1613); Gröber/Mader, Kdm. Bayern, MF VI, 1937, S. 197
(Aufzählung der Scheiben mit Standortangaben; Hinweis auf überlieferte Reparaturen A. 17. Jh.; Datierung der Fen-
ster um 1480 und Bestimmung als Nürnberger Erzeugnis); Dehio Franken, 1979, S. 408 (Verglasung »um 1480« ver-
mutlich aus einer Nürnberger Werkstatt); Fitz-Ulrich, 1984, S. 139 (Verzeichnung der Glasgemälde mit Standortan-
gaben und pauschaler Datierung »um 1480«); Werner Spoerl, Rieter-Kirche Kalbensteinberg, Neuendettelsau o.J.
(nach 1990), S. 10-12 (kurze Erwähnung der dargestellten Namenspatrone der Stifter mit falschen Standortangaben);
Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 299 (Erwähnung als Beispiel sogenannter Wolgemutscher Glasmalerei nach 1485;
irrtümlicher Hinweis auf 15 Scheiben); Dehio Franken, 2i999, S. 501 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Von den insgesamt 13 in Kalbensteinberg erhaltenen Rechteckscheiben befinden sich sie-
ben im Scheitel des Chorachsenfensters, offenbar an ihrem ursprünglichen Fensterplatz (Fig. 139f., Abb. 144, 151 f.,
154). Die Bestände der anschließenden Flankenfenster nord II, süd II und nord III sind auf jeweils zwei Rechteckfel-
der in den untersten Zeilen (ta und ic) reduziert (Fig. 141-146, Abb. 145-150).
Von vier in der Sakristei befindlichen Rundscheiben stammt nur die Beweinung Christi im Südfenster noch aus mittel-
alterlicher Zeit (Abb. 153); drei Scheiben des Ostfensters gehören ans Ende des 16. Jahrhunderts1.
Zwei weitere Rechteckscheiben mit stehenden Heiligen in Chorfenster süd III und eine Rundscheibe mit der Kreuzi-
gung in der Sakristei (wohl das Gegenstück zur Beweinung), die 1811 noch erwähnt wurden, sind heute verschollen
(vgl. Reg. Nr. 47).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von einem Vorgängerbau der Kirche, der erstmals 1194 in der
Bestätigung des ad ecclesiam nostram Steinberc zugehörigen Zehnten für Kloster Heilsbronn durch den Bischof von
Eichstätt Erwähnung findet2 und der Legende nach sogar bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen soll, sind keinerlei Spu-
ren überkommen, und auch die mehrfach wechselnden Besitzverhältnisse an dem reichsunmittelbaren Ritterlehen
Kalbensteinberg bis zum frühen 15. Jahrhundert sind aus Sicht der Rieterschen »Neugründung« nur von nachgeord-
netem Interesse3. Stifter und erster Inhaber des Majorats Kalbensteinberg, das jeweils dem Familienältesten zufallen
sollte, war Hans Rieter (1426-1460), sein Nachfolger Andreas (Endres) Rieter von der Pocksberger Linie (1428-1488),
der das Majorat zwar an den jüngeren Bruder Paulus Rieter verpachtet hatte, aber dennoch als der maßgebliche Fen-
sterstifter im Chorhaupt der neu errichteten Kirche in Erscheinung tritt. Der Grundstein zur neuen Kirche wurde
nach Aussage einer eingemeißelten Inschrift über dem südlichen Kirchenportal am 13. Juli 1464 gelegt: Als ■ man ■ zalt
■ von ■ XPI ■ gebürt • MCCCC ■ und ■ LXIIII ■ jar ■ an • sant ■ margarethen ■ tag ■ ward ■ gelegt ■ der ■ erste ■ stain • dies
■ würdigen ■ bawes • in • der ■ ere ■ gotes ■ und ■ der • iungfrawen ■ marie. Eine erste Weihe des Neubaues erfolgte 1469
durch den zuständigen Weihbischof Leonhard von Eichstätt, doch mit der endgültigen Fertigstellung und Ausstattung
der Kirche ist erst 1488, dem Jahr der Wölbung und der Weihe des Hochaltares (5. Mai) zu rechnen (Fig. 134E)4.
1 i. Wappen Gößwein mit Umschrift: /. Katharina Hanns / Rieterin ein
geborne / Göesweinin. / 1583',- dazugehörig 2. Wappen Rieter vermehrt
mit Umschrift: /. Hanns Rieter / zu Korenburg ec. / Ritter /. /1383;-3.
Kopf eines heiligen Kaisers (Karl d. Gr. oder Heinrich) im Lorbeerkranz
mit Beischrift: PAX VOBIS, mutmaßlich Ende 16. Jh.
2 Vgl. Putz, 1914, S. 11, und Heidingsfelder, 1938, S. 158E, Reg. Nr.
497-
3 Nach dem Absterben des erstansässigen Geschlechts der Kalpp oder
Kalbenberger gelangte der Besitz 1282 (Historische Stätten 7, 2i974,
S. 336) an das Prämonstratenserkloster Roggenburg bei Ulm, wo er bis
zum Jahr 1412 verblieb. - Am 4. Januar 1412 erwarb Ludwig im Bart
d.Ä., Graf von Oettingen, Kalbensteinberg und veräußerte den Besitz -
»die Kirche samt Kirchensatz«, also auch das Patronatsrecht, »mit Zehn-
ten und allen Sachen, die dazu gehören«, und »die Vogtei« - noch im sel-
ben Jahr an Agnes Stromerin, die Witwe Ulman Stromers in Nürnberg
(Regesta Boica XII, 109-111,131; teils im Wortlaut abgedruckt bei Putz,
1914, S. 133-136). Im Jahr 1414 fiel Kalbensteinberg durch Erbschaft an
Endres Wernitzer zu Rothenburg o.d.T, durch seine Heirat mit Marga-
rethe, einer Tochter von Ulman und Agnes Stromer. Schließlich kam das
Dorf Kalbensteinberg durch die dritte Ehe von Hans Rieter mit Klara
geb. Wernitzerin (eine Tochter von Endres Wernitzer) in den Besitz des.
Rieterschen Geschlechts, das in der Folgezeit so bedeutend für den Ort
und seine Kirche geworden ist (zusammengefaßt nach Putz, 1914, S. i;f.).
4 Kdm. Bayern, MF VI, 1937, S. 171.
Bibliographie: Putz, 1914, S. 51—53 (Beschreibung der Fenster mit Hinweisen auf die verschiedenen Stifter, ein
potentielles Stiftungsdatum 1469 und Reparaturen von 1613); Gröber/Mader, Kdm. Bayern, MF VI, 1937, S. 197
(Aufzählung der Scheiben mit Standortangaben; Hinweis auf überlieferte Reparaturen A. 17. Jh.; Datierung der Fen-
ster um 1480 und Bestimmung als Nürnberger Erzeugnis); Dehio Franken, 1979, S. 408 (Verglasung »um 1480« ver-
mutlich aus einer Nürnberger Werkstatt); Fitz-Ulrich, 1984, S. 139 (Verzeichnung der Glasgemälde mit Standortan-
gaben und pauschaler Datierung »um 1480«); Werner Spoerl, Rieter-Kirche Kalbensteinberg, Neuendettelsau o.J.
(nach 1990), S. 10-12 (kurze Erwähnung der dargestellten Namenspatrone der Stifter mit falschen Standortangaben);
Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 299 (Erwähnung als Beispiel sogenannter Wolgemutscher Glasmalerei nach 1485;
irrtümlicher Hinweis auf 15 Scheiben); Dehio Franken, 2i999, S. 501 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Von den insgesamt 13 in Kalbensteinberg erhaltenen Rechteckscheiben befinden sich sie-
ben im Scheitel des Chorachsenfensters, offenbar an ihrem ursprünglichen Fensterplatz (Fig. 139f., Abb. 144, 151 f.,
154). Die Bestände der anschließenden Flankenfenster nord II, süd II und nord III sind auf jeweils zwei Rechteckfel-
der in den untersten Zeilen (ta und ic) reduziert (Fig. 141-146, Abb. 145-150).
Von vier in der Sakristei befindlichen Rundscheiben stammt nur die Beweinung Christi im Südfenster noch aus mittel-
alterlicher Zeit (Abb. 153); drei Scheiben des Ostfensters gehören ans Ende des 16. Jahrhunderts1.
Zwei weitere Rechteckscheiben mit stehenden Heiligen in Chorfenster süd III und eine Rundscheibe mit der Kreuzi-
gung in der Sakristei (wohl das Gegenstück zur Beweinung), die 1811 noch erwähnt wurden, sind heute verschollen
(vgl. Reg. Nr. 47).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von einem Vorgängerbau der Kirche, der erstmals 1194 in der
Bestätigung des ad ecclesiam nostram Steinberc zugehörigen Zehnten für Kloster Heilsbronn durch den Bischof von
Eichstätt Erwähnung findet2 und der Legende nach sogar bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen soll, sind keinerlei Spu-
ren überkommen, und auch die mehrfach wechselnden Besitzverhältnisse an dem reichsunmittelbaren Ritterlehen
Kalbensteinberg bis zum frühen 15. Jahrhundert sind aus Sicht der Rieterschen »Neugründung« nur von nachgeord-
netem Interesse3. Stifter und erster Inhaber des Majorats Kalbensteinberg, das jeweils dem Familienältesten zufallen
sollte, war Hans Rieter (1426-1460), sein Nachfolger Andreas (Endres) Rieter von der Pocksberger Linie (1428-1488),
der das Majorat zwar an den jüngeren Bruder Paulus Rieter verpachtet hatte, aber dennoch als der maßgebliche Fen-
sterstifter im Chorhaupt der neu errichteten Kirche in Erscheinung tritt. Der Grundstein zur neuen Kirche wurde
nach Aussage einer eingemeißelten Inschrift über dem südlichen Kirchenportal am 13. Juli 1464 gelegt: Als ■ man ■ zalt
■ von ■ XPI ■ gebürt • MCCCC ■ und ■ LXIIII ■ jar ■ an • sant ■ margarethen ■ tag ■ ward ■ gelegt ■ der ■ erste ■ stain • dies
■ würdigen ■ bawes • in • der ■ ere ■ gotes ■ und ■ der • iungfrawen ■ marie. Eine erste Weihe des Neubaues erfolgte 1469
durch den zuständigen Weihbischof Leonhard von Eichstätt, doch mit der endgültigen Fertigstellung und Ausstattung
der Kirche ist erst 1488, dem Jahr der Wölbung und der Weihe des Hochaltares (5. Mai) zu rechnen (Fig. 134E)4.
1 i. Wappen Gößwein mit Umschrift: /. Katharina Hanns / Rieterin ein
geborne / Göesweinin. / 1583',- dazugehörig 2. Wappen Rieter vermehrt
mit Umschrift: /. Hanns Rieter / zu Korenburg ec. / Ritter /. /1383;-3.
Kopf eines heiligen Kaisers (Karl d. Gr. oder Heinrich) im Lorbeerkranz
mit Beischrift: PAX VOBIS, mutmaßlich Ende 16. Jh.
2 Vgl. Putz, 1914, S. 11, und Heidingsfelder, 1938, S. 158E, Reg. Nr.
497-
3 Nach dem Absterben des erstansässigen Geschlechts der Kalpp oder
Kalbenberger gelangte der Besitz 1282 (Historische Stätten 7, 2i974,
S. 336) an das Prämonstratenserkloster Roggenburg bei Ulm, wo er bis
zum Jahr 1412 verblieb. - Am 4. Januar 1412 erwarb Ludwig im Bart
d.Ä., Graf von Oettingen, Kalbensteinberg und veräußerte den Besitz -
»die Kirche samt Kirchensatz«, also auch das Patronatsrecht, »mit Zehn-
ten und allen Sachen, die dazu gehören«, und »die Vogtei« - noch im sel-
ben Jahr an Agnes Stromerin, die Witwe Ulman Stromers in Nürnberg
(Regesta Boica XII, 109-111,131; teils im Wortlaut abgedruckt bei Putz,
1914, S. 133-136). Im Jahr 1414 fiel Kalbensteinberg durch Erbschaft an
Endres Wernitzer zu Rothenburg o.d.T, durch seine Heirat mit Marga-
rethe, einer Tochter von Ulman und Agnes Stromer. Schließlich kam das
Dorf Kalbensteinberg durch die dritte Ehe von Hans Rieter mit Klara
geb. Wernitzerin (eine Tochter von Endres Wernitzer) in den Besitz des.
Rieterschen Geschlechts, das in der Folgezeit so bedeutend für den Ort
und seine Kirche geworden ist (zusammengefaßt nach Putz, 1914, S. i;f.).
4 Kdm. Bayern, MF VI, 1937, S. 171.