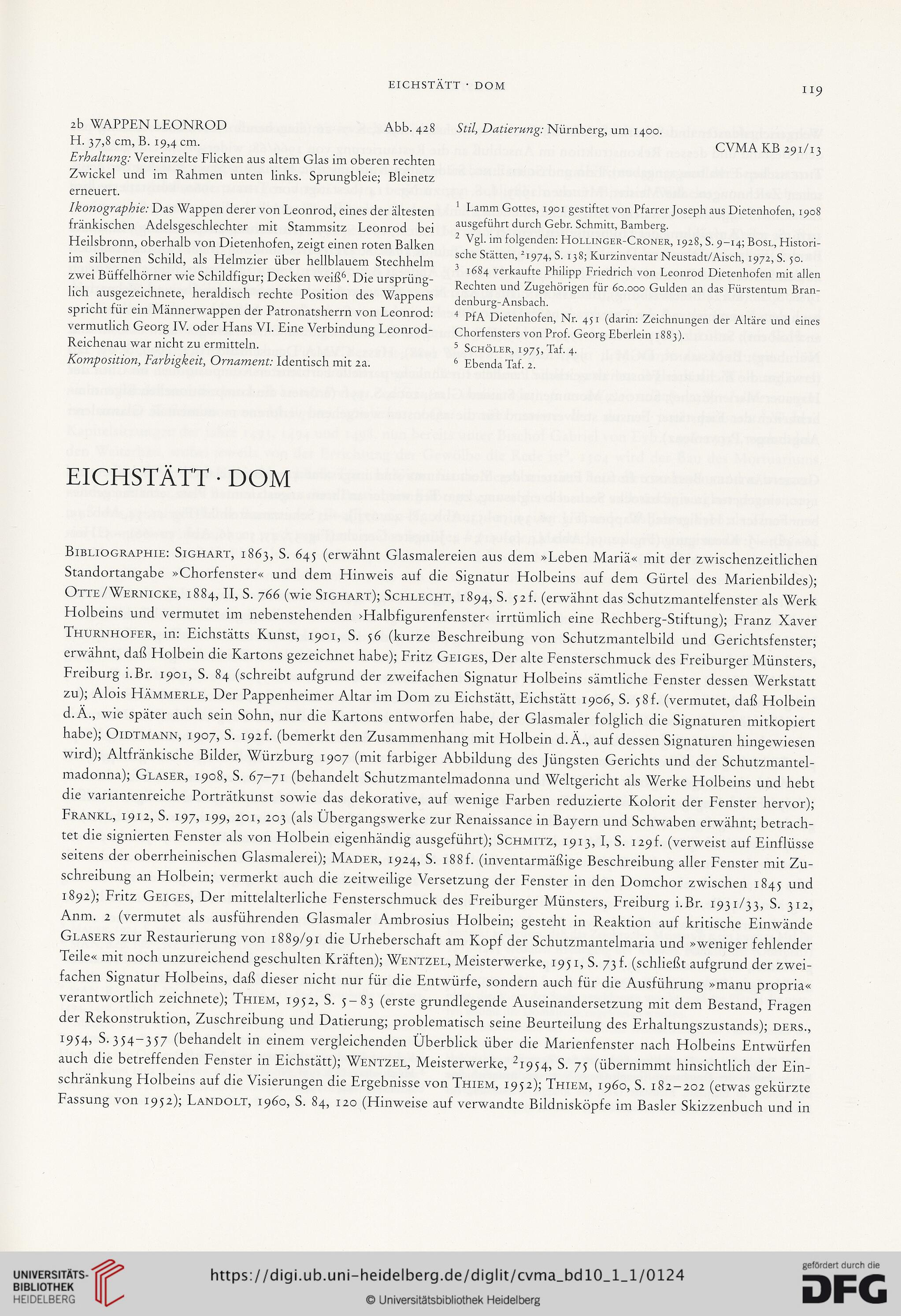EICHSTÄTT • DOM
119
2b WAPPEN LEONROD Abb. 428
H. 37,8 cm, B. 19,4 cm.
Erhaltung: Vereinzelte Flicken aus altem Glas im oberen rechten
Zwickel und im Rahmen unten links. Sprungbleie; Bleinetz
erneuert.
Ikonographie: Das Wappen derer von Leonrod, eines der ältesten
fränkischen Adelsgeschlechter mit Stammsitz Leonrod bei
Heilsbronn, oberhalb von Dietenhofen, zeigt einen roten Balken
im silbernen Schild, als Helmzier über hellblauem Stechhelm
zwei Büffelhörner wie Schildfigur; Decken weiß6. Die ursprüng-
lich ausgezeichnete, heraldisch rechte Position des Wappens
spricht für ein Männerwappen der Patronatsherrn von Leonrod:
vermutlich Georg IV. oder Hans VI. Eine Verbindung Leonrod-
Reichenau war nicht zu ermitteln.
Komposition, Farbigkeit, Ornament: Identisch mit 2a.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1400.
CVMA KB 291/13
1 Lamm Gottes, 1901 gestiftet von Pfarrer Joseph aus Dietenhofen, 1908
ausgeführt durch Gebr. Schmitt, Bamberg.
2 Vgl. im folgenden: Hollinger-Croner, 1928, S. 9-14; Bose, Histori-
sche Stätten, 2i974, S. 138; Kurzinventar Neustadt/Aisch, 1972, S. 50.
3 1684 verkaufte Philipp Friedrich von Leonrod Dietenhofen mit allen
Rechten und Zugehörigen für 60.000 Gulden an das Fürstentum Bran-
denburg-Ansbach.
4 PfA Dietenhofen, Nr. 451 (darin: Zeichnungen der Altäre und eines
Chorfensters von Prof. Georg Eberlein 1883).
5 Schöler, 1975, Taf. 4.
6 Ebenda Taf. 2.
EICHSTÄTT ■ DOM
Bibliographie: Sighart, 1863, S. 645 (erwähnt Glasmalereien aus dem »Leben Mariä« mit der zwischenzeitlichen
Standortangabe »Chorfenster« und dem Hinweis auf die Signatur Holbeins auf dem Gürtel des Marienbildes);
Otte/Wernicke, 1884, II, S. 766 (wie Sighart); Schlecht, 1894, S. 52!. (erwähnt das Schutzmantelfenster als Werk
Holbeins und vermutet im nebenstehenden >Halbfigurenfenster< irrtümlich eine Rechberg-Stiftung); Franz Xaver
Thurnhofer, in: Eichstätts Kunst, 1901, S. 56 (kurze Beschreibung von Schutzmantelbild und Gerichtsfenster;
erwähnt, daß Holbein die Kartons gezeichnet habe); Fritz Geiges, Der alte Fensterschmuck des Freiburger Münsters,
Freiburg i.Br. 1901, S. 84 (schreibt aufgrund der zweifachen Signatur Holbeins sämtliche Fenster dessen Werkstatt
zu); Alois Hämmerle, Der Pappenheimer Altar im Dom zu Eichstätt, Eichstätt 1906, S. 58!. (vermutet, daß Holbein
d.A., wie später auch sein Sohn, nur die Kartons entworfen habe, der Glasmaler folglich die Signaturen mitkopiert
habe); Oidtmann, 1907, S. 192!. (bemerkt den Zusammenhang mit Holbein d.A., auf dessen Signaturen hingewiesen
wird); Altfränkische Bilder, Würzburg 1907 (mit farbiger Abbildung des Jüngsten Gerichts und der Schutzmantel-
madonna); Glaser, 1908, S. 67-71 (behandelt Schutzmantelmadonna und Weltgericht als Werke Holbeins und hebt
die variantenreiche Porträtkunst sowie das dekorative, auf wenige Farben reduzierte Kolorit der Fenster hervor);
Frankl, 1912, S. 197, 199, 201, 203 (als Übergangswerke zur Renaissance in Bayern und Schwaben erwähnt; betrach-
tet die signierten Fenster als von Holbein eigenhändig ausgeführt); Schmitz, 1913, I, S. i2c>f. (verweist auf Einflüsse
seitens der oberrheinischen Glasmalerei); Mader, 1924, S. 188f. (inventarmäßige Beschreibung aller Fenster mit Zu-
schreibung an Holbein; vermerkt auch die zeitweilige Versetzung der Fenster in den Domchor zwischen 1845 und
1892); Fritz Geiges, Der mittelalterliche Fensterschmuck des Freiburger Münsters, Freiburg i.Br. 1931/33, S. 312,
Anm. 2 (vermutet als ausführenden Glasmaler Ambrosius Holbein; gesteht in Reaktion auf kritische Einwände
Glasers zur Restaurierung von 1889/91 die Urheberschaft am Kopf der Schutzmantelmaria und »weniger fehlender
Teile« mit noch unzureichend geschulten Kräften); Wentzel, Meisterwerke, 1951, S. 73 f. (schließt aufgrund der zwei-
fachen Signatur Holbeins, daß dieser nicht nur für die Entwürfe, sondern auch für die Ausführung »manu propria«
verantwortlich zeichnete); Thiem, 1952, S. 5-83 (erste grundlegende Auseinandersetzung mit dem Bestand, Fragen
der Rekonstruktion, Zuschreibung und Datierung; problematisch seine Beurteilung des Erhaltungszustands); ders.,
1954, S. 354—357 (behandelt in einem vergleichenden Überblick über die Marienfenster nach Holbeins Entwürfen
auch die betreffenden Fenster in Eichstätt); Wentzel, Meisterwerke, U954, S. 75 (übernimmt hinsichtlich der Ein-
schränkung Holbeins auf die Visierungen die Ergebnisse von Thiem, 1952); Thiem, 1960, S. 182-202 (etwas gekürzte
Fassung von 1952); Landolt, 1960, S. 84, 120 (Hinweise auf verwandte Bildnisköpfe im Basler Skizzenbuch und in
119
2b WAPPEN LEONROD Abb. 428
H. 37,8 cm, B. 19,4 cm.
Erhaltung: Vereinzelte Flicken aus altem Glas im oberen rechten
Zwickel und im Rahmen unten links. Sprungbleie; Bleinetz
erneuert.
Ikonographie: Das Wappen derer von Leonrod, eines der ältesten
fränkischen Adelsgeschlechter mit Stammsitz Leonrod bei
Heilsbronn, oberhalb von Dietenhofen, zeigt einen roten Balken
im silbernen Schild, als Helmzier über hellblauem Stechhelm
zwei Büffelhörner wie Schildfigur; Decken weiß6. Die ursprüng-
lich ausgezeichnete, heraldisch rechte Position des Wappens
spricht für ein Männerwappen der Patronatsherrn von Leonrod:
vermutlich Georg IV. oder Hans VI. Eine Verbindung Leonrod-
Reichenau war nicht zu ermitteln.
Komposition, Farbigkeit, Ornament: Identisch mit 2a.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1400.
CVMA KB 291/13
1 Lamm Gottes, 1901 gestiftet von Pfarrer Joseph aus Dietenhofen, 1908
ausgeführt durch Gebr. Schmitt, Bamberg.
2 Vgl. im folgenden: Hollinger-Croner, 1928, S. 9-14; Bose, Histori-
sche Stätten, 2i974, S. 138; Kurzinventar Neustadt/Aisch, 1972, S. 50.
3 1684 verkaufte Philipp Friedrich von Leonrod Dietenhofen mit allen
Rechten und Zugehörigen für 60.000 Gulden an das Fürstentum Bran-
denburg-Ansbach.
4 PfA Dietenhofen, Nr. 451 (darin: Zeichnungen der Altäre und eines
Chorfensters von Prof. Georg Eberlein 1883).
5 Schöler, 1975, Taf. 4.
6 Ebenda Taf. 2.
EICHSTÄTT ■ DOM
Bibliographie: Sighart, 1863, S. 645 (erwähnt Glasmalereien aus dem »Leben Mariä« mit der zwischenzeitlichen
Standortangabe »Chorfenster« und dem Hinweis auf die Signatur Holbeins auf dem Gürtel des Marienbildes);
Otte/Wernicke, 1884, II, S. 766 (wie Sighart); Schlecht, 1894, S. 52!. (erwähnt das Schutzmantelfenster als Werk
Holbeins und vermutet im nebenstehenden >Halbfigurenfenster< irrtümlich eine Rechberg-Stiftung); Franz Xaver
Thurnhofer, in: Eichstätts Kunst, 1901, S. 56 (kurze Beschreibung von Schutzmantelbild und Gerichtsfenster;
erwähnt, daß Holbein die Kartons gezeichnet habe); Fritz Geiges, Der alte Fensterschmuck des Freiburger Münsters,
Freiburg i.Br. 1901, S. 84 (schreibt aufgrund der zweifachen Signatur Holbeins sämtliche Fenster dessen Werkstatt
zu); Alois Hämmerle, Der Pappenheimer Altar im Dom zu Eichstätt, Eichstätt 1906, S. 58!. (vermutet, daß Holbein
d.A., wie später auch sein Sohn, nur die Kartons entworfen habe, der Glasmaler folglich die Signaturen mitkopiert
habe); Oidtmann, 1907, S. 192!. (bemerkt den Zusammenhang mit Holbein d.A., auf dessen Signaturen hingewiesen
wird); Altfränkische Bilder, Würzburg 1907 (mit farbiger Abbildung des Jüngsten Gerichts und der Schutzmantel-
madonna); Glaser, 1908, S. 67-71 (behandelt Schutzmantelmadonna und Weltgericht als Werke Holbeins und hebt
die variantenreiche Porträtkunst sowie das dekorative, auf wenige Farben reduzierte Kolorit der Fenster hervor);
Frankl, 1912, S. 197, 199, 201, 203 (als Übergangswerke zur Renaissance in Bayern und Schwaben erwähnt; betrach-
tet die signierten Fenster als von Holbein eigenhändig ausgeführt); Schmitz, 1913, I, S. i2c>f. (verweist auf Einflüsse
seitens der oberrheinischen Glasmalerei); Mader, 1924, S. 188f. (inventarmäßige Beschreibung aller Fenster mit Zu-
schreibung an Holbein; vermerkt auch die zeitweilige Versetzung der Fenster in den Domchor zwischen 1845 und
1892); Fritz Geiges, Der mittelalterliche Fensterschmuck des Freiburger Münsters, Freiburg i.Br. 1931/33, S. 312,
Anm. 2 (vermutet als ausführenden Glasmaler Ambrosius Holbein; gesteht in Reaktion auf kritische Einwände
Glasers zur Restaurierung von 1889/91 die Urheberschaft am Kopf der Schutzmantelmaria und »weniger fehlender
Teile« mit noch unzureichend geschulten Kräften); Wentzel, Meisterwerke, 1951, S. 73 f. (schließt aufgrund der zwei-
fachen Signatur Holbeins, daß dieser nicht nur für die Entwürfe, sondern auch für die Ausführung »manu propria«
verantwortlich zeichnete); Thiem, 1952, S. 5-83 (erste grundlegende Auseinandersetzung mit dem Bestand, Fragen
der Rekonstruktion, Zuschreibung und Datierung; problematisch seine Beurteilung des Erhaltungszustands); ders.,
1954, S. 354—357 (behandelt in einem vergleichenden Überblick über die Marienfenster nach Holbeins Entwürfen
auch die betreffenden Fenster in Eichstätt); Wentzel, Meisterwerke, U954, S. 75 (übernimmt hinsichtlich der Ein-
schränkung Holbeins auf die Visierungen die Ergebnisse von Thiem, 1952); Thiem, 1960, S. 182-202 (etwas gekürzte
Fassung von 1952); Landolt, 1960, S. 84, 120 (Hinweise auf verwandte Bildnisköpfe im Basler Skizzenbuch und in