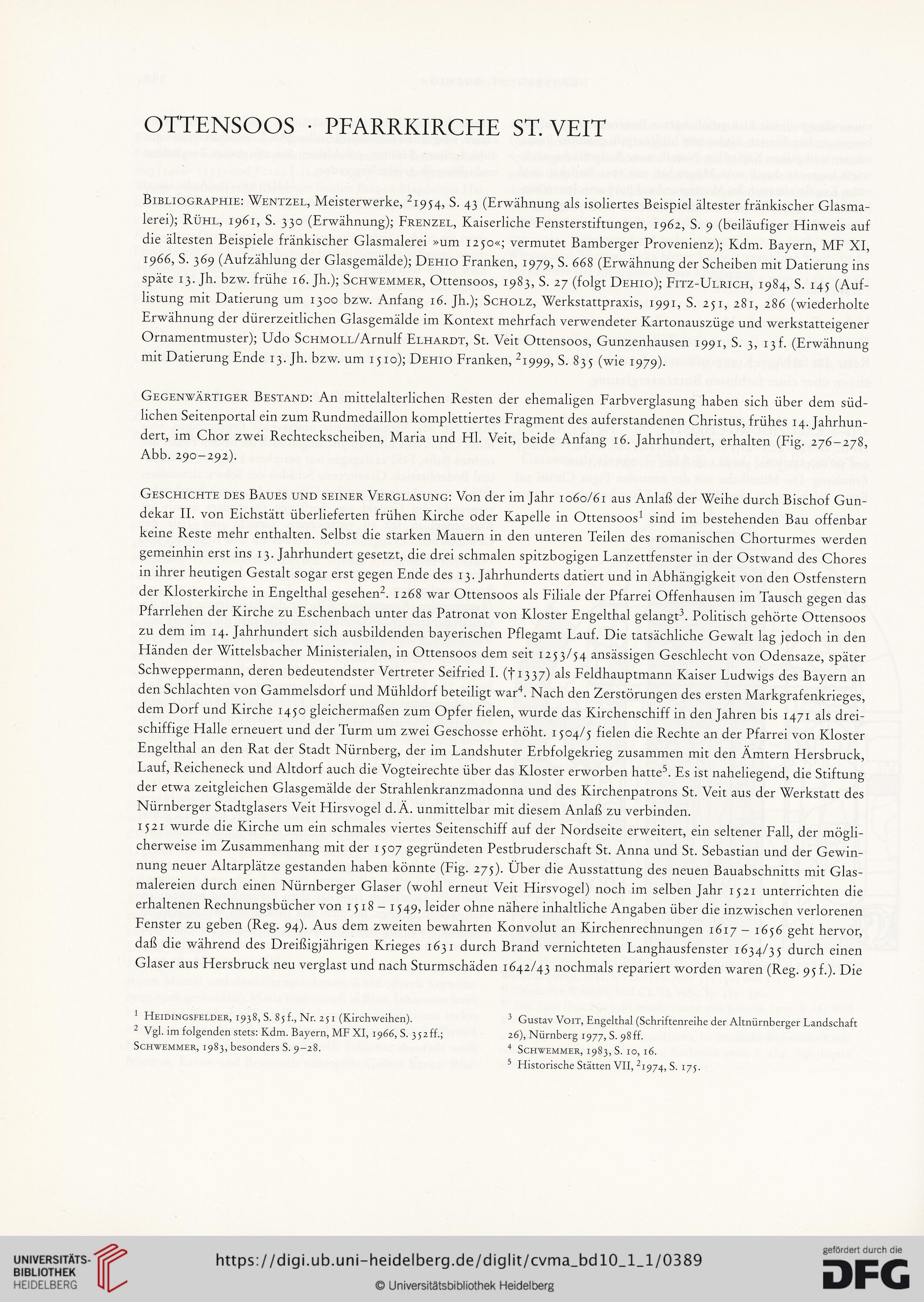OTTENSOOS • PFARRKIRCHE ST. VEIT
Bibliographie: Wentzel, Meisterwerke, 2i954, S. 43 (Erwähnung als isoliertes Beispiel ältester fränkischer Glasma-
lerei); Rühl, 1961, S. 330 (Erwähnung); Frenzel, Kaiserliche Fensterstiftungen, 1962, S. 9 (beiläufiger Hinweis auf
die ältesten Beispiele fränkischer Glasmalerei »um 1250«; vermutet Bamberger Provenienz); Kdm. Bayern, MF XI,
1966, S. 369 (Aufzählung der Glasgemälde); Dehio Franken, 1979, S. 668 (Erwähnung der Scheiben mit Datierung ins
späte 13. Jh. bzw. frühe 16. Jh.); Schwemmer, Ottensoos, 1983, S. 27 (folgt Dehio); Fitz-Ulrich, 1984, S. 145 (Auf-
listung mit Datierung um 1300 bzw. Anfang 16. Jh.); Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 251, 281, 286 (wiederholte
Erwähnung der dürerzeitlichen Glasgemälde im Kontext mehrfach verwendeter Kartonauszüge und werkstatteigener
Ornamentmuster); Udo Schmoll/Arnulf Elhardt, St. Veit Ottensoos, Gunzenhausen 1991, S. 3, 13E (Erwähnung
mit Datierung Ende 13. Jh. bzw. um 1510); Dehio Franken, 2i999, S. 835 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: An mittelalterlichen Resten der ehemaligen Farbverglasung haben sich über dem süd-
lichen Seitenportal ein zum Rundmedaillon komplettiertes Fragment des auferstandenen Christus, frühes 14. Jahrhun-
dert, im Chor zwei Rechteckscheiben, Maria und Hl. Veit, beide Anfang 16. Jahrhundert, erhalten (Fig. 276-278,
Abb. 290-292).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von der im Jahr 1060/61 aus Anlaß der Weihe durch Bischof Gun-
dekar II. von Eichstätt überlieferten frühen Kirche oder Kapelle in Ottensoos1 sind im bestehenden Bau offenbar
keine Reste mehr enthalten. Selbst die starken Mauern in den unteren Teilen des romanischen Chorturmes werden
gemeinhin erst ins 13. Jahrhundert gesetzt, die drei schmalen spitzbogigen Lanzettfenster in der Ostwand des Chores
in ihrer heutigen Gestalt sogar erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts datiert und in Abhängigkeit von den Ostfenstern
der Klosterkirche in Engelthal gesehen2. 1268 war Ottensoos als Filiale der Pfarrei Offenhausen im Tausch gegen das
Pfarrlehen der Kirche zu Eschenbach unter das Patronat von Kloster Engelthal gelangt3. Politisch gehörte Ottensoos
zu dem im 14. Jahrhundert sich ausbildenden bayerischen Pflegamt Lauf. Die tatsächliche Gewalt lag jedoch in den
Händen der Wittelsbacher Ministerialen, in Ottensoos dem seit 1253/54 ansässigen Geschlecht von Odensaze, später
Schweppermann, deren bedeutendster Vertreter Seifried I. ("t 1337) als Feldhauptmann Kaiser Ludwigs des Bayern an
den Schlachten von Gammelsdorf und Mühldorf beteiligt war4. Nach den Zerstörungen des ersten Markgrafenkrieges,
dem Dorf und Kirche 1450 gleichermaßen zum Opfer fielen, wurde das Kirchenschiff in den Jahren bis 1471 als drei-
schiffige Halle erneuert und der Turm um zwei Geschosse erhöht. 1504/5 fielen die Rechte an der Pfarrei von Kloster
Engelthal an den Rat der Stadt Nürnberg, der im Landshuter Erbfolgekrieg zusammen mit den Ämtern Hersbruck,
Lauf, Reicheneck und Altdorf auch die Vogteirechte über das Kloster erworben hatte5. Es ist naheliegend, die Stiftung
der etwa zeitgleichen Glasgemälde der Strahlenkranzmadonna und des Kirchenpatrons St. Veit aus der Werkstatt des
Nürnberger Stadtglasers Veit Hirsvogel d.Ä. unmittelbar mit diesem Anlaß zu verbinden.
1521 wurde die Kirche um ein schmales viertes Seitenschiff auf der Nordseite erweitert, ein seltener Fall, der mögli-
cherweise im Zusammenhang mit der 1507 gegründeten Pestbruderschaft St. Anna und St. Sebastian und der Gewin-
nung neuer Altarplätze gestanden haben könnte (Fig. 275). Uber die Ausstattung des neuen Bauabschnitts mit Glas-
malereien durch einen Nürnberger Glaser (wohl erneut Veit Hirsvogel) noch im selben Jahr 1521 unterrichten die
erhaltenen Rechnungsbücher von 1518- 1549, leider ohne nähere inhaltliche Angaben über die inzwischen verlorenen
Fenster zu geben (Reg. 94). Aus dem zweiten bewahrten Konvolut an Kirchenrechnungen 1617 - 1656 geht hervor,
daß die während des Dreißigjährigen Krieges 1631 durch Brand vernichteten Langhausfenster 1634/35 durch einen
Glaser aus Hersbruck neu verglast und nach Sturmschäden 1642/43 nochmals repariert worden waren (Reg. 95 f.). Die
1 Heidingsfelder, 1938, S. 85f., Nr. 251 (Kirchweihen).
2 Vgl. im folgenden stets: Kdm. Bayern, MF XI, 1966, S. 3 5 2. ff.;
Schwemmer, 1983, besonders S. 9-28.
3 Gustav Voit, Engelthal (Schriftenreihe der Altnürnberger Landschaft
26), Nürnberg 1977, S. 98 ff.
4 Schwemmer, 1983,5. 10, 16.
5 Historische Stätten VII, 21974, S. 175.
Bibliographie: Wentzel, Meisterwerke, 2i954, S. 43 (Erwähnung als isoliertes Beispiel ältester fränkischer Glasma-
lerei); Rühl, 1961, S. 330 (Erwähnung); Frenzel, Kaiserliche Fensterstiftungen, 1962, S. 9 (beiläufiger Hinweis auf
die ältesten Beispiele fränkischer Glasmalerei »um 1250«; vermutet Bamberger Provenienz); Kdm. Bayern, MF XI,
1966, S. 369 (Aufzählung der Glasgemälde); Dehio Franken, 1979, S. 668 (Erwähnung der Scheiben mit Datierung ins
späte 13. Jh. bzw. frühe 16. Jh.); Schwemmer, Ottensoos, 1983, S. 27 (folgt Dehio); Fitz-Ulrich, 1984, S. 145 (Auf-
listung mit Datierung um 1300 bzw. Anfang 16. Jh.); Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 251, 281, 286 (wiederholte
Erwähnung der dürerzeitlichen Glasgemälde im Kontext mehrfach verwendeter Kartonauszüge und werkstatteigener
Ornamentmuster); Udo Schmoll/Arnulf Elhardt, St. Veit Ottensoos, Gunzenhausen 1991, S. 3, 13E (Erwähnung
mit Datierung Ende 13. Jh. bzw. um 1510); Dehio Franken, 2i999, S. 835 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: An mittelalterlichen Resten der ehemaligen Farbverglasung haben sich über dem süd-
lichen Seitenportal ein zum Rundmedaillon komplettiertes Fragment des auferstandenen Christus, frühes 14. Jahrhun-
dert, im Chor zwei Rechteckscheiben, Maria und Hl. Veit, beide Anfang 16. Jahrhundert, erhalten (Fig. 276-278,
Abb. 290-292).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Von der im Jahr 1060/61 aus Anlaß der Weihe durch Bischof Gun-
dekar II. von Eichstätt überlieferten frühen Kirche oder Kapelle in Ottensoos1 sind im bestehenden Bau offenbar
keine Reste mehr enthalten. Selbst die starken Mauern in den unteren Teilen des romanischen Chorturmes werden
gemeinhin erst ins 13. Jahrhundert gesetzt, die drei schmalen spitzbogigen Lanzettfenster in der Ostwand des Chores
in ihrer heutigen Gestalt sogar erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts datiert und in Abhängigkeit von den Ostfenstern
der Klosterkirche in Engelthal gesehen2. 1268 war Ottensoos als Filiale der Pfarrei Offenhausen im Tausch gegen das
Pfarrlehen der Kirche zu Eschenbach unter das Patronat von Kloster Engelthal gelangt3. Politisch gehörte Ottensoos
zu dem im 14. Jahrhundert sich ausbildenden bayerischen Pflegamt Lauf. Die tatsächliche Gewalt lag jedoch in den
Händen der Wittelsbacher Ministerialen, in Ottensoos dem seit 1253/54 ansässigen Geschlecht von Odensaze, später
Schweppermann, deren bedeutendster Vertreter Seifried I. ("t 1337) als Feldhauptmann Kaiser Ludwigs des Bayern an
den Schlachten von Gammelsdorf und Mühldorf beteiligt war4. Nach den Zerstörungen des ersten Markgrafenkrieges,
dem Dorf und Kirche 1450 gleichermaßen zum Opfer fielen, wurde das Kirchenschiff in den Jahren bis 1471 als drei-
schiffige Halle erneuert und der Turm um zwei Geschosse erhöht. 1504/5 fielen die Rechte an der Pfarrei von Kloster
Engelthal an den Rat der Stadt Nürnberg, der im Landshuter Erbfolgekrieg zusammen mit den Ämtern Hersbruck,
Lauf, Reicheneck und Altdorf auch die Vogteirechte über das Kloster erworben hatte5. Es ist naheliegend, die Stiftung
der etwa zeitgleichen Glasgemälde der Strahlenkranzmadonna und des Kirchenpatrons St. Veit aus der Werkstatt des
Nürnberger Stadtglasers Veit Hirsvogel d.Ä. unmittelbar mit diesem Anlaß zu verbinden.
1521 wurde die Kirche um ein schmales viertes Seitenschiff auf der Nordseite erweitert, ein seltener Fall, der mögli-
cherweise im Zusammenhang mit der 1507 gegründeten Pestbruderschaft St. Anna und St. Sebastian und der Gewin-
nung neuer Altarplätze gestanden haben könnte (Fig. 275). Uber die Ausstattung des neuen Bauabschnitts mit Glas-
malereien durch einen Nürnberger Glaser (wohl erneut Veit Hirsvogel) noch im selben Jahr 1521 unterrichten die
erhaltenen Rechnungsbücher von 1518- 1549, leider ohne nähere inhaltliche Angaben über die inzwischen verlorenen
Fenster zu geben (Reg. 94). Aus dem zweiten bewahrten Konvolut an Kirchenrechnungen 1617 - 1656 geht hervor,
daß die während des Dreißigjährigen Krieges 1631 durch Brand vernichteten Langhausfenster 1634/35 durch einen
Glaser aus Hersbruck neu verglast und nach Sturmschäden 1642/43 nochmals repariert worden waren (Reg. 95 f.). Die
1 Heidingsfelder, 1938, S. 85f., Nr. 251 (Kirchweihen).
2 Vgl. im folgenden stets: Kdm. Bayern, MF XI, 1966, S. 3 5 2. ff.;
Schwemmer, 1983, besonders S. 9-28.
3 Gustav Voit, Engelthal (Schriftenreihe der Altnürnberger Landschaft
26), Nürnberg 1977, S. 98 ff.
4 Schwemmer, 1983,5. 10, 16.
5 Historische Stätten VII, 21974, S. 175.