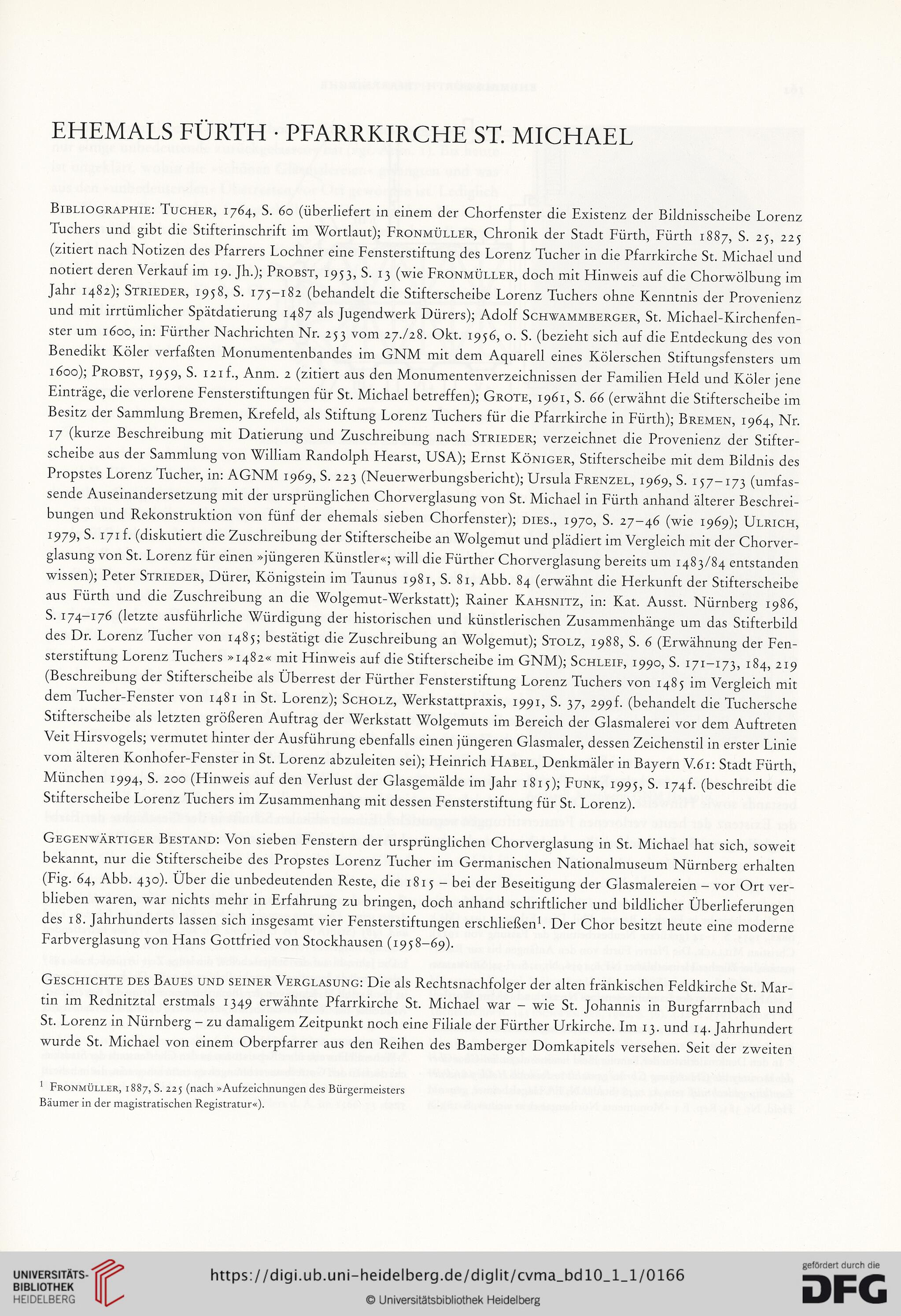EHEMALS FÜRTH ■ PFARRKIRCHE ST. MICHAEL
Bibliographie: Tücher, 1764, S. 60 (überliefert in einem der Chorfenster die Existenz der Bildnisscheibe Lorenz
Tuchers und gibt die Stifterinschrift im Wortlaut); Fronmüller, Chronik der Stadt Fürth, Fürth 1887, S. 25, 225
(zitiert nach Notizen des Pfarrers Lochner eine Fensterstiftung des Lorenz Tücher in die Pfarrkirche St. Michael und
notiert deren Verkauf im 19. Jh.); Probst, 1953, S. 13 (wie Fronmüller, doch mit Hinweis auf die Chorwölbung im
Jahr 1482); Strieder, 1958, S. 175-182 (behandelt die Stifterscheibe Lorenz Tuchers ohne Kenntnis der Provenienz
und mit irrtümlicher Spätdatierung 1487 als Jugendwerk Dürers); Adolf Schwammberger, St. Michael-Kirchenfen-
ster um 1600, in: Fürther Nachrichten Nr. 253 vom 27.728. Okt. 1956, o. S. (bezieht sich auf die Entdeckung des von
Benedikt Köler verfaßten Monumentenbandes im GNM mit dem Aquarell eines Kölerschen Stiftungsfensters um
1600); Probst, 1959, S. 12if., Anm. 2 (zitiert aus den Monumentenverzeichnissen der Familien Held und Köler jene
Einträge, die verlorene Fensterstiftungen für St. Michael betreffen); Grote, 1961, S. 66 (erwähnt die Stifterscheibe im
Besitz der Sammlung Bremen, Krefeld, als Stiftung Lorenz Tuchers für die Pfarrkirche in Fürth); Bremen, 1964, Nr.
17 (kurze Beschreibung mit Datierung und Zuschreibung nach Strieder; verzeichnet die Provenienz der Stifter-
scheibe aus der Sammlung von William Randolph Hearst, USA); Ernst Königer, Stifterscheibe mit dem Bildnis des
Propstes Lorenz Tücher, in: AGNM 1969, S. 223 (Neuerwerbungsbericht); Ursula Frenzel, 1969, S. 157-173 (umfas-
sende Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Chorverglasung von St. Michael in Fürth anhand älterer Beschrei-
bungen und Rekonstruktion von fünf der ehemals sieben Chorfenster); dies., 1970, S. 27-46 (wie 1969); Ulrich,
1979, S. 171 f. (diskutiert die Zuschreibung der Stifterscheibe an Wolgemut und plädiert im Vergleich mit der Chorver-
glasung von St. Lorenz für einen »jüngeren Künstler«; will die Fürther Chorverglasung bereits um 1483/84 entstanden
wissen); Peter Strieder, Dürer, Königstein im Taunus 1981, S. 81, Abb. 84 (erwähnt die Herkunft der Stifterscheibe
aus Fürth und die Zuschreibung an die Wolgemut-Werkstatt); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1986,
S. 174-176 (letzte ausführliche Würdigung der historischen und künstlerischen Zusammenhänge um das Stifterbild
des Dr. Lorenz Tücher von 1485; bestätigt die Zuschreibung an Wolgemut); Stolz, 1988, S. 6 (Erwähnung der Fen-
sterstiftung Lorenz Tuchers »1482« mit Hinweis auf die Stifterscheibe im GNM); Schleif, 1990, S. 171-173, 184, 219
(Beschreibung der Stifterscheibe als Überrest der Fürther Fensterstiftung Lorenz Tuchers von 1485 im Vergleich mit
dem Tucher-Fenster von 1481 in St. Lorenz); Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 37, 299f. (behandelt die Tuchersche
Stifterscheibe als letzten größeren Auftrag der Werkstatt Wolgemuts im Bereich der Glasmalerei vor dem Auftreten
Veit Hirsvogels; vermutet hinter der Ausführung ebenfalls einen jüngeren Glasmaler, dessen Zeichenstil in erster Linie
vom älteren Konhofer-Fenster in St. Lorenz abzuleiten sei); Heinrich Habel, Denkmäler in Bayern V.61: Stadt Fürth,
München 1994, S. 200 (Hinweis auf den Verlust der Glasgemälde im Jahr 1815); Funk, 1995, S. 174!. (beschreibt die
Stifterscheibe Lorenz Tuchers im Zusammenhang mit dessen Fensterstiftung für St. Lorenz).
Gegenwärtiger Bestand: Von sieben Fenstern der ursprünglichen Chorverglasung in St. Michael hat sich, soweit
bekannt, nur die Stifterscheibe des Propstes Lorenz Tücher im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg erhalten
(Fig. 64, Abb. 430). Über die unbedeutenden Reste, die 1815 - bei der Beseitigung der Glasmalereien - vor Ort ver-
blieben waren, war nichts mehr in Erfahrung zu bringen, doch anhand schriftlicher und bildlicher Überlieferungen
des 18. Jahrhunderts lassen sich insgesamt vier Fensterstiftungen erschließen1. Der Chor besitzt heute eine moderne
Farbverglasung von Hans Gottfried von Stockhausen (1958-69).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die als Rechtsnachfolger der alten fränkischen Feldkirche St. Mar-
tin im Rednitztal erstmals 1349 erwähnte Pfarrkirche St. Michael war - wie St. Johannis in Burgfarrnbach und
St. Lorenz in Nürnberg - zu damaligem Zeitpunkt noch eine Filiale der Fürther Urkirche. Im 13. und 14. Jahrhundert
wurde St. Michael von einem Oberpfarrer aus den Reihen des Bamberger Domkapitels versehen. Seit der zweiten
1 Fronmüller, 1887, S. 225 (nach »Aufzeichnungen des Bürgermeisters
Bäumer in der magistratischen Registratur«).
Bibliographie: Tücher, 1764, S. 60 (überliefert in einem der Chorfenster die Existenz der Bildnisscheibe Lorenz
Tuchers und gibt die Stifterinschrift im Wortlaut); Fronmüller, Chronik der Stadt Fürth, Fürth 1887, S. 25, 225
(zitiert nach Notizen des Pfarrers Lochner eine Fensterstiftung des Lorenz Tücher in die Pfarrkirche St. Michael und
notiert deren Verkauf im 19. Jh.); Probst, 1953, S. 13 (wie Fronmüller, doch mit Hinweis auf die Chorwölbung im
Jahr 1482); Strieder, 1958, S. 175-182 (behandelt die Stifterscheibe Lorenz Tuchers ohne Kenntnis der Provenienz
und mit irrtümlicher Spätdatierung 1487 als Jugendwerk Dürers); Adolf Schwammberger, St. Michael-Kirchenfen-
ster um 1600, in: Fürther Nachrichten Nr. 253 vom 27.728. Okt. 1956, o. S. (bezieht sich auf die Entdeckung des von
Benedikt Köler verfaßten Monumentenbandes im GNM mit dem Aquarell eines Kölerschen Stiftungsfensters um
1600); Probst, 1959, S. 12if., Anm. 2 (zitiert aus den Monumentenverzeichnissen der Familien Held und Köler jene
Einträge, die verlorene Fensterstiftungen für St. Michael betreffen); Grote, 1961, S. 66 (erwähnt die Stifterscheibe im
Besitz der Sammlung Bremen, Krefeld, als Stiftung Lorenz Tuchers für die Pfarrkirche in Fürth); Bremen, 1964, Nr.
17 (kurze Beschreibung mit Datierung und Zuschreibung nach Strieder; verzeichnet die Provenienz der Stifter-
scheibe aus der Sammlung von William Randolph Hearst, USA); Ernst Königer, Stifterscheibe mit dem Bildnis des
Propstes Lorenz Tücher, in: AGNM 1969, S. 223 (Neuerwerbungsbericht); Ursula Frenzel, 1969, S. 157-173 (umfas-
sende Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Chorverglasung von St. Michael in Fürth anhand älterer Beschrei-
bungen und Rekonstruktion von fünf der ehemals sieben Chorfenster); dies., 1970, S. 27-46 (wie 1969); Ulrich,
1979, S. 171 f. (diskutiert die Zuschreibung der Stifterscheibe an Wolgemut und plädiert im Vergleich mit der Chorver-
glasung von St. Lorenz für einen »jüngeren Künstler«; will die Fürther Chorverglasung bereits um 1483/84 entstanden
wissen); Peter Strieder, Dürer, Königstein im Taunus 1981, S. 81, Abb. 84 (erwähnt die Herkunft der Stifterscheibe
aus Fürth und die Zuschreibung an die Wolgemut-Werkstatt); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1986,
S. 174-176 (letzte ausführliche Würdigung der historischen und künstlerischen Zusammenhänge um das Stifterbild
des Dr. Lorenz Tücher von 1485; bestätigt die Zuschreibung an Wolgemut); Stolz, 1988, S. 6 (Erwähnung der Fen-
sterstiftung Lorenz Tuchers »1482« mit Hinweis auf die Stifterscheibe im GNM); Schleif, 1990, S. 171-173, 184, 219
(Beschreibung der Stifterscheibe als Überrest der Fürther Fensterstiftung Lorenz Tuchers von 1485 im Vergleich mit
dem Tucher-Fenster von 1481 in St. Lorenz); Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 37, 299f. (behandelt die Tuchersche
Stifterscheibe als letzten größeren Auftrag der Werkstatt Wolgemuts im Bereich der Glasmalerei vor dem Auftreten
Veit Hirsvogels; vermutet hinter der Ausführung ebenfalls einen jüngeren Glasmaler, dessen Zeichenstil in erster Linie
vom älteren Konhofer-Fenster in St. Lorenz abzuleiten sei); Heinrich Habel, Denkmäler in Bayern V.61: Stadt Fürth,
München 1994, S. 200 (Hinweis auf den Verlust der Glasgemälde im Jahr 1815); Funk, 1995, S. 174!. (beschreibt die
Stifterscheibe Lorenz Tuchers im Zusammenhang mit dessen Fensterstiftung für St. Lorenz).
Gegenwärtiger Bestand: Von sieben Fenstern der ursprünglichen Chorverglasung in St. Michael hat sich, soweit
bekannt, nur die Stifterscheibe des Propstes Lorenz Tücher im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg erhalten
(Fig. 64, Abb. 430). Über die unbedeutenden Reste, die 1815 - bei der Beseitigung der Glasmalereien - vor Ort ver-
blieben waren, war nichts mehr in Erfahrung zu bringen, doch anhand schriftlicher und bildlicher Überlieferungen
des 18. Jahrhunderts lassen sich insgesamt vier Fensterstiftungen erschließen1. Der Chor besitzt heute eine moderne
Farbverglasung von Hans Gottfried von Stockhausen (1958-69).
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die als Rechtsnachfolger der alten fränkischen Feldkirche St. Mar-
tin im Rednitztal erstmals 1349 erwähnte Pfarrkirche St. Michael war - wie St. Johannis in Burgfarrnbach und
St. Lorenz in Nürnberg - zu damaligem Zeitpunkt noch eine Filiale der Fürther Urkirche. Im 13. und 14. Jahrhundert
wurde St. Michael von einem Oberpfarrer aus den Reihen des Bamberger Domkapitels versehen. Seit der zweiten
1 Fronmüller, 1887, S. 225 (nach »Aufzeichnungen des Bürgermeisters
Bäumer in der magistratischen Registratur«).