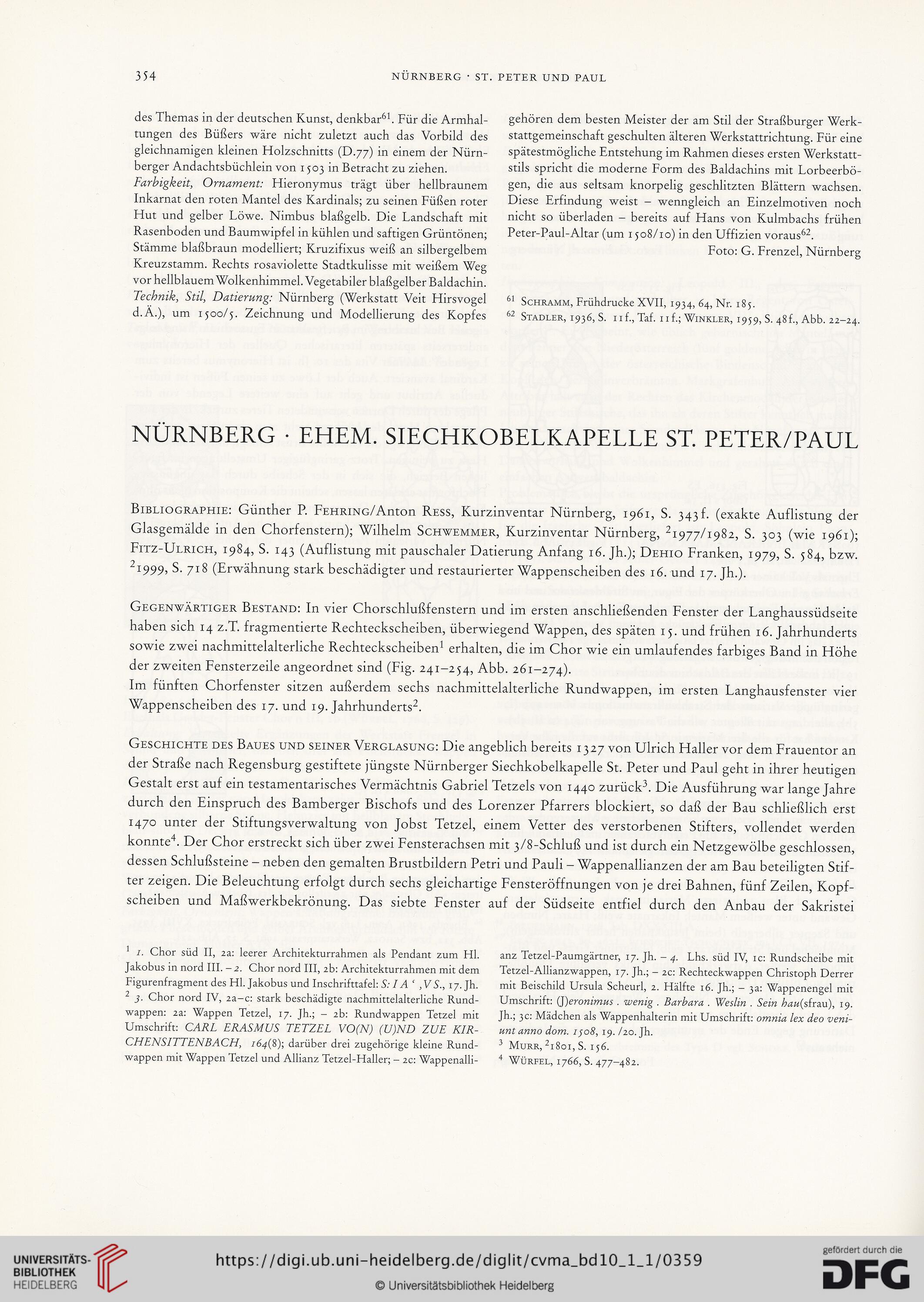354
NÜRNBERG • ST. PETER UND PAUL
des Themas in der deutschen Kunst, denkbar61. Für die Armhal-
tungen des Büßers wäre nicht zuletzt auch das Vorbild des
gleichnamigen kleinen Holzschnitts (D.77) in einem der Nürn-
berger Andachtsbüchlein von 1503 in Betracht zu ziehen.
Farbigkeit, Ornament: Hieronymus trägt über hellbraunem
Inkarnat den roten Mantel des Kardinals; zu seinen Füßen roter
Hut und gelber Löwe. Nimbus blaßgelb. Die Landschaft mit
Rasenboden und Baumwipfel in kühlen und saftigen Grüntönen;
Stämme blaßbraun modelliert; Kruzifixus weiß an silbergelbem
Kreuzstamm. Rechts rosaviolette Stadtkulisse mit weißem Weg
vor hellblauem Wolkenhimmel. Vegetabiler blaßgelber Baldachin.
Technik, Stil, Datierung: Nürnberg (Werkstatt Veit Hirsvogel
d.Ä.), um 1500/5. Zeichnung und Modellierung des Kopfes
gehören dem besten Meister der am Stil der Straßburger Werk-
stattgemeinschaft geschulten älteren Werkstattrichtung. Für eine
spätestmögliche Entstehung im Rahmen dieses ersten Werkstatt-
stils spricht die moderne Form des Baldachins mit Lorbeerbö-
gen, die aus seltsam knorpelig geschlitzten Blättern wachsen.
Diese Erfindung weist - wenngleich an Einzelmotiven noch
nicht so überladen - bereits auf Hans von Kulmbachs frühen
Peter-Paul-Altar (um 1508/10) in den Uffizien voraus62.
Foto: G. Frenzei, Nürnberg
61 Schramm, Frühdrucke XVII, 1934, 64, Nr. 185.
62 Stadler, 1936, S. 11 f., Taf. 11 f.; Winkler, 1959, S. 48L, Abb. 22-24.
NÜRNBERG • EHEM. SIECHKOBELKAPELLE ST. PETER/PAUL
Bibliographie: Günther P. FEHRiNG/Anton Ress, Kurzinventar Nürnberg, 1961, S. 343 f. (exakte Auflistung der
Glasgemälde in den Chorfenstern); Wilhelm Schwemmer, Kurzinventar Nürnberg, 1 2i977/1982, S. 303 (wie 1961);
Fitz-Ulrich, 1984, S. 143 (Auflistung mit pauschaler Datierung Anfang 16. Jh.); Dehio Franken, 1979, S. 584, bzw.
2i999, S. 718 (Erwähnung stark beschädigter und restaurierter Wappenscheiben des 16. und 17. Jh.).
Gegenwärtiger Bestand: In vier Chorschlußfenstern und im ersten anschließenden Fenster der Langhaussüdseite
haben sich 14 z.T. fragmentierte Rechteckscheiben, überwiegend Wappen, des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts
sowie zwei nachmittelalterliche Rechteckscheiben1 erhalten, die im Chor wie ein umlaufendes farbiges Band in Höhe
der zweiten Fensterzeile angeordnet sind (Fig. 241-254, Abb. 261-274).
Im fünften Chorfenster sitzen außerdem sechs nachmittelalterliche Rundwappen, im ersten Langhausfenster vier
Wappenscheiben des 17. und 19. Jahrhunderts2.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die angeblich bereits 1327 von Ulrich Haller vor dem Frauentor an
der Straße nach Regensburg gestiftete jüngste Nürnberger Siechkobelkapelle St. Peter und Paul geht in ihrer heutigen
Gestalt erst auf ein testamentarisches Vermächtnis Gabriel Tetzeis von 1440 zurück3. Die Ausführung war lange Jahre
durch den Einspruch des Bamberger Bischofs und des Lorenzer Pfarrers blockiert, so daß der Bau schließlich erst
1470 unter der Stiftungsverwaltung von Jobst Tetzel, einem Vetter des verstorbenen Stifters, vollendet werden
konnte4. Der Chor erstreckt sich über zwei Fensterachsen mit 3/8-Schluß und ist durch ein Netzgewölbe geschlossen,
dessen Schlußsteine - neben den gemalten Brustbildern Petri und Pauli - Wappenallianzen der am Bau beteiligten Stif-
ter zeigen. Die Beleuchtung erfolgt durch sechs gleichartige Fensteröffnungen von je drei Bahnen, fünf Zeilen, Kopf-
scheiben und Maßwerkbekrönung. Das siebte Fenster auf der Südseite entfiel durch den Anbau der Sakristei
1 1. Chor süd II, 2a: leerer Architekturrahmen als Pendant zum Hl.
Jakobus in nord III. - 2. Chor nord III, 2b: Architekturrahmen mit dem
Figurenfragment des Hl. Jakobus und Inschrifttafel: S: IA ‘ ,V S., 17. Jh.
2 j. Chor nord IV, 2a-c: stark beschädigte nachmittelalterliche Rund-
wappen: 2a: Wappen Tetzel, 17. Jh.; - 2b: Rundwappen Tetzel mit
Umschrift: CARL ERASMUS TETZEL VO(N) (U)ND ZUE KIR-
CHENSITTENBACH, l64(8y, darüber drei zugehörige kleine Rund-
wappen mit Wappen Tetzel und Allianz Tetzel-Haller; - 2c: Wappenalli-
anz Tetzel-Paumgärtner, 17. Jh. - 4. Lhs. süd IV, ic: Rundscheibe mit
Tetzel-Allianzwappen, 17. Jh.; - 2c: Rechteckwappen Christoph Derrer
mit Beischild Ursula Scheuri, 2. Hälfte 16. Jh.; - 3a: Wappenengel mit
Umschrift: Q'jeronimus . wenig . Barbara . Weslin . Sein hau(sfrau), 19.
Jh.; 3c: Mädchen als Wappenhalterin mit Umschrift: omnia lex deo veni-
unt anno dom. 1508, 19. /20. Jh.
3 Murr, 2i8oi, S. 156.
4 Würfel, 1766, S. 477-482.
NÜRNBERG • ST. PETER UND PAUL
des Themas in der deutschen Kunst, denkbar61. Für die Armhal-
tungen des Büßers wäre nicht zuletzt auch das Vorbild des
gleichnamigen kleinen Holzschnitts (D.77) in einem der Nürn-
berger Andachtsbüchlein von 1503 in Betracht zu ziehen.
Farbigkeit, Ornament: Hieronymus trägt über hellbraunem
Inkarnat den roten Mantel des Kardinals; zu seinen Füßen roter
Hut und gelber Löwe. Nimbus blaßgelb. Die Landschaft mit
Rasenboden und Baumwipfel in kühlen und saftigen Grüntönen;
Stämme blaßbraun modelliert; Kruzifixus weiß an silbergelbem
Kreuzstamm. Rechts rosaviolette Stadtkulisse mit weißem Weg
vor hellblauem Wolkenhimmel. Vegetabiler blaßgelber Baldachin.
Technik, Stil, Datierung: Nürnberg (Werkstatt Veit Hirsvogel
d.Ä.), um 1500/5. Zeichnung und Modellierung des Kopfes
gehören dem besten Meister der am Stil der Straßburger Werk-
stattgemeinschaft geschulten älteren Werkstattrichtung. Für eine
spätestmögliche Entstehung im Rahmen dieses ersten Werkstatt-
stils spricht die moderne Form des Baldachins mit Lorbeerbö-
gen, die aus seltsam knorpelig geschlitzten Blättern wachsen.
Diese Erfindung weist - wenngleich an Einzelmotiven noch
nicht so überladen - bereits auf Hans von Kulmbachs frühen
Peter-Paul-Altar (um 1508/10) in den Uffizien voraus62.
Foto: G. Frenzei, Nürnberg
61 Schramm, Frühdrucke XVII, 1934, 64, Nr. 185.
62 Stadler, 1936, S. 11 f., Taf. 11 f.; Winkler, 1959, S. 48L, Abb. 22-24.
NÜRNBERG • EHEM. SIECHKOBELKAPELLE ST. PETER/PAUL
Bibliographie: Günther P. FEHRiNG/Anton Ress, Kurzinventar Nürnberg, 1961, S. 343 f. (exakte Auflistung der
Glasgemälde in den Chorfenstern); Wilhelm Schwemmer, Kurzinventar Nürnberg, 1 2i977/1982, S. 303 (wie 1961);
Fitz-Ulrich, 1984, S. 143 (Auflistung mit pauschaler Datierung Anfang 16. Jh.); Dehio Franken, 1979, S. 584, bzw.
2i999, S. 718 (Erwähnung stark beschädigter und restaurierter Wappenscheiben des 16. und 17. Jh.).
Gegenwärtiger Bestand: In vier Chorschlußfenstern und im ersten anschließenden Fenster der Langhaussüdseite
haben sich 14 z.T. fragmentierte Rechteckscheiben, überwiegend Wappen, des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts
sowie zwei nachmittelalterliche Rechteckscheiben1 erhalten, die im Chor wie ein umlaufendes farbiges Band in Höhe
der zweiten Fensterzeile angeordnet sind (Fig. 241-254, Abb. 261-274).
Im fünften Chorfenster sitzen außerdem sechs nachmittelalterliche Rundwappen, im ersten Langhausfenster vier
Wappenscheiben des 17. und 19. Jahrhunderts2.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Die angeblich bereits 1327 von Ulrich Haller vor dem Frauentor an
der Straße nach Regensburg gestiftete jüngste Nürnberger Siechkobelkapelle St. Peter und Paul geht in ihrer heutigen
Gestalt erst auf ein testamentarisches Vermächtnis Gabriel Tetzeis von 1440 zurück3. Die Ausführung war lange Jahre
durch den Einspruch des Bamberger Bischofs und des Lorenzer Pfarrers blockiert, so daß der Bau schließlich erst
1470 unter der Stiftungsverwaltung von Jobst Tetzel, einem Vetter des verstorbenen Stifters, vollendet werden
konnte4. Der Chor erstreckt sich über zwei Fensterachsen mit 3/8-Schluß und ist durch ein Netzgewölbe geschlossen,
dessen Schlußsteine - neben den gemalten Brustbildern Petri und Pauli - Wappenallianzen der am Bau beteiligten Stif-
ter zeigen. Die Beleuchtung erfolgt durch sechs gleichartige Fensteröffnungen von je drei Bahnen, fünf Zeilen, Kopf-
scheiben und Maßwerkbekrönung. Das siebte Fenster auf der Südseite entfiel durch den Anbau der Sakristei
1 1. Chor süd II, 2a: leerer Architekturrahmen als Pendant zum Hl.
Jakobus in nord III. - 2. Chor nord III, 2b: Architekturrahmen mit dem
Figurenfragment des Hl. Jakobus und Inschrifttafel: S: IA ‘ ,V S., 17. Jh.
2 j. Chor nord IV, 2a-c: stark beschädigte nachmittelalterliche Rund-
wappen: 2a: Wappen Tetzel, 17. Jh.; - 2b: Rundwappen Tetzel mit
Umschrift: CARL ERASMUS TETZEL VO(N) (U)ND ZUE KIR-
CHENSITTENBACH, l64(8y, darüber drei zugehörige kleine Rund-
wappen mit Wappen Tetzel und Allianz Tetzel-Haller; - 2c: Wappenalli-
anz Tetzel-Paumgärtner, 17. Jh. - 4. Lhs. süd IV, ic: Rundscheibe mit
Tetzel-Allianzwappen, 17. Jh.; - 2c: Rechteckwappen Christoph Derrer
mit Beischild Ursula Scheuri, 2. Hälfte 16. Jh.; - 3a: Wappenengel mit
Umschrift: Q'jeronimus . wenig . Barbara . Weslin . Sein hau(sfrau), 19.
Jh.; 3c: Mädchen als Wappenhalterin mit Umschrift: omnia lex deo veni-
unt anno dom. 1508, 19. /20. Jh.
3 Murr, 2i8oi, S. 156.
4 Würfel, 1766, S. 477-482.