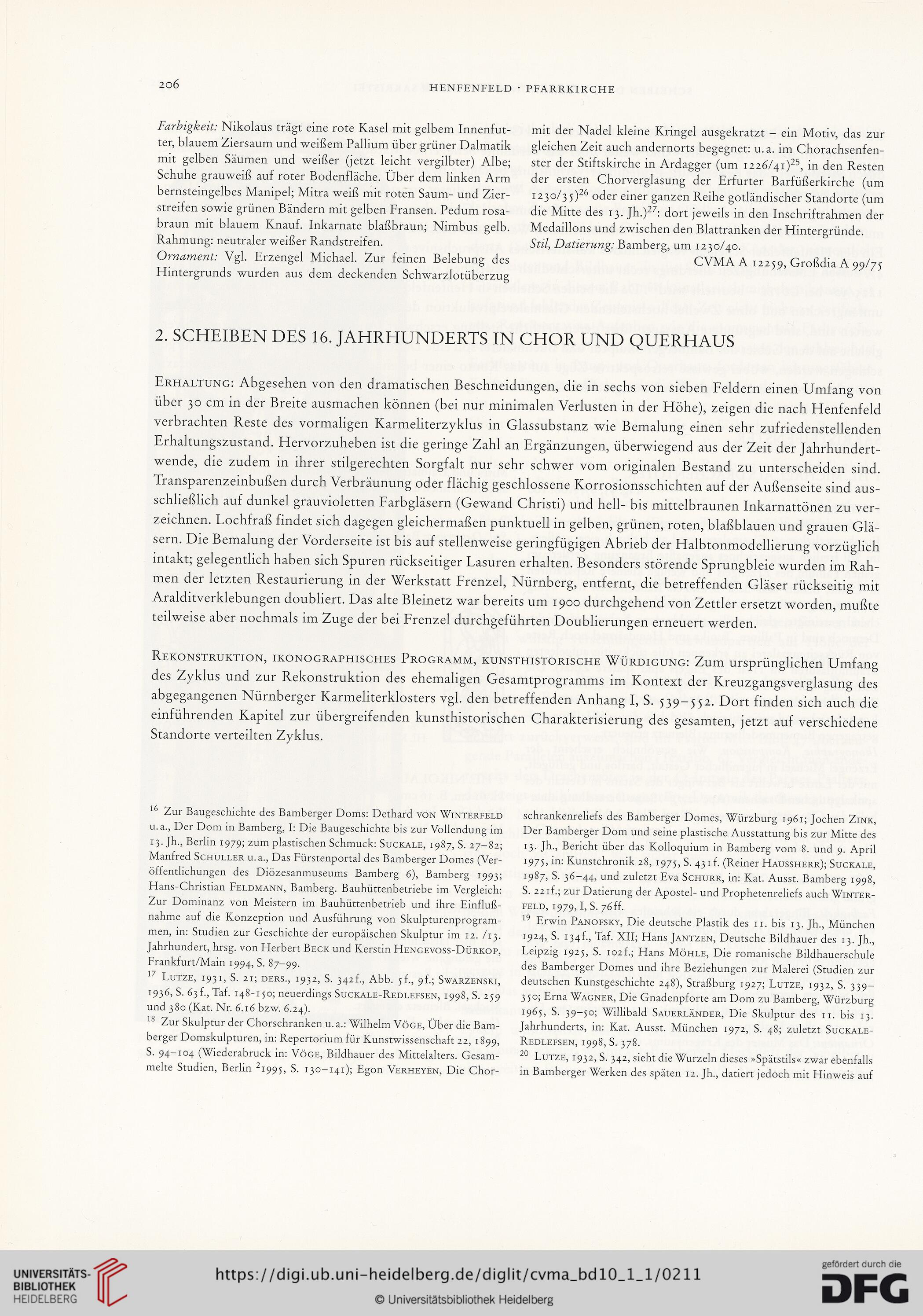zo6
HENFENFELD • PFARRKIRCHE
Farbigkeit: Nikolaus trägt eine rote Kasel mit gelbem Innenfut-
ter, blauem Ziersaum und weißem Pallium über grüner Dalmatik
mit gelben Säumen und weißer (jetzt leicht vergilbter) Albe;
Schuhe grauweiß auf roter Bodenfläche. Über dem linken Arm
bernsteingelbes Manipel; Mitra weiß mit roten Saum- und Zier-
streifen sowie grünen Bändern mit gelben Fransen. Pedum rosa-
braun mit blauem Knauf. Inkarnate blaßbraun; Nimbus gelb.
Rahmung: neutraler weißer Randstreifen.
Ornament: Vgl. Erzengel Michael. Zur feinen Belebung des
Hintergrunds wurden aus dem deckenden Schwarzlotüberzug
mit der Nadel kleine Kringel ausgekratzt - ein Motiv, das zur
gleichen Zeit auch andernorts begegnet: u.a. im Chorachsenfen-
ster der Stiftskirche in Ardagger (um 1226/41)25, in den Resten
der ersten Chorverglasung der Erfurter Barfüßerkirche (um
1230/3 $)26 oder einer ganzen Reihe gotländischer Standorte (um
die Mitte des 13. Jh.)27: dort jeweils in den Inschriftrahmen der
Medaillons und zwischen den Blattranken der Hintergründe.
Stil, Datierung: Bamberg, um 1230/40.
CVMA A 12259, Großdia A 99/75
2. SCHEIBEN DES 16. JAHRHUNDERTS IN CHOR UND QUERHAUS
Erhaltung: Abgesehen von den dramatischen Beschneidungen, die in sechs von sieben Feldern einen Umfang von
über 30 cm in der Breite ausmachen können (bei nur minimalen Verlusten in der Höhe), zeigen die nach Henfenfeld
verbrachten Reste des vormaligen Karmeliterzyklus in Glassubstanz wie Bemalung einen sehr zufriedenstellenden
Erhaltungszustand. Hervorzuheben ist die geringe Zahl an Ergänzungen, überwiegend aus der Zeit der Jahrhundert-
wende, die zudem in ihrer stilgerechten Sorgfalt nur sehr schwer vom originalen Bestand zu unterscheiden sind.
Transparenzeinbußen durch Verbräunung oder flächig geschlossene Korrosionsschichten auf der Außenseite sind aus-
schließlich auf dunkel grauvioletten Farbgläsern (Gewand Christi) und hell- bis mittelbraunen Inkarnattönen zu ver-
zeichnen. Lochfraß findet sich dagegen gleichermaßen punktuell in gelben, grünen, roten, blaßblauen und grauen Glä-
sern. Die Bemalung der Vorderseite ist bis auf stellenweise geringfügigen Abrieb der Halbtonmodellierung vorzüglich
intakt; gelegentlich haben sich Spuren rückseitiger Lasuren erhalten. Besonders störende Sprungbleie wurden im Rah-
men der letzten Restaurierung in der Werkstatt Frenzei, Nürnberg, entfernt, die betreffenden Gläser rückseitig mit
Aralditverklebungen doubliert. Das alte Bleinetz war bereits um 1900 durchgehend von Zettler ersetzt worden, mußte
teilweise aber nochmals im Zuge der bei Frenzei durchgeführten Doublierungen erneuert werden.
Rekonstruktion, ikonographisches Programm, kunsthistorische Würdigung: Zum ursprünglichen Umfang
des Zyklus und zur Rekonstruktion des ehemaligen Gesamtprogramms im Kontext der Kreuzgangsverglasung des
abgegangenen Nürnberger Karmeliterklosters vgl. den betreffenden Anhang I, S. 539-552. Dort finden sich auch die
einführenden Kapitel zur übergreifenden kunsthistorischen Charakterisierung des gesamten, jetzt auf verschiedene
Standorte verteilten Zyklus.
16 Zur Baugeschichte des Bamberger Doms: Dethard von Winterfeld
u.a., Der Dom in Bamberg, I: Die Baugeschichte bis zur Vollendung im
13. Jh., Berlin 1979; zum plastischen Schmuck: Suckale, 1987, S. 27-82;
Manfred Schuller u.a., Das Fürstenportal des Bamberger Domes (Ver-
öffentlichungen des Diözesanmuseums Bamberg 6), Bamberg 1993;
Hans-Christian Feldmann, Bamberg. Bauhüttenbetriebe im Vergleich:
Zur Dominanz von Meistern im Bauhüttenbetrieb und ihre Einfluß-
nahme auf die Konzeption und Ausführung von Skulpturenprogram-
men, in: Studien zur Geschichte der europäischen Skulptur im 12. /13.
Jahrhundert, hrsg. von Herbert Beck und Kerstin Hengevoss-Dürkop,
Frankfurt/Main 1994, S. 87-99.
17 Lutze, 1931, S. 21; ders., 1932, S. 342k, Abb. 5 k, 9k; Swarzenski,
1936, S. 63k, Taf. 148-150; neuerdings Suckale-Redlefsen, 1998, S. 259
und 380 (Kat. Nr. 6.16 bzw. 6.24).
18 Zur Skulptur der Chorschranken u. a.: Wilhelm Vöge, Über die Bam-
berger Domskulpturen, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 22, 1899,
S. 94-104 (Wiederabruck in: Vöge, Bildhauer des Mittelalters. Gesam-
melte Studien, Berlin 2i995, S. 130-141); Egon Verheyen, Die Chor-
schrankenreliefs des Bamberger Domes, Würzburg 1961; Jochen Zink,
Der Bamberger Dom und seine plastische Ausstattung bis zur Mitte des
13. Jh., Bericht über das Kolloquium in Bamberg vom 8. und 9. April
1975, in: Kunstchronik 28, 1975, S. 431 f. (Reiner Haussherr); Suckale,
1987, S. 36-44, und zuletzt Eva Schurr, in: Kat. Ausst. Bamberg 1998,
S. 221k; zur Datierung der Apostel- und Prophetenreliefs auch Winter-
feld, 1979,1, S. 76ff.
19 Erwin Panofsky, Die deutsche Plastik des 11. bis 13. Jh., München
1924, S. 134k, Taf. XII; Hans Jantzen, Deutsche Bildhauer des 13. Jh.,
Leipzig 1925, S. 102k; Hans Möhle, Die romanische Bildhauerschule
des Bamberger Domes und ihre Beziehungen zur Malerei (Studien zur
deutschen Kunstgeschichte 248), Straßburg 1927; Lutze, 1932, S. 339—
350; Erna Wagner, Die Gnadenpforte am Dom zu Bamberg, Würzburg
1965, S. 39-50; Willibald Sauerländer, Die Skulptur des 11. bis 13.
Jahrhunderts, in: Kat. Ausst. München 1972, S. 48; zuletzt Suckale-
Redlefsen, 1998, S. 378.
20 Lutze, 1932, S. 342, sieht die Wurzeln dieses »Spätstils« zwar ebenfalls
in Bamberger Werken des späten 12. Jh., datiert jedoch mit Hinweis auf
HENFENFELD • PFARRKIRCHE
Farbigkeit: Nikolaus trägt eine rote Kasel mit gelbem Innenfut-
ter, blauem Ziersaum und weißem Pallium über grüner Dalmatik
mit gelben Säumen und weißer (jetzt leicht vergilbter) Albe;
Schuhe grauweiß auf roter Bodenfläche. Über dem linken Arm
bernsteingelbes Manipel; Mitra weiß mit roten Saum- und Zier-
streifen sowie grünen Bändern mit gelben Fransen. Pedum rosa-
braun mit blauem Knauf. Inkarnate blaßbraun; Nimbus gelb.
Rahmung: neutraler weißer Randstreifen.
Ornament: Vgl. Erzengel Michael. Zur feinen Belebung des
Hintergrunds wurden aus dem deckenden Schwarzlotüberzug
mit der Nadel kleine Kringel ausgekratzt - ein Motiv, das zur
gleichen Zeit auch andernorts begegnet: u.a. im Chorachsenfen-
ster der Stiftskirche in Ardagger (um 1226/41)25, in den Resten
der ersten Chorverglasung der Erfurter Barfüßerkirche (um
1230/3 $)26 oder einer ganzen Reihe gotländischer Standorte (um
die Mitte des 13. Jh.)27: dort jeweils in den Inschriftrahmen der
Medaillons und zwischen den Blattranken der Hintergründe.
Stil, Datierung: Bamberg, um 1230/40.
CVMA A 12259, Großdia A 99/75
2. SCHEIBEN DES 16. JAHRHUNDERTS IN CHOR UND QUERHAUS
Erhaltung: Abgesehen von den dramatischen Beschneidungen, die in sechs von sieben Feldern einen Umfang von
über 30 cm in der Breite ausmachen können (bei nur minimalen Verlusten in der Höhe), zeigen die nach Henfenfeld
verbrachten Reste des vormaligen Karmeliterzyklus in Glassubstanz wie Bemalung einen sehr zufriedenstellenden
Erhaltungszustand. Hervorzuheben ist die geringe Zahl an Ergänzungen, überwiegend aus der Zeit der Jahrhundert-
wende, die zudem in ihrer stilgerechten Sorgfalt nur sehr schwer vom originalen Bestand zu unterscheiden sind.
Transparenzeinbußen durch Verbräunung oder flächig geschlossene Korrosionsschichten auf der Außenseite sind aus-
schließlich auf dunkel grauvioletten Farbgläsern (Gewand Christi) und hell- bis mittelbraunen Inkarnattönen zu ver-
zeichnen. Lochfraß findet sich dagegen gleichermaßen punktuell in gelben, grünen, roten, blaßblauen und grauen Glä-
sern. Die Bemalung der Vorderseite ist bis auf stellenweise geringfügigen Abrieb der Halbtonmodellierung vorzüglich
intakt; gelegentlich haben sich Spuren rückseitiger Lasuren erhalten. Besonders störende Sprungbleie wurden im Rah-
men der letzten Restaurierung in der Werkstatt Frenzei, Nürnberg, entfernt, die betreffenden Gläser rückseitig mit
Aralditverklebungen doubliert. Das alte Bleinetz war bereits um 1900 durchgehend von Zettler ersetzt worden, mußte
teilweise aber nochmals im Zuge der bei Frenzei durchgeführten Doublierungen erneuert werden.
Rekonstruktion, ikonographisches Programm, kunsthistorische Würdigung: Zum ursprünglichen Umfang
des Zyklus und zur Rekonstruktion des ehemaligen Gesamtprogramms im Kontext der Kreuzgangsverglasung des
abgegangenen Nürnberger Karmeliterklosters vgl. den betreffenden Anhang I, S. 539-552. Dort finden sich auch die
einführenden Kapitel zur übergreifenden kunsthistorischen Charakterisierung des gesamten, jetzt auf verschiedene
Standorte verteilten Zyklus.
16 Zur Baugeschichte des Bamberger Doms: Dethard von Winterfeld
u.a., Der Dom in Bamberg, I: Die Baugeschichte bis zur Vollendung im
13. Jh., Berlin 1979; zum plastischen Schmuck: Suckale, 1987, S. 27-82;
Manfred Schuller u.a., Das Fürstenportal des Bamberger Domes (Ver-
öffentlichungen des Diözesanmuseums Bamberg 6), Bamberg 1993;
Hans-Christian Feldmann, Bamberg. Bauhüttenbetriebe im Vergleich:
Zur Dominanz von Meistern im Bauhüttenbetrieb und ihre Einfluß-
nahme auf die Konzeption und Ausführung von Skulpturenprogram-
men, in: Studien zur Geschichte der europäischen Skulptur im 12. /13.
Jahrhundert, hrsg. von Herbert Beck und Kerstin Hengevoss-Dürkop,
Frankfurt/Main 1994, S. 87-99.
17 Lutze, 1931, S. 21; ders., 1932, S. 342k, Abb. 5 k, 9k; Swarzenski,
1936, S. 63k, Taf. 148-150; neuerdings Suckale-Redlefsen, 1998, S. 259
und 380 (Kat. Nr. 6.16 bzw. 6.24).
18 Zur Skulptur der Chorschranken u. a.: Wilhelm Vöge, Über die Bam-
berger Domskulpturen, in: Repertorium für Kunstwissenschaft 22, 1899,
S. 94-104 (Wiederabruck in: Vöge, Bildhauer des Mittelalters. Gesam-
melte Studien, Berlin 2i995, S. 130-141); Egon Verheyen, Die Chor-
schrankenreliefs des Bamberger Domes, Würzburg 1961; Jochen Zink,
Der Bamberger Dom und seine plastische Ausstattung bis zur Mitte des
13. Jh., Bericht über das Kolloquium in Bamberg vom 8. und 9. April
1975, in: Kunstchronik 28, 1975, S. 431 f. (Reiner Haussherr); Suckale,
1987, S. 36-44, und zuletzt Eva Schurr, in: Kat. Ausst. Bamberg 1998,
S. 221k; zur Datierung der Apostel- und Prophetenreliefs auch Winter-
feld, 1979,1, S. 76ff.
19 Erwin Panofsky, Die deutsche Plastik des 11. bis 13. Jh., München
1924, S. 134k, Taf. XII; Hans Jantzen, Deutsche Bildhauer des 13. Jh.,
Leipzig 1925, S. 102k; Hans Möhle, Die romanische Bildhauerschule
des Bamberger Domes und ihre Beziehungen zur Malerei (Studien zur
deutschen Kunstgeschichte 248), Straßburg 1927; Lutze, 1932, S. 339—
350; Erna Wagner, Die Gnadenpforte am Dom zu Bamberg, Würzburg
1965, S. 39-50; Willibald Sauerländer, Die Skulptur des 11. bis 13.
Jahrhunderts, in: Kat. Ausst. München 1972, S. 48; zuletzt Suckale-
Redlefsen, 1998, S. 378.
20 Lutze, 1932, S. 342, sieht die Wurzeln dieses »Spätstils« zwar ebenfalls
in Bamberger Werken des späten 12. Jh., datiert jedoch mit Hinweis auf