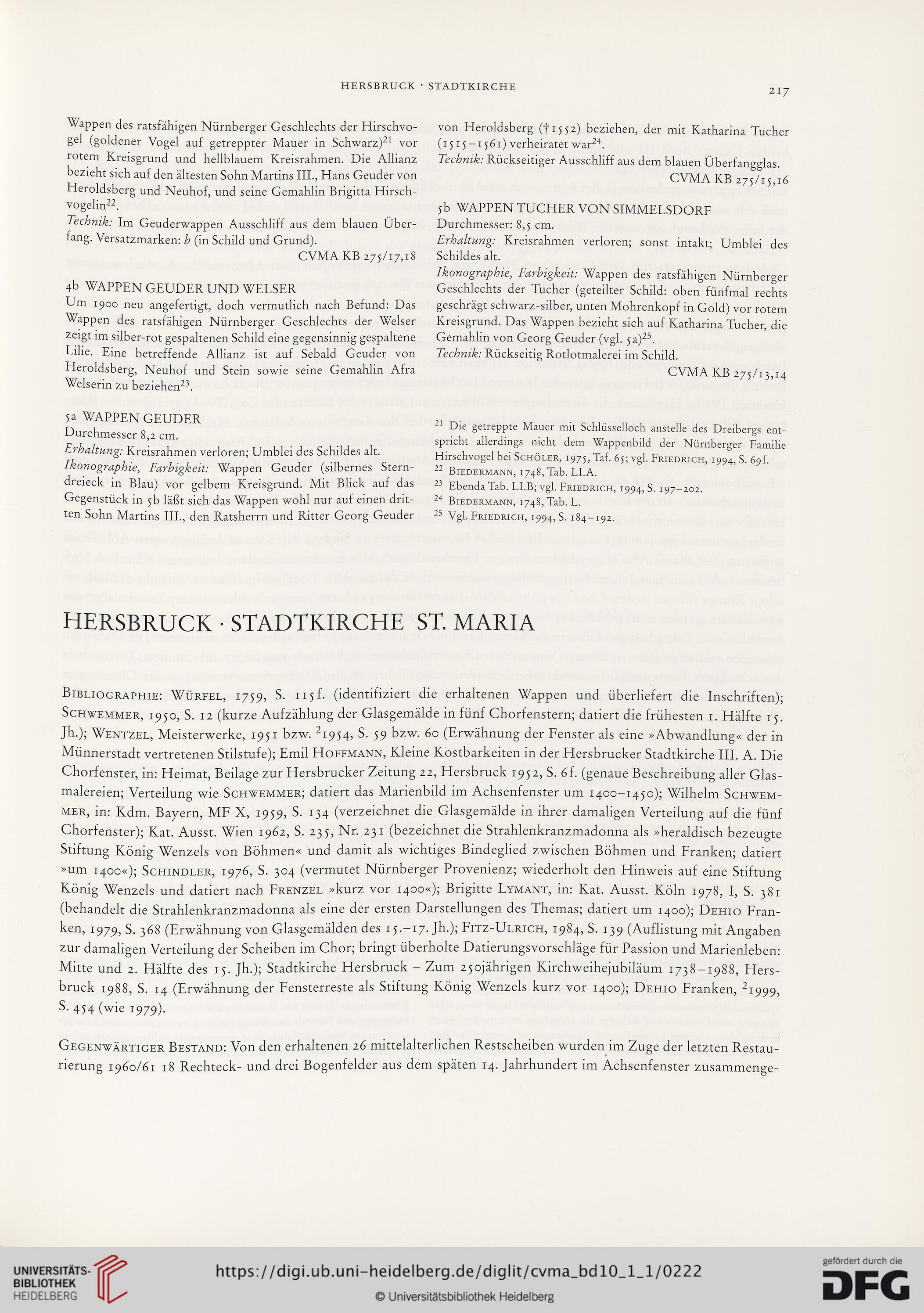HERSBRUCK • STADTKIRCHE
2I7
Wappen des ratsfähigen Nürnberger Geschlechts der Hirschvo-
gel (goldener Vogel auf getreppter Mauer in Schwarz)21 vor
rotem Kreisgrund und hellblauem Kreisrahmen. Die Allianz
bezieht sich auf den ältesten Sohn Martins III., Hans Geuder von
Heroldsberg und Neuhof, und seine Gemahlin Brigitta Hirsch-
vogelin22.
Technik: Im Geuderwappen Ausschliff aus dem blauen Über-
fang. Versatzmarken: b (in Schild und Grund).
CVMA KB 275/17,18
4b WAPPEN GEUDER UND WELSER
Um 1900 neu angefertigt, doch vermutlich nach Befund: Das
Wappen des ratsfähigen Nürnberger Geschlechts der Welser
zeigt im silber-rot gespaltenen Schild eine gegensinnig gespaltene
Lilie. Eine betreffende Allianz ist auf Sebald Geuder von
Heroldsberg, Neuhof und Stein sowie seine Gemahlin Afra
Welserin zu beziehen23.
5 a WAPPEN GEUDER
Durchmesser 8,2 cm.
Erhaltung: Kreisrahmen verloren; Umblei des Schildes alt.
Ikonographie, Farbigkeit: Wappen Geuder (silbernes Stern-
dreieck in Blau) vor gelbem Kreisgrund. Mit Blick auf das
Gegenstück in 5 b läßt sich das Wappen wohl nur auf einen drit-
ten Sohn Martins III., den Ratsherrn und Ritter Georg Geuder
von Heroldsberg (J1552) beziehen, der mit Katharina Tücher
(1515-1561) verheiratet war24.
Technik: Rückseitiger Ausschliff aus dem blauen Überfangglas.
CVMA KB 275/15,16
5b WAPPEN TÜCHER VON SIMMELSDORF
Durchmesser: 8,5 cm.
Erhaltung: Kreisrahmen verloren; sonst intakt; Umblei des
Schildes alt.
Ikonographie, Farbigkeit: Wappen des ratsfähigen Nürnberger
Geschlechts der Tücher (geteilter Schild: oben fünfmal rechts
geschrägt schwarz-silber, unten Mohrenkopf in Gold) vor rotem
Kreisgrund. Das Wappen bezieht sich auf Katharina Tücher, die
Gemahlin von Georg Geuder (vgl. 5a)25.
Technik: Rückseitig Rotlotmalerei im Schild.
CVMA KB 275/13,14
21 Die getreppte Mauer mit Schlüsselloch anstelle des Dreibergs ent-
spricht allerdings nicht dem Wappenbild der Nürnberger Familie
Hirschvogel bei Schöler, 1975, Taf. 65; vgl. Friedrich, 1994, S. 69h
22 Biedermann, 1748, Tab. LI.A.
23 Ebenda Tab. LI.B; vgl. Friedrich, 1994, S. 197-202.
24 Biedermann, 1748, Tab. L.
25 Vgl. Friedrich, 1994, S. 184-192.
HERSBRUCK • STADTKIRCHE ST MARIA
die erhaltenen Wappen und überliefert die Inschriften);
Bibliographie: Würfel, 1759, S. njf. (identifiziert
Schwemmer, 1950, S. i2 (kurze Aufzählung der Glasgemälde in fünf Chorfenstern; datiert die frühesten 1. Hälfte 15.
Jh.); Wentzel, Meisterwerke, 1951 bzw. 2t954, S. 59 bzw. 60 (Erwähnung der Fenster als eine »Abwandlung« der in
Münnerstadt vertretenen Stilstufe); Emil Hoffmann, Kleine Kostbarkeiten in der Hersbrucker Stadtkirche III. A. Die
Chorfenster, in: Heimat, Beilage zur Hersbrucker Zeitung 22, Hersbruck 1952, S. 6f. (genaue Beschreibung aller Glas-
malereien; Verteilung wie Schwemmer; datiert das Marienbild im Achsenfenster um 1400-1450); Wilhelm Schwem-
mer, in: Kdm. Bayern, MF X, 1959, S. 134 (verzeichnet die Glasgemälde in ihrer damaligen Verteilung auf die fünf
Chorfenster); Kat. Ausst. Wien 1962, S. 235, Nr. 231 (bezeichnet die Strahlenkranzmadonna als »heraldisch bezeugte
Stiftung König Wenzels von Böhmen« und damit als wichtiges Bindeglied zwischen Böhmen und Franken; datiert
»um 1400«); Schindler, 1976, S. 304 (vermutet Nürnberger Provenienz; wiederholt den Hinweis auf eine Stiftung
König Wenzels und datiert nach Frenzel »kurz vor 1400«); Brigitte Lymant, in: Kat. Ausst. Köln 1978, I, S. 381
(behandelt die Strahlenkranzmadonna als eine der ersten Darstellungen des Themas; datiert um 1400); Dehio Fran-
ken, 1979,5.368 (Erwähnung von Glasgemälden des 15.-17.Jh.); Fitz-Ulrich, 1984,5. 139 (Auflistung mit Angaben
zur damaligen Verteilung der Scheiben im Chor; bringt überholte Datierungsvorschläge für Passion und Marienleben:
Mitte und 2. Hälfte des 15. Jh.); Stadtkirche Hersbruck - Zum 250jährigen Kirchweihejubiläum 1738-1988, Hers-
bruck 1988, S. 14 (Erwähnung der Fensterreste als Stiftung König Wenzels kurz vor 1400); Dehio Franken, H999,
S. 454 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Von den erhaltenen 26 mittelalterlichen Restscheiben wurden im Zuge der letzten Restau-
rierung 1960/61 18 Rechteck- und drei Bogenfelder aus dem späten 14. Jahrhundert im Achsenfenster zusammenge-
2I7
Wappen des ratsfähigen Nürnberger Geschlechts der Hirschvo-
gel (goldener Vogel auf getreppter Mauer in Schwarz)21 vor
rotem Kreisgrund und hellblauem Kreisrahmen. Die Allianz
bezieht sich auf den ältesten Sohn Martins III., Hans Geuder von
Heroldsberg und Neuhof, und seine Gemahlin Brigitta Hirsch-
vogelin22.
Technik: Im Geuderwappen Ausschliff aus dem blauen Über-
fang. Versatzmarken: b (in Schild und Grund).
CVMA KB 275/17,18
4b WAPPEN GEUDER UND WELSER
Um 1900 neu angefertigt, doch vermutlich nach Befund: Das
Wappen des ratsfähigen Nürnberger Geschlechts der Welser
zeigt im silber-rot gespaltenen Schild eine gegensinnig gespaltene
Lilie. Eine betreffende Allianz ist auf Sebald Geuder von
Heroldsberg, Neuhof und Stein sowie seine Gemahlin Afra
Welserin zu beziehen23.
5 a WAPPEN GEUDER
Durchmesser 8,2 cm.
Erhaltung: Kreisrahmen verloren; Umblei des Schildes alt.
Ikonographie, Farbigkeit: Wappen Geuder (silbernes Stern-
dreieck in Blau) vor gelbem Kreisgrund. Mit Blick auf das
Gegenstück in 5 b läßt sich das Wappen wohl nur auf einen drit-
ten Sohn Martins III., den Ratsherrn und Ritter Georg Geuder
von Heroldsberg (J1552) beziehen, der mit Katharina Tücher
(1515-1561) verheiratet war24.
Technik: Rückseitiger Ausschliff aus dem blauen Überfangglas.
CVMA KB 275/15,16
5b WAPPEN TÜCHER VON SIMMELSDORF
Durchmesser: 8,5 cm.
Erhaltung: Kreisrahmen verloren; sonst intakt; Umblei des
Schildes alt.
Ikonographie, Farbigkeit: Wappen des ratsfähigen Nürnberger
Geschlechts der Tücher (geteilter Schild: oben fünfmal rechts
geschrägt schwarz-silber, unten Mohrenkopf in Gold) vor rotem
Kreisgrund. Das Wappen bezieht sich auf Katharina Tücher, die
Gemahlin von Georg Geuder (vgl. 5a)25.
Technik: Rückseitig Rotlotmalerei im Schild.
CVMA KB 275/13,14
21 Die getreppte Mauer mit Schlüsselloch anstelle des Dreibergs ent-
spricht allerdings nicht dem Wappenbild der Nürnberger Familie
Hirschvogel bei Schöler, 1975, Taf. 65; vgl. Friedrich, 1994, S. 69h
22 Biedermann, 1748, Tab. LI.A.
23 Ebenda Tab. LI.B; vgl. Friedrich, 1994, S. 197-202.
24 Biedermann, 1748, Tab. L.
25 Vgl. Friedrich, 1994, S. 184-192.
HERSBRUCK • STADTKIRCHE ST MARIA
die erhaltenen Wappen und überliefert die Inschriften);
Bibliographie: Würfel, 1759, S. njf. (identifiziert
Schwemmer, 1950, S. i2 (kurze Aufzählung der Glasgemälde in fünf Chorfenstern; datiert die frühesten 1. Hälfte 15.
Jh.); Wentzel, Meisterwerke, 1951 bzw. 2t954, S. 59 bzw. 60 (Erwähnung der Fenster als eine »Abwandlung« der in
Münnerstadt vertretenen Stilstufe); Emil Hoffmann, Kleine Kostbarkeiten in der Hersbrucker Stadtkirche III. A. Die
Chorfenster, in: Heimat, Beilage zur Hersbrucker Zeitung 22, Hersbruck 1952, S. 6f. (genaue Beschreibung aller Glas-
malereien; Verteilung wie Schwemmer; datiert das Marienbild im Achsenfenster um 1400-1450); Wilhelm Schwem-
mer, in: Kdm. Bayern, MF X, 1959, S. 134 (verzeichnet die Glasgemälde in ihrer damaligen Verteilung auf die fünf
Chorfenster); Kat. Ausst. Wien 1962, S. 235, Nr. 231 (bezeichnet die Strahlenkranzmadonna als »heraldisch bezeugte
Stiftung König Wenzels von Böhmen« und damit als wichtiges Bindeglied zwischen Böhmen und Franken; datiert
»um 1400«); Schindler, 1976, S. 304 (vermutet Nürnberger Provenienz; wiederholt den Hinweis auf eine Stiftung
König Wenzels und datiert nach Frenzel »kurz vor 1400«); Brigitte Lymant, in: Kat. Ausst. Köln 1978, I, S. 381
(behandelt die Strahlenkranzmadonna als eine der ersten Darstellungen des Themas; datiert um 1400); Dehio Fran-
ken, 1979,5.368 (Erwähnung von Glasgemälden des 15.-17.Jh.); Fitz-Ulrich, 1984,5. 139 (Auflistung mit Angaben
zur damaligen Verteilung der Scheiben im Chor; bringt überholte Datierungsvorschläge für Passion und Marienleben:
Mitte und 2. Hälfte des 15. Jh.); Stadtkirche Hersbruck - Zum 250jährigen Kirchweihejubiläum 1738-1988, Hers-
bruck 1988, S. 14 (Erwähnung der Fensterreste als Stiftung König Wenzels kurz vor 1400); Dehio Franken, H999,
S. 454 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: Von den erhaltenen 26 mittelalterlichen Restscheiben wurden im Zuge der letzten Restau-
rierung 1960/61 18 Rechteck- und drei Bogenfelder aus dem späten 14. Jahrhundert im Achsenfenster zusammenge-