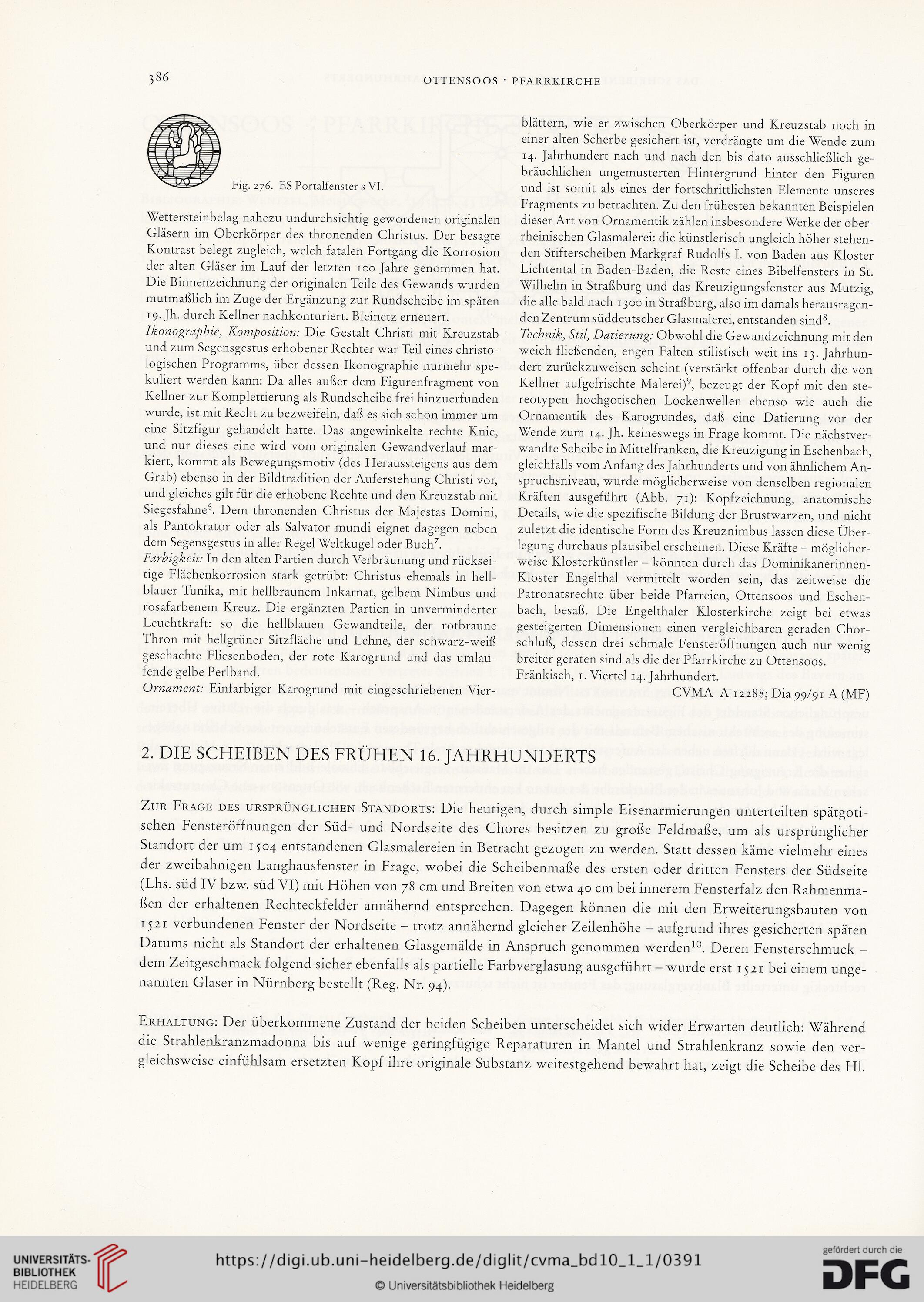386
OTTENSOOS ■ PFARRKIRCHE
Fig. 276. ES Portalfenster s VI.
Wettersteinbelag nahezu undurchsichtig gewordenen originalen
Gläsern im Oberkörper des thronenden Christus. Der besagte
Kontrast belegt zugleich, welch fatalen Fortgang die Korrosion
der alten Gläser im Lauf der letzten 100 Jahre genommen hat.
Die Binnenzeichnung der originalen Teile des Gewands wurden
mutmaßlich im Zuge der Ergänzung zur Rundscheibe im späten
19. Jh. durch Kellner nachkonturiert. Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition: Die Gestalt Christi mit Kreuzstab
und zum Segensgestus erhobener Rechter war Teil eines christo-
logischen Programms, über dessen Ikonographie nurmehr spe-
kuliert werden kann: Da alles außer dem Figurenfragment von
Kellner zur Komplettierung als Rundscheibe frei hinzuerfunden
wurde, ist mit Recht zu bezweifeln, daß es sich schon immer um
eine Sitzfigur gehandelt hatte. Das angewinkelte rechte Knie,
und nur dieses eine wird vom originalen Gewandverlauf mar-
kiert, kommt als Bewegungsmotiv (des Heraussteigens aus dem
Grab) ebenso in der Bildtradition der Auferstehung Christi vor,
und gleiches gilt für die erhobene Rechte und den Kreuzstab mit
Siegesfahne6. Dem thronenden Christus der Majestas Domini,
als Pantokrator oder als Salvator mundi eignet dagegen neben
dem Segensgestus in aller Regel Weltkugel oder Buch7.
Farbigkeit: In den alten Partien durch Verbräunung und rücksei-
tige Flächenkorrosion stark getrübt: Christus ehemals in hell-
blauer Tunika, mit hellbraunem Inkarnat, gelbem Nimbus und
rosafarbenem Kreuz. Die ergänzten Partien in unverminderter
Leuchtkraft: so die hellblauen Gewandteile, der rotbraune
Thron mit hellgrüner Sitzfläche und Lehne, der schwarz-weiß
geschachte Fliesenboden, der rote Karogrund und das umlau-
fende gelbe Perlband.
Ornament: Einfarbiger Karogrund mit eingeschriebenen Vier-
blättern, wie er zwischen Oberkörper und Kreuzstab noch in
einer alten Scherbe gesichert ist, verdrängte um die Wende zum
14. Jahrhundert nach und nach den bis dato ausschließlich ge-
bräuchlichen ungemusterten Hintergrund hinter den Figuren
und ist somit als eines der fortschrittlichsten Elemente unseres
Fragments zu betrachten. Zu den frühesten bekannten Beispielen
dieser Art von Ornamentik zählen insbesondere Werke der ober-
rheinischen Glasmalerei: die künstlerisch ungleich höher stehen-
den Stifterscheiben Markgraf Rudolfs I. von Baden aus Kloster
Lichtental in Baden-Baden, die Reste eines Bibelfensters in St.
Wilhelm in Straßburg und das Kreuzigungsfenster aus Mutzig,
die alle bald nach 1300 in Straßburg, also im damals herausragen-
den Zentrum süddeutscher Glasmalerei, entstanden sind8.
Technik, Stil, Datierung: Obwohl die Gewandzeichnung mit den
weich fließenden, engen Falten stilistisch weit ins 13. Jahrhun-
dert zurückzuweisen scheint (verstärkt offenbar durch die von
Kellner aufgefrischte Malerei)9, bezeugt der Kopf mit den ste-
reotypen hochgotischen Lockenwellen ebenso wie auch die
Ornamentik des Karogrundes, daß eine Datierung vor der
Wende zum 14. Jh. keineswegs in Frage kommt. Die nächstver-
wandte Scheibe in Mittelfranken, die Kreuzigung in Eschenbach,
gleichfalls vom Anfang des Jahrhunderts und von ähnlichem An-
spruchsniveau, wurde möglicherweise von denselben regionalen
Kräften ausgeführt (Abb. 71): Kopfzeichnung, anatomische
Details, wie die spezifische Bildung der Brustwarzen, und nicht
zuletzt die identische Form des Kreuznimbus lassen diese Über-
legung durchaus plausibel erscheinen. Diese Kräfte - möglicher-
weise Klosterkünstler - könnten durch das Dominikanerinnen-
Kloster Engelthal vermittelt worden sein, das zeitweise die
Patronatsrechte über beide Pfarreien, Ottensoos und Eschen-
bach, besaß. Die Engelthaler Klosterkirche zeigt bei etwas
gesteigerten Dimensionen einen vergleichbaren geraden Chor-
schluß, dessen drei schmale Fensteröffnungen auch nur wenig
breiter geraten sind als die der Pfarrkirche zu Ottensoos.
Fränkisch, 1. Viertel 14. Jahrhundert.
CVMA A 12288; Dia 99/91 A (MF)
2. DIE SCHEIBEN DES FRÜHEN 16. JAHRHUNDERTS
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die heutigen, durch simple Eisenarmierungen unterteilten spätgoti-
schen Fensteröffnungen der Süd- und Nordseite des Chores besitzen zu große Feldmaße, um als ursprünglicher
Standort der um 1504 entstandenen Glasmalereien in Betracht gezogen zu werden. Statt dessen käme vielmehr eines
der zweibahnigen Langhausfenster in Frage, wobei die Scheibenmaße des ersten oder dritten Fensters der Südseite
(Lhs. süd IV bzw. süd VI) mit Höhen von 78 cm und Breiten von etwa 40 cm bei innerem Fensterfalz den Rahmenma-
ßen der erhaltenen Rechteckfelder annähernd entsprechen. Dagegen können die mit den Erweiterungsbauten von
1521 verbundenen Fenster der Nordseite - trotz annähernd gleicher Zeilenhöhe - aufgrund ihres gesicherten späten
Datums nicht als Standort der erhaltenen Glasgemälde in Anspruch genommen werden10. Deren Fensterschmuck -
dem Zeitgeschmack folgend sicher ebenfalls als partielle Farbverglasung ausgeführt - wurde erst 1521 bei einem unge-
nannten Glaser in Nürnberg bestellt (Reg. Nr. 94).
Erhaltung: Der überkommene Zustand der beiden Scheiben unterscheidet sich wider Erwarten deutlich: Während
die Strahlenkranzmadonna bis auf wenige geringfügige Reparaturen in Mantel und Strahlenkranz sowie den ver-
gleichsweise einfühlsam ersetzten Kopf ihre originale Substanz weitestgehend bewahrt hat, zeigt die Scheibe des Hl.
OTTENSOOS ■ PFARRKIRCHE
Fig. 276. ES Portalfenster s VI.
Wettersteinbelag nahezu undurchsichtig gewordenen originalen
Gläsern im Oberkörper des thronenden Christus. Der besagte
Kontrast belegt zugleich, welch fatalen Fortgang die Korrosion
der alten Gläser im Lauf der letzten 100 Jahre genommen hat.
Die Binnenzeichnung der originalen Teile des Gewands wurden
mutmaßlich im Zuge der Ergänzung zur Rundscheibe im späten
19. Jh. durch Kellner nachkonturiert. Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition: Die Gestalt Christi mit Kreuzstab
und zum Segensgestus erhobener Rechter war Teil eines christo-
logischen Programms, über dessen Ikonographie nurmehr spe-
kuliert werden kann: Da alles außer dem Figurenfragment von
Kellner zur Komplettierung als Rundscheibe frei hinzuerfunden
wurde, ist mit Recht zu bezweifeln, daß es sich schon immer um
eine Sitzfigur gehandelt hatte. Das angewinkelte rechte Knie,
und nur dieses eine wird vom originalen Gewandverlauf mar-
kiert, kommt als Bewegungsmotiv (des Heraussteigens aus dem
Grab) ebenso in der Bildtradition der Auferstehung Christi vor,
und gleiches gilt für die erhobene Rechte und den Kreuzstab mit
Siegesfahne6. Dem thronenden Christus der Majestas Domini,
als Pantokrator oder als Salvator mundi eignet dagegen neben
dem Segensgestus in aller Regel Weltkugel oder Buch7.
Farbigkeit: In den alten Partien durch Verbräunung und rücksei-
tige Flächenkorrosion stark getrübt: Christus ehemals in hell-
blauer Tunika, mit hellbraunem Inkarnat, gelbem Nimbus und
rosafarbenem Kreuz. Die ergänzten Partien in unverminderter
Leuchtkraft: so die hellblauen Gewandteile, der rotbraune
Thron mit hellgrüner Sitzfläche und Lehne, der schwarz-weiß
geschachte Fliesenboden, der rote Karogrund und das umlau-
fende gelbe Perlband.
Ornament: Einfarbiger Karogrund mit eingeschriebenen Vier-
blättern, wie er zwischen Oberkörper und Kreuzstab noch in
einer alten Scherbe gesichert ist, verdrängte um die Wende zum
14. Jahrhundert nach und nach den bis dato ausschließlich ge-
bräuchlichen ungemusterten Hintergrund hinter den Figuren
und ist somit als eines der fortschrittlichsten Elemente unseres
Fragments zu betrachten. Zu den frühesten bekannten Beispielen
dieser Art von Ornamentik zählen insbesondere Werke der ober-
rheinischen Glasmalerei: die künstlerisch ungleich höher stehen-
den Stifterscheiben Markgraf Rudolfs I. von Baden aus Kloster
Lichtental in Baden-Baden, die Reste eines Bibelfensters in St.
Wilhelm in Straßburg und das Kreuzigungsfenster aus Mutzig,
die alle bald nach 1300 in Straßburg, also im damals herausragen-
den Zentrum süddeutscher Glasmalerei, entstanden sind8.
Technik, Stil, Datierung: Obwohl die Gewandzeichnung mit den
weich fließenden, engen Falten stilistisch weit ins 13. Jahrhun-
dert zurückzuweisen scheint (verstärkt offenbar durch die von
Kellner aufgefrischte Malerei)9, bezeugt der Kopf mit den ste-
reotypen hochgotischen Lockenwellen ebenso wie auch die
Ornamentik des Karogrundes, daß eine Datierung vor der
Wende zum 14. Jh. keineswegs in Frage kommt. Die nächstver-
wandte Scheibe in Mittelfranken, die Kreuzigung in Eschenbach,
gleichfalls vom Anfang des Jahrhunderts und von ähnlichem An-
spruchsniveau, wurde möglicherweise von denselben regionalen
Kräften ausgeführt (Abb. 71): Kopfzeichnung, anatomische
Details, wie die spezifische Bildung der Brustwarzen, und nicht
zuletzt die identische Form des Kreuznimbus lassen diese Über-
legung durchaus plausibel erscheinen. Diese Kräfte - möglicher-
weise Klosterkünstler - könnten durch das Dominikanerinnen-
Kloster Engelthal vermittelt worden sein, das zeitweise die
Patronatsrechte über beide Pfarreien, Ottensoos und Eschen-
bach, besaß. Die Engelthaler Klosterkirche zeigt bei etwas
gesteigerten Dimensionen einen vergleichbaren geraden Chor-
schluß, dessen drei schmale Fensteröffnungen auch nur wenig
breiter geraten sind als die der Pfarrkirche zu Ottensoos.
Fränkisch, 1. Viertel 14. Jahrhundert.
CVMA A 12288; Dia 99/91 A (MF)
2. DIE SCHEIBEN DES FRÜHEN 16. JAHRHUNDERTS
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die heutigen, durch simple Eisenarmierungen unterteilten spätgoti-
schen Fensteröffnungen der Süd- und Nordseite des Chores besitzen zu große Feldmaße, um als ursprünglicher
Standort der um 1504 entstandenen Glasmalereien in Betracht gezogen zu werden. Statt dessen käme vielmehr eines
der zweibahnigen Langhausfenster in Frage, wobei die Scheibenmaße des ersten oder dritten Fensters der Südseite
(Lhs. süd IV bzw. süd VI) mit Höhen von 78 cm und Breiten von etwa 40 cm bei innerem Fensterfalz den Rahmenma-
ßen der erhaltenen Rechteckfelder annähernd entsprechen. Dagegen können die mit den Erweiterungsbauten von
1521 verbundenen Fenster der Nordseite - trotz annähernd gleicher Zeilenhöhe - aufgrund ihres gesicherten späten
Datums nicht als Standort der erhaltenen Glasgemälde in Anspruch genommen werden10. Deren Fensterschmuck -
dem Zeitgeschmack folgend sicher ebenfalls als partielle Farbverglasung ausgeführt - wurde erst 1521 bei einem unge-
nannten Glaser in Nürnberg bestellt (Reg. Nr. 94).
Erhaltung: Der überkommene Zustand der beiden Scheiben unterscheidet sich wider Erwarten deutlich: Während
die Strahlenkranzmadonna bis auf wenige geringfügige Reparaturen in Mantel und Strahlenkranz sowie den ver-
gleichsweise einfühlsam ersetzten Kopf ihre originale Substanz weitestgehend bewahrt hat, zeigt die Scheibe des Hl.