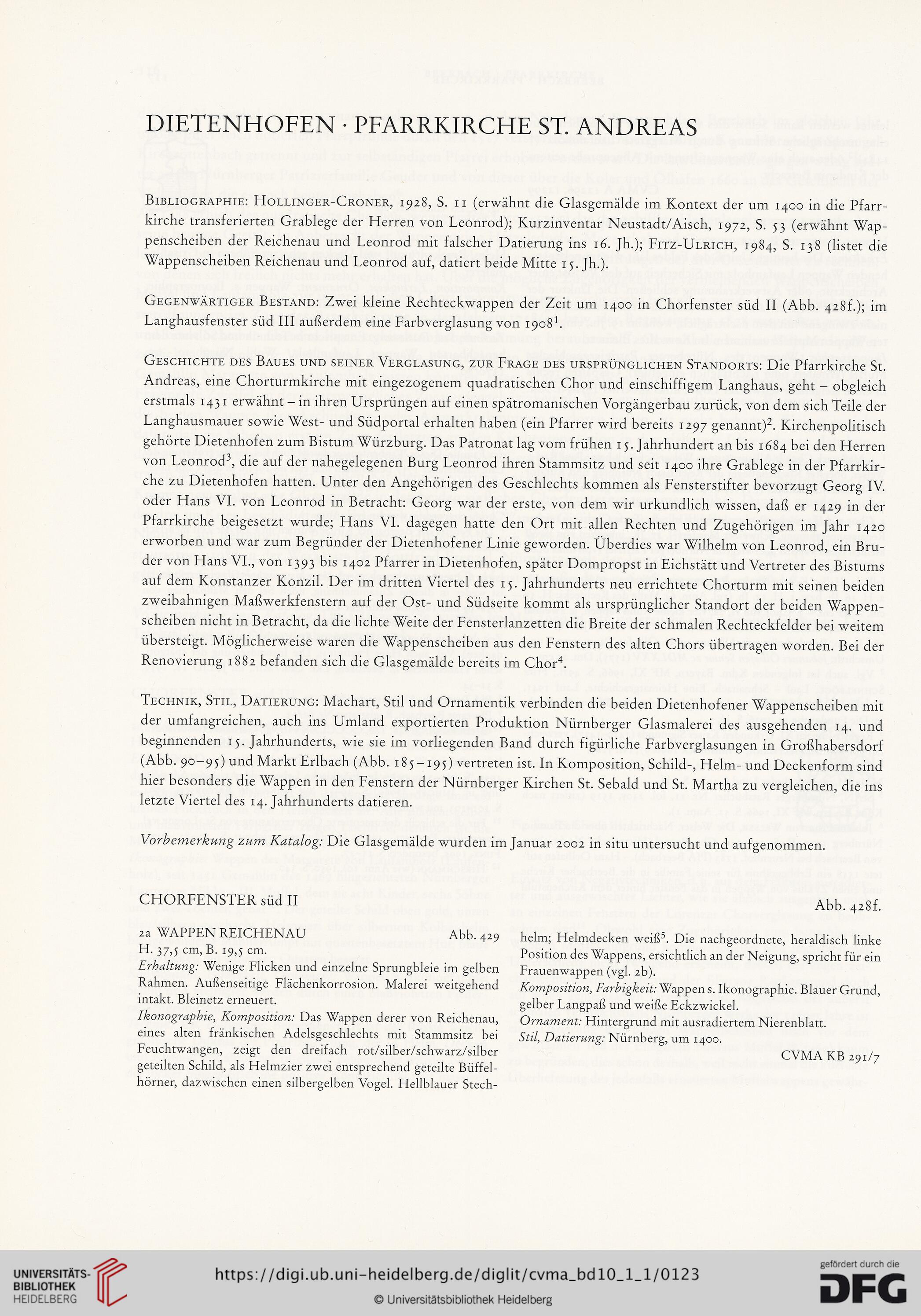DIETENHOFEN ■ PFARRKIRCHE ST. ANDREAS
Bibliographie: Hollinger-Croner, 1928, S. 11 (erwähnt die Glasgemälde im Kontext der um 1400 in die Pfarr-
kirche transferierten Grablege der Herren von Leonrod); Kurzinventar Neustadt/Aisch, 1972, S. 53 (erwähnt Wap-
penscheiben der Reichenau und Leonrod mit falscher Datierung ins 16. Jh.); Fitz-Ulrich, 1984, S. 138 (listet die
Wappenscheiben Reichenau und Leonrod auf, datiert beide Mitte 15. Jh.).
Gegenwärtiger Bestand: Zwei kleine Rechteckwappen der Zeit um 1400 in Chorfenster süd II (Abb. 428L); im
Langhausfenster süd III außerdem eine Farbverglasung von 19081.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung, zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die Pfarrkirche St.
Andreas, eine Chorturmkirche mit eingezogenem quadratischen Chor und einschiffigem Langhaus, geht - obgleich
erstmals 1431 erwähnt - in ihren Ursprüngen auf einen spätromanischen Vorgängerbau zurück, von dem sich Teile der
Langhausmauer sowie West- und Südportal erhalten haben (ein Pfarrer wird bereits 1297 genannt)2. Kirchenpolitisch
gehörte Dietenhofen zum Bistum Würzburg. Das Patronat lag vom frühen 1 5. Jahrhundert an bis 1684 bei den Herren
von Leonrod3, die auf der nahegelegenen Burg Leonrod ihren Stammsitz und seit 1400 ihre Grablege in der Pfarrkir-
che zu Dietenhofen hatten. Unter den Angehörigen des Geschlechts kommen als Fensterstifter bevorzugt Georg IV
oder Hans VI. von Leonrod in Betracht: Georg war der erste, von dem wir urkundlich wissen, daß er 1429 in der
Pfarrkirche beigesetzt wurde; Hans VI. dagegen hatte den Ort mit allen Rechten und Zugehörigen im Jahr 1420
erworben und war zum Begründer der Dietenhofener Linie geworden. Überdies war Wilhelm von Leonrod, ein Bru-
der von Hans VI., von 1393 bis 1402 Pfarrer in Dietenhofen, später Dompropst in Eichstätt und Vertreter des Bistums
auf dem Konstanzer Konzil. Der im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts neu errichtete Chorturm mit seinen beiden
zweibahnigen Maßwerkfenstern auf der Ost- und Südseite kommt als ursprünglicher Standort der beiden Wappen-
scheiben nicht in Betracht, da die lichte Weite der Fensterlanzetten die Breite der schmalen Rechteckfelder bei weitem
übersteigt. Möglicherweise waren die Wappenscheiben aus den Fenstern des alten Chors übertragen worden. Bei der
Renovierung 1882 befanden sich die Glasgemälde bereits im Chor4.
Technik, Stil, Datierung: Machart, Stil und Ornamentik verbinden die beiden Dietenhofener Wappenscheiben mit
der umfangreichen, auch ins Umland exportierten Produktion Nürnberger Glasmalerei des ausgehenden 14. und
beginnenden 15. Jahrhunderts, wie sie im vorliegenden Band durch figürliche Farbverglasungen in Großhabersdorf
(Abb. 90-95) und Markt Erlbach (Abb. 185-195) vertreten ist. In Komposition, Schild-, Helm- und Deckenform sind
hier besonders die Wappen in den Fenstern der Nürnberger Kirchen St. Sebald und St. Martha zu vergleichen, die ins
letzte Viertel des 14. Jahrhunderts datieren.
Vorbemerkung zum Katalog: Die Glasgemälde wurden im Januar 2002 in situ untersucht und aufgenommen.
CHORFENSTER süd II
2a WAPPEN REICHENAU Abb. 429
H. 37,5 cm, B. 19,5 cm.
Erhaltung: Wenige Flicken und einzelne Sprungbleie im gelben
Rahmen. Außenseitige Flächenkorrosion. Malerei weitgehend
intakt. Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition: Das Wappen derer von Reichenau,
eines alten fränkischen Adelsgeschlechts mit Stammsitz bei
Feuchtwangen, zeigt den dreifach rot/silber/schwarz/silber
geteilten Schild, als Helmzier zwei entsprechend geteilte Büffel-
hörner, dazwischen einen silbergelben Vogel. Hellblauer Stech-
Abb. 428L
heim; Helmdecken weiß5. Die nachgeordnete, heraldisch linke
Position des Wappens, ersichtlich an der Neigung, spricht für ein
Frauenwappen (vgl. 2b).
Komposition, Farbigkeit: Wappen s. Ikonographie. Blauer Grund,
gelber Langpaß und weiße Eckzwickel.
Ornament: Hintergrund mit ausradiertem Nierenblatt.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1400.
CVMA KB 291/7
Bibliographie: Hollinger-Croner, 1928, S. 11 (erwähnt die Glasgemälde im Kontext der um 1400 in die Pfarr-
kirche transferierten Grablege der Herren von Leonrod); Kurzinventar Neustadt/Aisch, 1972, S. 53 (erwähnt Wap-
penscheiben der Reichenau und Leonrod mit falscher Datierung ins 16. Jh.); Fitz-Ulrich, 1984, S. 138 (listet die
Wappenscheiben Reichenau und Leonrod auf, datiert beide Mitte 15. Jh.).
Gegenwärtiger Bestand: Zwei kleine Rechteckwappen der Zeit um 1400 in Chorfenster süd II (Abb. 428L); im
Langhausfenster süd III außerdem eine Farbverglasung von 19081.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung, zur Frage des ursprünglichen Standorts: Die Pfarrkirche St.
Andreas, eine Chorturmkirche mit eingezogenem quadratischen Chor und einschiffigem Langhaus, geht - obgleich
erstmals 1431 erwähnt - in ihren Ursprüngen auf einen spätromanischen Vorgängerbau zurück, von dem sich Teile der
Langhausmauer sowie West- und Südportal erhalten haben (ein Pfarrer wird bereits 1297 genannt)2. Kirchenpolitisch
gehörte Dietenhofen zum Bistum Würzburg. Das Patronat lag vom frühen 1 5. Jahrhundert an bis 1684 bei den Herren
von Leonrod3, die auf der nahegelegenen Burg Leonrod ihren Stammsitz und seit 1400 ihre Grablege in der Pfarrkir-
che zu Dietenhofen hatten. Unter den Angehörigen des Geschlechts kommen als Fensterstifter bevorzugt Georg IV
oder Hans VI. von Leonrod in Betracht: Georg war der erste, von dem wir urkundlich wissen, daß er 1429 in der
Pfarrkirche beigesetzt wurde; Hans VI. dagegen hatte den Ort mit allen Rechten und Zugehörigen im Jahr 1420
erworben und war zum Begründer der Dietenhofener Linie geworden. Überdies war Wilhelm von Leonrod, ein Bru-
der von Hans VI., von 1393 bis 1402 Pfarrer in Dietenhofen, später Dompropst in Eichstätt und Vertreter des Bistums
auf dem Konstanzer Konzil. Der im dritten Viertel des 15. Jahrhunderts neu errichtete Chorturm mit seinen beiden
zweibahnigen Maßwerkfenstern auf der Ost- und Südseite kommt als ursprünglicher Standort der beiden Wappen-
scheiben nicht in Betracht, da die lichte Weite der Fensterlanzetten die Breite der schmalen Rechteckfelder bei weitem
übersteigt. Möglicherweise waren die Wappenscheiben aus den Fenstern des alten Chors übertragen worden. Bei der
Renovierung 1882 befanden sich die Glasgemälde bereits im Chor4.
Technik, Stil, Datierung: Machart, Stil und Ornamentik verbinden die beiden Dietenhofener Wappenscheiben mit
der umfangreichen, auch ins Umland exportierten Produktion Nürnberger Glasmalerei des ausgehenden 14. und
beginnenden 15. Jahrhunderts, wie sie im vorliegenden Band durch figürliche Farbverglasungen in Großhabersdorf
(Abb. 90-95) und Markt Erlbach (Abb. 185-195) vertreten ist. In Komposition, Schild-, Helm- und Deckenform sind
hier besonders die Wappen in den Fenstern der Nürnberger Kirchen St. Sebald und St. Martha zu vergleichen, die ins
letzte Viertel des 14. Jahrhunderts datieren.
Vorbemerkung zum Katalog: Die Glasgemälde wurden im Januar 2002 in situ untersucht und aufgenommen.
CHORFENSTER süd II
2a WAPPEN REICHENAU Abb. 429
H. 37,5 cm, B. 19,5 cm.
Erhaltung: Wenige Flicken und einzelne Sprungbleie im gelben
Rahmen. Außenseitige Flächenkorrosion. Malerei weitgehend
intakt. Bleinetz erneuert.
Ikonographie, Komposition: Das Wappen derer von Reichenau,
eines alten fränkischen Adelsgeschlechts mit Stammsitz bei
Feuchtwangen, zeigt den dreifach rot/silber/schwarz/silber
geteilten Schild, als Helmzier zwei entsprechend geteilte Büffel-
hörner, dazwischen einen silbergelben Vogel. Hellblauer Stech-
Abb. 428L
heim; Helmdecken weiß5. Die nachgeordnete, heraldisch linke
Position des Wappens, ersichtlich an der Neigung, spricht für ein
Frauenwappen (vgl. 2b).
Komposition, Farbigkeit: Wappen s. Ikonographie. Blauer Grund,
gelber Langpaß und weiße Eckzwickel.
Ornament: Hintergrund mit ausradiertem Nierenblatt.
Stil, Datierung: Nürnberg, um 1400.
CVMA KB 291/7