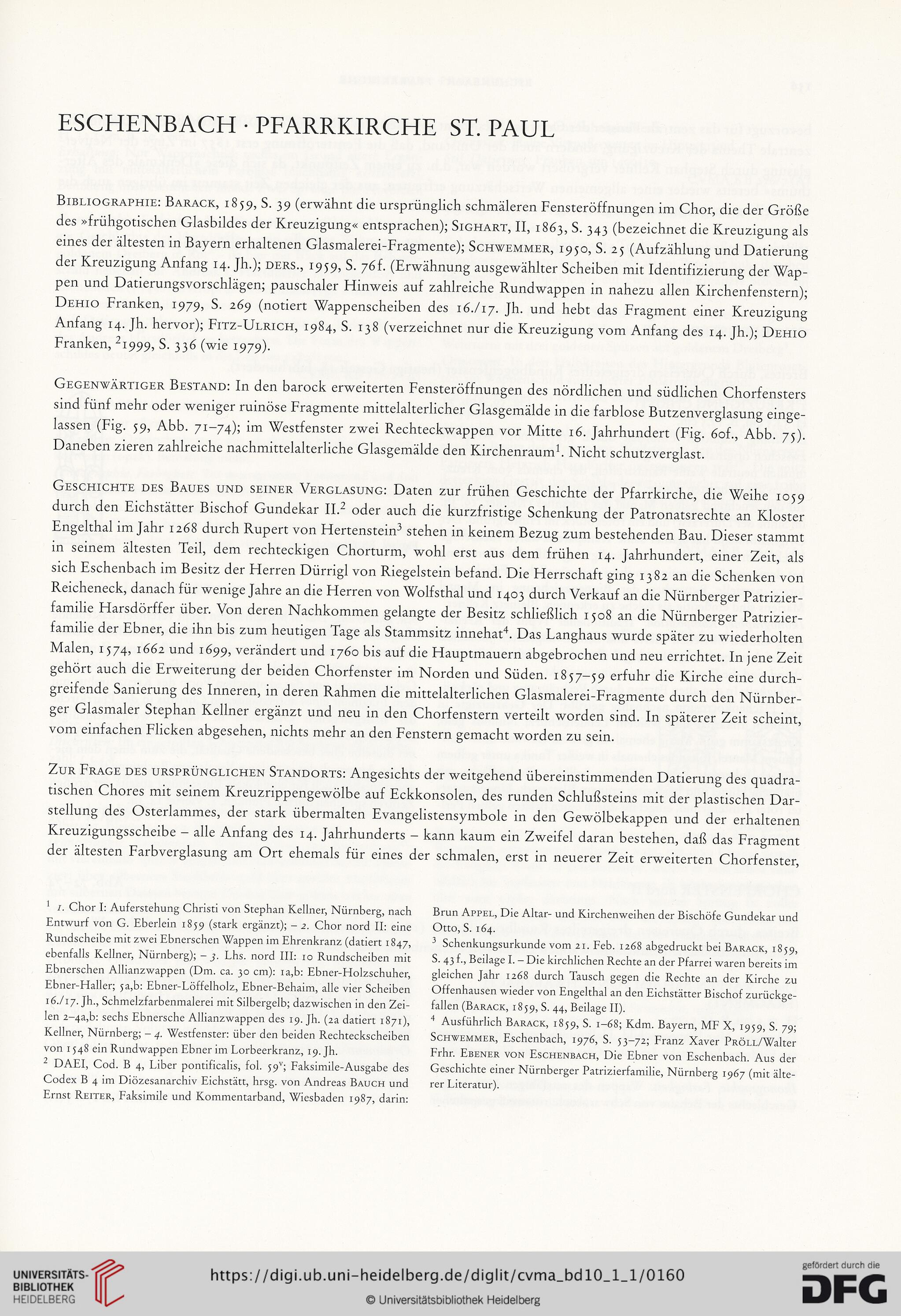ESCHENBACH ■ PFARRKIRCHE ST. PAUL
Bibliographie: Barack, 1859, S. 39 (erwähnt die ursprünglich schmäleren Fensteröffnungen im Chor, die der Größe
des »frühgotischen Glasbildes der Kreuzigung« entsprachen); Sighart, II, 1863, S. 343 (bezeichnet die Kreuzigung als
eines der ältesten in Bayern erhaltenen Glasmalerei-Fragmente); Schwemmer, 1950, S. 25 (Aufzählung und Datierung
der Kreuzigung Anfang 14. Jh.); ders., 1959, S. 76f. (Erwähnung ausgewählter Scheiben mit Identifizierung der Wap-
pen und Datierungsvorschlägen; pauschaler Hinweis auf zahlreiche Rundwappen in nahezu allen Kirchenfenstern);
Dehio Franken, 1979, S. 269 (notiert Wappenscheiben des 16./17. Jh. und hebt das Fragment einer Kreuzigung
Anfang 14. Jh. hervor); Fitz-Ulrich, 1984, S. 138 (verzeichnet nur die Kreuzigung vom Anfang des 14. Jh.); Dehio
Franken, 2i999, S. 336 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: In den barock erweiterten Fensteröffnungen des nördlichen und südlichen Chorfensters
sind fünf mehr oder weniger ruinöse Fragmente mittelalterlicher Glasgemälde in die farblose Butzenverglasung einge-
lassen (Fig. 59, Abb. 71-74); im Westfenster zwei Rechteckwappen vor Mitte 16. Jahrhundert (Fig. 6of., Abb. 75).
Daneben zieren zahlreiche nachmittelalterliche Glasgemälde den Kirchenraum1. Nicht schutzverglast.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Daten zur frühen Geschichte der Pfarrkirche, die Weihe 1059
durch den Eichstätter Bischof Gundekar II.2 oder auch die kurzfristige Schenkung der Patronatsrechte an Kloster
Engelthal im Jahr 1268 durch Rupert von Hertenstein3 stehen in keinem Bezug zum bestehenden Bau. Dieser stammt
in seinem ältesten Teil, dem rechteckigen Chorturm, wohl erst aus dem frühen 14. Jahrhundert, einer Zeit, als
sich Eschenbach im Besitz der Herren Dürrigl von Riegelstein befand. Die Herrschaft ging 1382 an die Schenken von
Reicheneck, danach für wenige Jahre an die Herren von Wolfsthal und 1403 durch Verkauf an die Nürnberger Patrizier-
familie Harsdörffer über. Von deren Nachkommen gelangte der Besitz schließlich 1508 an die Nürnberger Patrizier-
familie der Ebner, die ihn bis zum heutigen Tage als Stammsitz innehat4. Das Langhaus wurde später zu wiederholten
Malen, 1574, 1662 und 1699, verändert und 1760 bis auf die Hauptmauern abgebrochen und neu errichtet. In jene Zeit
gehört auch die Erweiterung der beiden Chorfenster im Norden und Süden. 1857-59 erfuhr die Kirche eine durch-
greifende Sanierung des Inneren, in deren Rahmen die mittelalterlichen Glasmalerei-Fragmente durch den Nürnber-
ger Glasmaler Stephan Kellner ergänzt und neu in den Chorfenstern verteilt worden sind. In späterer Zeit scheint,
vom einfachen Flicken abgesehen, nichts mehr an den Fenstern gemacht worden zu sein.
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Angesichts der weitgehend übereinstimmenden Datierung des quadra-
tischen Chores mit seinem Kreuzrippengewölbe auf Eckkonsolen, des runden Schlußsteins mit der plastischen Dar-
stellung des Osterlammes, der stark übermalten Evangelistensymbole in den Gewölbekappen und der erhaltenen
Kreuzigungsscheibe - alle Anfang des 14. Jahrhunderts - kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß das Fragment
der ältesten Farbverglasung am Ort ehemals für eines der schmalen, erst in neuerer Zeit erweiterten Chorfenster,
1 1. Chor I: Auferstehung Christi von Stephan Kellner, Nürnberg, nach
Entwurf von G. Eberlein 1859 (stark ergänzt); - 2. Chor nord II: eine
Rundscheibe mit zwei Ebnerschen Wappen im Ehrenkranz (datiert 1847,
ebenfalls Kellner, Nürnberg); -5. Lhs. nord III: 10 Rundscheiben mit
Ebnerschen Allianzwappen (Dm. ca. 30 cm): ia,b: Ebner-Holzschuher,
Ebner-Haller; 5a,b: Ebner-Löffelholz, Ebner-Behaim, alle vier Scheiben
16./17. Jh., Schmelzfarbenmalerei mit Silbergelb; dazwischen in den Zei-
len 2-43,b: sechs Ebnersche Allianzwappen des 19. Jh. (za datiert 1871),
Kellner, Nürnberg; - 4. Westfenster: über den beiden Rechteckscheiben
von 1548 ein Rundwappen Ebner im Lorbeerkranz, 19. Jh.
2 DAEI, Cod. B 4, Liber pontificalis, fol. 59'; Faksimile-Ausgabe des
Codex B 4 im Diözesanarchiv Eichstätt, hrsg. von Andreas Bauch und
Ernst Reiter, Faksimile und Kommentarband, Wiesbaden 1987, darin:
Brun Appel, Die Altar- und Kirchenweihen der Bischöfe Gundekar und
Otto, S. 164.
3 Schenkungsurkunde vom 21. Feb. 1268 abgedruckt bei Barack, 1859,
S. 43 f., Beilage I. - Die kirchlichen Rechte an der Pfarrei waren bereits im
gleichen Jahr 1268 durch Tausch gegen die Rechte an der Kirche zu
Offenhausen wieder von Engelthal an den Eichstätter Bischof zurückge-
fallen (Barack, 1859, S. 44, Beilage II).
4 Ausführlich Barack, 1859, S. 1-68; Kdm. Bayern, MF X, 1959, S. 79;
Schwemmer, Eschenbach, 1976, S. 53-72; Franz Xaver PRÖLL/Walter
Frhr. Ebener von Eschenbach, Die Ebner von Eschenbach. Aus der
Geschichte einer Nürnberger Patrizierfamilie, Nürnberg 1967 (mit älte-
rer Literatur).
Bibliographie: Barack, 1859, S. 39 (erwähnt die ursprünglich schmäleren Fensteröffnungen im Chor, die der Größe
des »frühgotischen Glasbildes der Kreuzigung« entsprachen); Sighart, II, 1863, S. 343 (bezeichnet die Kreuzigung als
eines der ältesten in Bayern erhaltenen Glasmalerei-Fragmente); Schwemmer, 1950, S. 25 (Aufzählung und Datierung
der Kreuzigung Anfang 14. Jh.); ders., 1959, S. 76f. (Erwähnung ausgewählter Scheiben mit Identifizierung der Wap-
pen und Datierungsvorschlägen; pauschaler Hinweis auf zahlreiche Rundwappen in nahezu allen Kirchenfenstern);
Dehio Franken, 1979, S. 269 (notiert Wappenscheiben des 16./17. Jh. und hebt das Fragment einer Kreuzigung
Anfang 14. Jh. hervor); Fitz-Ulrich, 1984, S. 138 (verzeichnet nur die Kreuzigung vom Anfang des 14. Jh.); Dehio
Franken, 2i999, S. 336 (wie 1979).
Gegenwärtiger Bestand: In den barock erweiterten Fensteröffnungen des nördlichen und südlichen Chorfensters
sind fünf mehr oder weniger ruinöse Fragmente mittelalterlicher Glasgemälde in die farblose Butzenverglasung einge-
lassen (Fig. 59, Abb. 71-74); im Westfenster zwei Rechteckwappen vor Mitte 16. Jahrhundert (Fig. 6of., Abb. 75).
Daneben zieren zahlreiche nachmittelalterliche Glasgemälde den Kirchenraum1. Nicht schutzverglast.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Daten zur frühen Geschichte der Pfarrkirche, die Weihe 1059
durch den Eichstätter Bischof Gundekar II.2 oder auch die kurzfristige Schenkung der Patronatsrechte an Kloster
Engelthal im Jahr 1268 durch Rupert von Hertenstein3 stehen in keinem Bezug zum bestehenden Bau. Dieser stammt
in seinem ältesten Teil, dem rechteckigen Chorturm, wohl erst aus dem frühen 14. Jahrhundert, einer Zeit, als
sich Eschenbach im Besitz der Herren Dürrigl von Riegelstein befand. Die Herrschaft ging 1382 an die Schenken von
Reicheneck, danach für wenige Jahre an die Herren von Wolfsthal und 1403 durch Verkauf an die Nürnberger Patrizier-
familie Harsdörffer über. Von deren Nachkommen gelangte der Besitz schließlich 1508 an die Nürnberger Patrizier-
familie der Ebner, die ihn bis zum heutigen Tage als Stammsitz innehat4. Das Langhaus wurde später zu wiederholten
Malen, 1574, 1662 und 1699, verändert und 1760 bis auf die Hauptmauern abgebrochen und neu errichtet. In jene Zeit
gehört auch die Erweiterung der beiden Chorfenster im Norden und Süden. 1857-59 erfuhr die Kirche eine durch-
greifende Sanierung des Inneren, in deren Rahmen die mittelalterlichen Glasmalerei-Fragmente durch den Nürnber-
ger Glasmaler Stephan Kellner ergänzt und neu in den Chorfenstern verteilt worden sind. In späterer Zeit scheint,
vom einfachen Flicken abgesehen, nichts mehr an den Fenstern gemacht worden zu sein.
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Angesichts der weitgehend übereinstimmenden Datierung des quadra-
tischen Chores mit seinem Kreuzrippengewölbe auf Eckkonsolen, des runden Schlußsteins mit der plastischen Dar-
stellung des Osterlammes, der stark übermalten Evangelistensymbole in den Gewölbekappen und der erhaltenen
Kreuzigungsscheibe - alle Anfang des 14. Jahrhunderts - kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß das Fragment
der ältesten Farbverglasung am Ort ehemals für eines der schmalen, erst in neuerer Zeit erweiterten Chorfenster,
1 1. Chor I: Auferstehung Christi von Stephan Kellner, Nürnberg, nach
Entwurf von G. Eberlein 1859 (stark ergänzt); - 2. Chor nord II: eine
Rundscheibe mit zwei Ebnerschen Wappen im Ehrenkranz (datiert 1847,
ebenfalls Kellner, Nürnberg); -5. Lhs. nord III: 10 Rundscheiben mit
Ebnerschen Allianzwappen (Dm. ca. 30 cm): ia,b: Ebner-Holzschuher,
Ebner-Haller; 5a,b: Ebner-Löffelholz, Ebner-Behaim, alle vier Scheiben
16./17. Jh., Schmelzfarbenmalerei mit Silbergelb; dazwischen in den Zei-
len 2-43,b: sechs Ebnersche Allianzwappen des 19. Jh. (za datiert 1871),
Kellner, Nürnberg; - 4. Westfenster: über den beiden Rechteckscheiben
von 1548 ein Rundwappen Ebner im Lorbeerkranz, 19. Jh.
2 DAEI, Cod. B 4, Liber pontificalis, fol. 59'; Faksimile-Ausgabe des
Codex B 4 im Diözesanarchiv Eichstätt, hrsg. von Andreas Bauch und
Ernst Reiter, Faksimile und Kommentarband, Wiesbaden 1987, darin:
Brun Appel, Die Altar- und Kirchenweihen der Bischöfe Gundekar und
Otto, S. 164.
3 Schenkungsurkunde vom 21. Feb. 1268 abgedruckt bei Barack, 1859,
S. 43 f., Beilage I. - Die kirchlichen Rechte an der Pfarrei waren bereits im
gleichen Jahr 1268 durch Tausch gegen die Rechte an der Kirche zu
Offenhausen wieder von Engelthal an den Eichstätter Bischof zurückge-
fallen (Barack, 1859, S. 44, Beilage II).
4 Ausführlich Barack, 1859, S. 1-68; Kdm. Bayern, MF X, 1959, S. 79;
Schwemmer, Eschenbach, 1976, S. 53-72; Franz Xaver PRÖLL/Walter
Frhr. Ebener von Eschenbach, Die Ebner von Eschenbach. Aus der
Geschichte einer Nürnberger Patrizierfamilie, Nürnberg 1967 (mit älte-
rer Literatur).