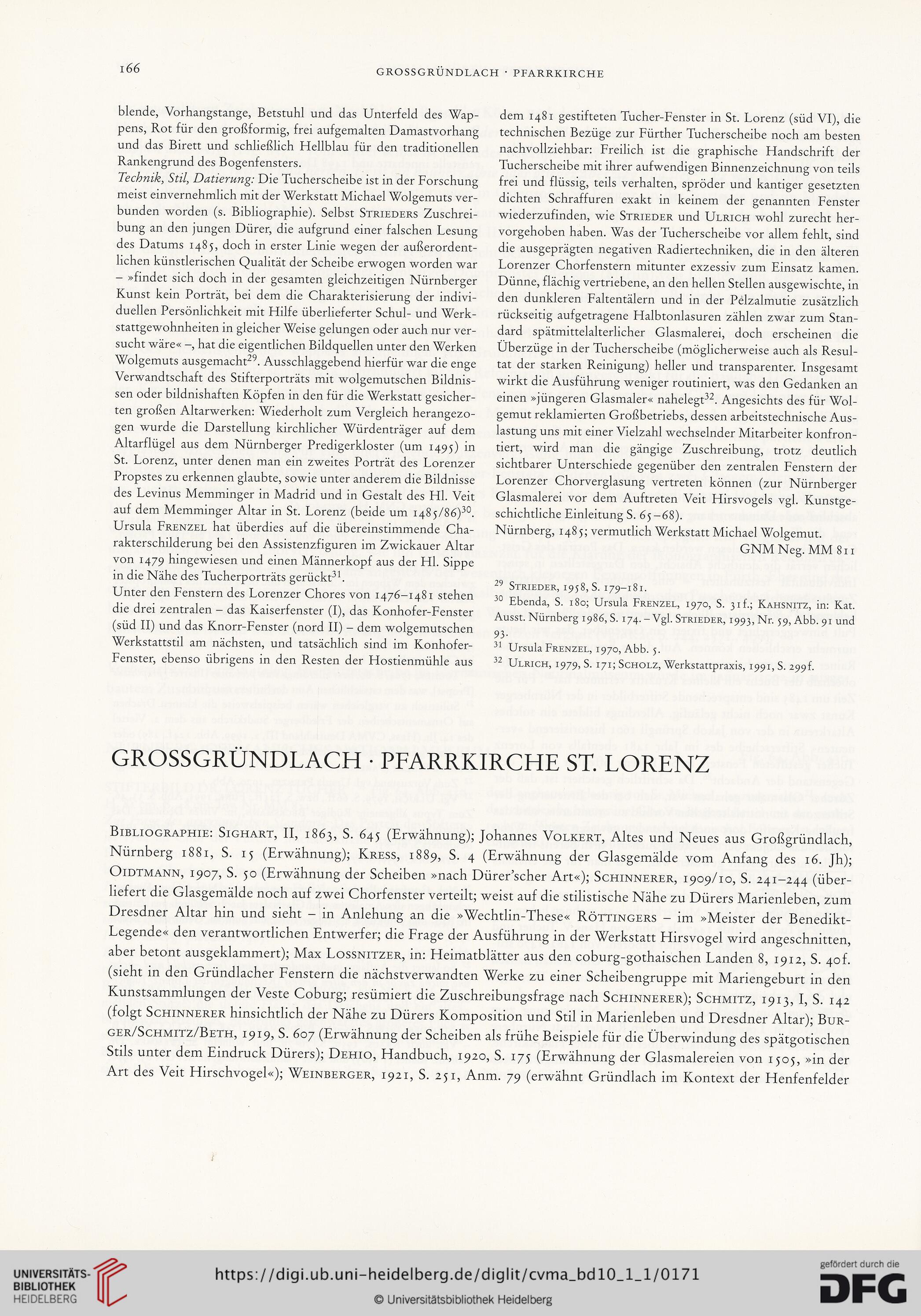i66
GROSSGRÜNDLACH • PFARRKIRCHE
blende, Vorhangstange, Betstuhl und das Unterfeld des Wap-
pens, Rot für den großformig, frei aufgemalten Damastvorhang
und das Birett und schließlich Hellblau für den traditionellen
Rankengrund des Bogenfensters.
Technik, Stil, Datierung: Die Tucherscheibe ist in der Forschung
meist einvernehmlich mit der Werkstatt Michael Wolgemuts ver-
bunden worden (s. Bibliographie). Selbst Strieders Zuschrei-
bung an den jungen Dürer, die aufgrund einer falschen Lesung
des Datums 1485, doch in erster Linie wegen der außerordent-
lichen künstlerischen Qualität der Scheibe erwogen worden war
- »findet sich doch in der gesamten gleichzeitigen Nürnberger
Kunst kein Porträt, bei dem die Charakterisierung der indivi-
duellen Persönlichkeit mit Hilfe überlieferter Schul- und Werk-
stattgewohnheiten in gleicher Weise gelungen oder auch nur ver-
sucht wäre« -, hat die eigentlichen Bildquellen unter den Werken
Wolgemuts ausgemacht29. Ausschlaggebend hierfür war die enge
Verwandtschaft des Stifterporträts mit wolgemutschen Bildnis-
sen oder bildnishaften Köpfen in den für die Werkstatt gesicher-
ten großen Altarwerken: Wiederholt zum Vergleich herangezo-
gen wurde die Darstellung kirchlicher Würdenträger auf dem
Altarflügel aus dem Nürnberger Predigerkloster (um 1495) in
St. Lorenz, unter denen man ein zweites Porträt des Lorenzer
Propstes zu erkennen glaubte, sowie unter anderem die Bildnisse
des Levinus Memminger in Madrid und in Gestalt des Hl. Veit
auf dem Memminger Altar in St. Lorenz (beide um 1485/86)30.
Ursula Frenzel hat überdies auf die übereinstimmende Cha-
rakterschilderung bei den Assistenzfiguren im Zwickauer Altar
von 1479 hingewiesen und einen Männerkopf aus der Hl. Sippe
in die Nähe des Tucherporträts gerückt31.
Unter den Fenstern des Lorenzer Chores von 1476-1481 stehen
die drei zentralen - das Kaiserfenster (I), das Konhofer-Fenster
(süd II) und das Knorr-Fenster (nord II) - dem wolgemutschen
Werkstattstil am nächsten, und tatsächlich sind im Konhofer-
Fenster, ebenso übrigens in den Resten der Hostienmühle aus
dem 1481 gestifteten Tucher-Fenster in St. Lorenz (süd VI), die
technischen Bezüge zur Fürther Tucherscheibe noch am besten
nachvollziehbar: Freilich ist die graphische Handschrift der
Tucherscheibe mit ihrer aufwendigen Binnenzeichnung von teils
frei und flüssig, teils verhalten, spröder und kantiger gesetzten
dichten Schraffuren exakt in keinem der genannten Fenster
wiederzufinden, wie Strieder und Ulrich wohl zurecht her-
vorgehoben haben. Was der Tucherscheibe vor allem fehlt, sind
die ausgeprägten negativen Radiertechniken, die in den älteren
Lorenzer Chorfenstern mitunter exzessiv zum Einsatz kamen.
Dünne, flächig vertriebene, an den hellen Stellen ausgewischte, in
den dunkleren Faltentälern und in der Pelzalmutie zusätzlich
rückseitig aufgetragene Halbtonlasuren zählen zwar zum Stan-
dard spätmittelalterlicher Glasmalerei, doch erscheinen die
Überzüge in der Tucherscheibe (möglicherweise auch als Resul-
tat der starken Reinigung) heller und transparenter. Insgesamt
wirkt die Ausführung weniger routiniert, was den Gedanken an
einen »jüngeren Glasmaler« nahelegt32. Angesichts des für Wol-
gemut reklamierten Großbetriebs, dessen arbeitstechnische Aus-
lastung uns mit einer Vielzahl wechselnder Mitarbeiter konfron-
tiert, wird man die gängige Zuschreibung, trotz deutlich
sichtbarer Unterschiede gegenüber den zentralen Fenstern der
Lorenzer Chorverglasung vertreten können (zur Nürnberger
Glasmalerei vor dem Auftreten Veit Hirsvogels vgl. Kunstge-
schichtliche Einleitung S. 65-68).
Nürnberg, 1485; vermutlich Werkstatt Michael Wolgemut.
GNM Neg. MM 811
29 Strieder, 1958, S. 179-181.
30 Ebenda, S. 180; Ursula Frenzel, 1970, S. 31 f.; Kahsnitz, in: Kat.
Ausst. Nürnberg 1986, S. 174. - Vgl. Strieder, 1993, Nr. 59, Abb. 91 und
93-
31 Ursula Frenzel, 1970, Abb. 5.
32 Ulrich, 1979, S. 171; Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 299b
GROSSGRÜNDLACH • PFARRKIRCHE ST. LORENZ
Bibliographie: Sighart, II, 1863, S. 645 (Erwähnung); Johannes Volkert, Altes und Neues aus Großgründlach,
Nürnberg 1881, S. 15 (Erwähnung); Kress, 1889, S. 4 (Erwähnung der Glasgemälde vom Anfang des 16. Jh);
Oidtmann, 1907, S. 50 (Erwähnung der Scheiben »nach Dürer’scher Art«); Schinnerer, 1909/10, S. 241-244 (über-
liefert die Glasgemälde noch auf zwei Chorfenster verteilt; weist auf die stilistische Nähe zu Dürers Marienleben, zum
Dresdner Altar hin und sieht - in Anlehung an die »Wechtlin-These« Röttingers - im »Meister der Benedikt-
Legende« den verantwortlichen Entwerfer; die Frage der Ausführung in der Werkstatt Hirsvogel wird angeschnitten,
aber betont ausgeklammert); Max Lössnitzer, in: Heimatblätter aus den coburg-gothaischen Landen 8, 1912, S. 40E
(sieht in den Gründlacher Fenstern die nächstverwandten Werke zu einer Scheibengruppe mit Mariengeburt in den
Kunstsammlungen der Veste Coburg; resümiert die Zuschreibungsfrage nach Schinnerer); Schmitz, 1913, I, S. 142
(folgt Schinnerer hinsichtlich der Nähe zu Dürers Komposition und Stil in Marienleben und Dresdner Altar); Bur-
ger/Schmitz/Beth, 1919, S. 607 (Erwähnung der Scheiben als frühe Beispiele für die Überwindung des spätgotischen
Stils unter dem Eindruck Dürers); Dehio, Handbuch, 1920, S. 175 (Erwähnung der Glasmalereien von 1505, »in der
Art des Veit Hirschvogel«); Weinberger, 1921, S. 251, Anm. 79 (erwähnt Gründlach im Kontext der Henfenfelder
GROSSGRÜNDLACH • PFARRKIRCHE
blende, Vorhangstange, Betstuhl und das Unterfeld des Wap-
pens, Rot für den großformig, frei aufgemalten Damastvorhang
und das Birett und schließlich Hellblau für den traditionellen
Rankengrund des Bogenfensters.
Technik, Stil, Datierung: Die Tucherscheibe ist in der Forschung
meist einvernehmlich mit der Werkstatt Michael Wolgemuts ver-
bunden worden (s. Bibliographie). Selbst Strieders Zuschrei-
bung an den jungen Dürer, die aufgrund einer falschen Lesung
des Datums 1485, doch in erster Linie wegen der außerordent-
lichen künstlerischen Qualität der Scheibe erwogen worden war
- »findet sich doch in der gesamten gleichzeitigen Nürnberger
Kunst kein Porträt, bei dem die Charakterisierung der indivi-
duellen Persönlichkeit mit Hilfe überlieferter Schul- und Werk-
stattgewohnheiten in gleicher Weise gelungen oder auch nur ver-
sucht wäre« -, hat die eigentlichen Bildquellen unter den Werken
Wolgemuts ausgemacht29. Ausschlaggebend hierfür war die enge
Verwandtschaft des Stifterporträts mit wolgemutschen Bildnis-
sen oder bildnishaften Köpfen in den für die Werkstatt gesicher-
ten großen Altarwerken: Wiederholt zum Vergleich herangezo-
gen wurde die Darstellung kirchlicher Würdenträger auf dem
Altarflügel aus dem Nürnberger Predigerkloster (um 1495) in
St. Lorenz, unter denen man ein zweites Porträt des Lorenzer
Propstes zu erkennen glaubte, sowie unter anderem die Bildnisse
des Levinus Memminger in Madrid und in Gestalt des Hl. Veit
auf dem Memminger Altar in St. Lorenz (beide um 1485/86)30.
Ursula Frenzel hat überdies auf die übereinstimmende Cha-
rakterschilderung bei den Assistenzfiguren im Zwickauer Altar
von 1479 hingewiesen und einen Männerkopf aus der Hl. Sippe
in die Nähe des Tucherporträts gerückt31.
Unter den Fenstern des Lorenzer Chores von 1476-1481 stehen
die drei zentralen - das Kaiserfenster (I), das Konhofer-Fenster
(süd II) und das Knorr-Fenster (nord II) - dem wolgemutschen
Werkstattstil am nächsten, und tatsächlich sind im Konhofer-
Fenster, ebenso übrigens in den Resten der Hostienmühle aus
dem 1481 gestifteten Tucher-Fenster in St. Lorenz (süd VI), die
technischen Bezüge zur Fürther Tucherscheibe noch am besten
nachvollziehbar: Freilich ist die graphische Handschrift der
Tucherscheibe mit ihrer aufwendigen Binnenzeichnung von teils
frei und flüssig, teils verhalten, spröder und kantiger gesetzten
dichten Schraffuren exakt in keinem der genannten Fenster
wiederzufinden, wie Strieder und Ulrich wohl zurecht her-
vorgehoben haben. Was der Tucherscheibe vor allem fehlt, sind
die ausgeprägten negativen Radiertechniken, die in den älteren
Lorenzer Chorfenstern mitunter exzessiv zum Einsatz kamen.
Dünne, flächig vertriebene, an den hellen Stellen ausgewischte, in
den dunkleren Faltentälern und in der Pelzalmutie zusätzlich
rückseitig aufgetragene Halbtonlasuren zählen zwar zum Stan-
dard spätmittelalterlicher Glasmalerei, doch erscheinen die
Überzüge in der Tucherscheibe (möglicherweise auch als Resul-
tat der starken Reinigung) heller und transparenter. Insgesamt
wirkt die Ausführung weniger routiniert, was den Gedanken an
einen »jüngeren Glasmaler« nahelegt32. Angesichts des für Wol-
gemut reklamierten Großbetriebs, dessen arbeitstechnische Aus-
lastung uns mit einer Vielzahl wechselnder Mitarbeiter konfron-
tiert, wird man die gängige Zuschreibung, trotz deutlich
sichtbarer Unterschiede gegenüber den zentralen Fenstern der
Lorenzer Chorverglasung vertreten können (zur Nürnberger
Glasmalerei vor dem Auftreten Veit Hirsvogels vgl. Kunstge-
schichtliche Einleitung S. 65-68).
Nürnberg, 1485; vermutlich Werkstatt Michael Wolgemut.
GNM Neg. MM 811
29 Strieder, 1958, S. 179-181.
30 Ebenda, S. 180; Ursula Frenzel, 1970, S. 31 f.; Kahsnitz, in: Kat.
Ausst. Nürnberg 1986, S. 174. - Vgl. Strieder, 1993, Nr. 59, Abb. 91 und
93-
31 Ursula Frenzel, 1970, Abb. 5.
32 Ulrich, 1979, S. 171; Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 299b
GROSSGRÜNDLACH • PFARRKIRCHE ST. LORENZ
Bibliographie: Sighart, II, 1863, S. 645 (Erwähnung); Johannes Volkert, Altes und Neues aus Großgründlach,
Nürnberg 1881, S. 15 (Erwähnung); Kress, 1889, S. 4 (Erwähnung der Glasgemälde vom Anfang des 16. Jh);
Oidtmann, 1907, S. 50 (Erwähnung der Scheiben »nach Dürer’scher Art«); Schinnerer, 1909/10, S. 241-244 (über-
liefert die Glasgemälde noch auf zwei Chorfenster verteilt; weist auf die stilistische Nähe zu Dürers Marienleben, zum
Dresdner Altar hin und sieht - in Anlehung an die »Wechtlin-These« Röttingers - im »Meister der Benedikt-
Legende« den verantwortlichen Entwerfer; die Frage der Ausführung in der Werkstatt Hirsvogel wird angeschnitten,
aber betont ausgeklammert); Max Lössnitzer, in: Heimatblätter aus den coburg-gothaischen Landen 8, 1912, S. 40E
(sieht in den Gründlacher Fenstern die nächstverwandten Werke zu einer Scheibengruppe mit Mariengeburt in den
Kunstsammlungen der Veste Coburg; resümiert die Zuschreibungsfrage nach Schinnerer); Schmitz, 1913, I, S. 142
(folgt Schinnerer hinsichtlich der Nähe zu Dürers Komposition und Stil in Marienleben und Dresdner Altar); Bur-
ger/Schmitz/Beth, 1919, S. 607 (Erwähnung der Scheiben als frühe Beispiele für die Überwindung des spätgotischen
Stils unter dem Eindruck Dürers); Dehio, Handbuch, 1920, S. 175 (Erwähnung der Glasmalereien von 1505, »in der
Art des Veit Hirschvogel«); Weinberger, 1921, S. 251, Anm. 79 (erwähnt Gründlach im Kontext der Henfenfelder