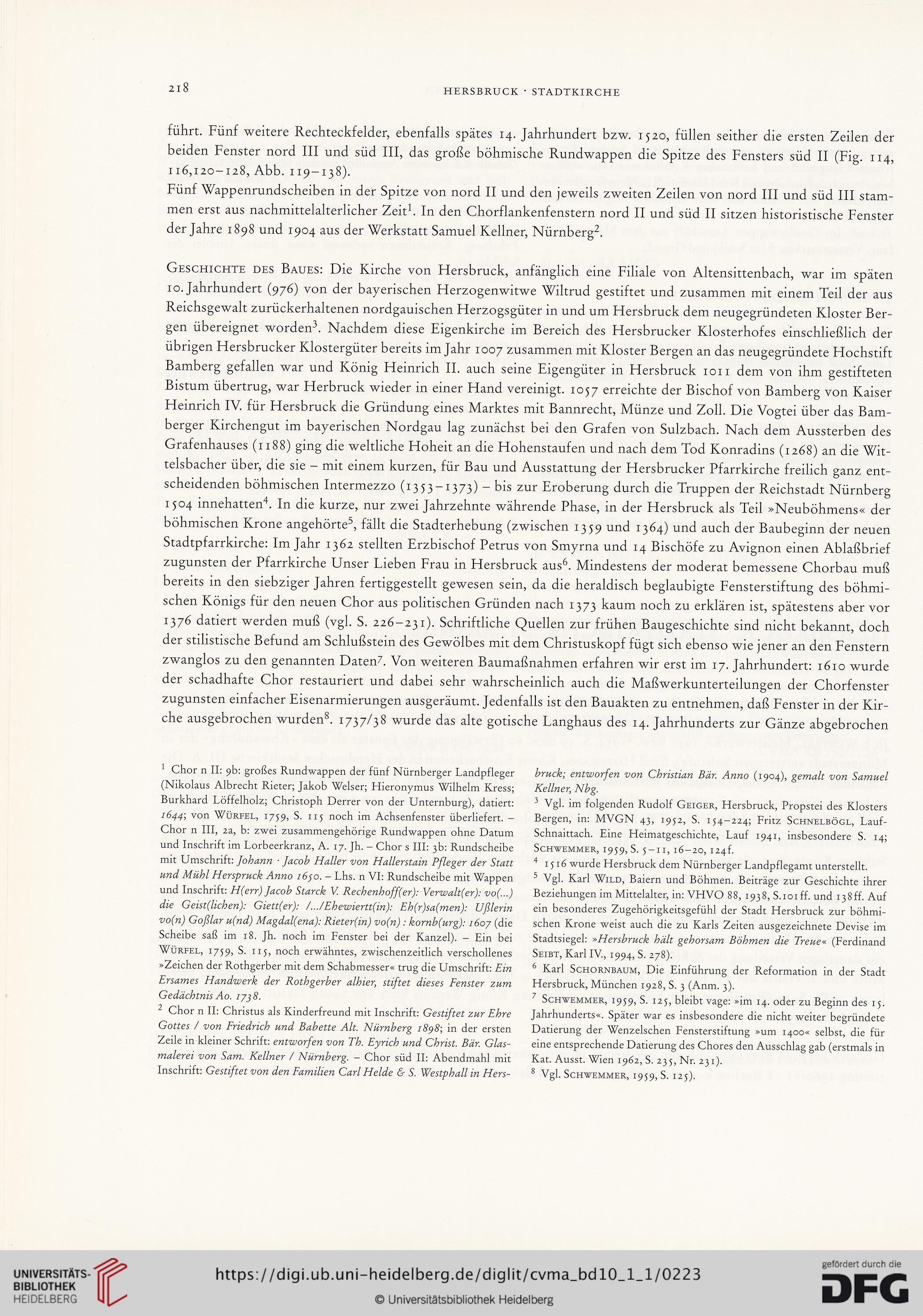218
HERSBRUCK • STADTKIRCHE
führt. Fünf weitere Rechteckfelder, ebenfalls spätes 14. Jahrhundert bzw. 1520, füllen seither die ersten Zeilen der
beiden Fenster nord III und süd III, das große böhmische Rundwappen die Spitze des Fensters süd II (Fig. 114,
116,120-128, Abb. 119—138).
Fünf Wappenrundscheiben in der Spitze von nord II und den jeweils zweiten Zeilen von nord III und süd III stam-
men erst aus nachmittelalterlicher Zeit1. In den Chorflankenfenstern nord II und süd II sitzen historistische Fenster
der Jahre 1898 und 1904 aus der Werkstatt Samuel Kellner, Nürnberg2.
Geschichte des Baues: Die Kirche von Hersbruck, anfänglich eine Filiale von Altensittenbach, war im späten
10. Jahrhundert (976) von der bayerischen Herzogenwitwe Wiltrud gestiftet und zusammen mit einem Teil der aus
Reichsgewalt zurückerhaltenen nordgauischen Herzogsgüter in und um Hersbruck dem neugegründeten Kloster Ber-
gen übereignet worden3. Nachdem diese Eigenkirche im Bereich des Hersbrucker Klosterhofes einschließlich der
übrigen Hersbrucker Klostergüter bereits im Jahr 1007 zusammen mit Kloster Bergen an das neugegründete Hochstift
Bamberg gefallen war und König Heinrich II. auch seine Eigengüter in Hersbruck 1011 dem von ihm gestifteten
Bistum übertrug, war Herbruck wieder in einer Hand vereinigt. 1057 erreichte der Bischof von Bamberg von Kaiser
Heinrich IV. für Hersbruck die Gründung eines Marktes mit Bannrecht, Münze und Zoll. Die Vogtei über das Bam-
berger Kirchengut im bayerischen Nordgau lag zunächst bei den Grafen von Sulzbach. Nach dem Aussterben des
Grafenhauses (1188) ging die weltliche Hoheit an die Hohenstaufen und nach dem Tod Konradins (1268) an die Wit-
telsbacher über, die sie - mit einem kurzen, für Bau und Ausstattung der Hersbrucker Pfarrkirche freilich ganz ent-
scheidenden böhmischen Intermezzo (1353-1373)- bis zur Eroberung durch die Truppen der Reichstadt Nürnberg
1504 innehatten4. In die kurze, nur zwei Jahrzehnte währende Phase, in der Hersbruck als Teil »Neuböhmens« der
böhmischen Krone angehörte5, fällt die Stadterhebung (zwischen 1359 und 1364) und auch der Baubeginn der neuen
Stadtpfarrkirche: Im Jahr 1362 stellten Erzbischof Petrus von Smyrna und 14 Bischöfe zu Avignon einen Ablaßbrief
zugunsten der Pfarrkirche Unser Lieben Frau in Hersbruck aus6. Mindestens der moderat bemessene Chorbau muß
bereits in den siebziger Jahren fertiggestellt gewesen sein, da die heraldisch beglaubigte Fensterstiftung des böhmi-
schen Königs für den neuen Chor aus politischen Gründen nach 1373 kaum noch zu erklären ist, spätestens aber vor
1376 datiert werden muß (vgl. S. 226-231). Schriftliche Quellen zur frühen Baugeschichte sind nicht bekannt, doch
der stilistische Befund am Schlußstein des Gewölbes mit dem Christuskopf fügt sich ebenso wie jener an den Fenstern
zwanglos zu den genannten Daten?. Von weiteren Baumaßnahmen erfahren wir erst im 17. Jahrhundert: 1610 wurde
der schadhafte Chor restauriert und dabei sehr wahrscheinlich auch die Maßwerkunterteilungen der Chorfenster
zugunsten einfacher Eisenarmierungen ausgeräumt. Jedenfalls ist den Bauakten zu entnehmen, daß Fenster in der Kir-
che ausgebrochen wurden8. 1737/38 wurde das alte gotische Langhaus des 14. Jahrhunderts zur Gänze abgebrochen
1 Chor n II: 9b: großes Rundwappen der fünf Nürnberger Landpfleger
(Nikolaus Albrecht Rieter; Jakob Welser; Hieronymus Wilhelm Kress;
Burkhard Löffelholz; Christoph Derrer von der Unternburg), datiert:
1644', von Würfel, 1759, S. 115 noch im Achsenfenster überliefert. -
Chor n III, 2a, b: zwei zusammengehörige Rundwappen ohne Datum
und Inschrift im Lorbeerkranz, A. 17. Jh. - Chor s III: 3b: Rundscheibe
mit Umschrift: Johann ■ Jacob Haller von Hallerstain Pfleger der Statt
und Mühl Herspruck Anno 1640. - Lhs. n VI: Rundscheibe mit Wappen
und Inschrift: H(err) Jacob Starck V. Rechenhoffler): Verwalt(er): vo(...)
die Geist(lichen): Giett(er): /.../Ehewiertt(in): Eh(r)sa(men): Ußlerin
vo(n) Goßlar u(nd) Magdal(ena): Rieter(in) vo(n) : kornb(urg): 1607 (die
Scheibe saß im 18. Jh. noch im Fenster bei der Kanzel). - Ein bei
Würfel, 1759, S. 115, noch erwähntes, zwischenzeitlich verschollenes
»Zeichen der Rothgerber mit dem Schabmesser« trug die Umschrift: Ein
Ersames Handwerk der Rothgerber alhier, stiftet dieses Fenster zum
Gedächtnis Ao. 1738.
1 Chor n II: Christus als Kinderfreund mit Inschrift: Gestiftet zur Ehre
Gottes / von Friedrich und Babette Alt. Nürnberg 1898; in der ersten
Zeile in kleiner Schrift: entworfen von Th. Eyrich und Christ. Bär. Glas-
malerei von Sam. Kellner / Nürnberg. - Chor süd II: Abendmahl mit
Inschrift: Gestiftet von den Familien Carl Heide & S. Westphall in Hers-
bruck; entworfen von Christian Bär. Anno (1904), gemalt von Samuel
Kellner, Nbg.
3 Vgl. im folgenden Rudolf Geiger, Hersbruck, Propstei des Klosters
Bergen, in: MVGN 43, 1952, S. 154-224; Fritz Schnelbögl, Lauf-
Schnaittach. Eine Heimatgeschichte, Lauf 1941, insbesondere S. 14;
Schwemmer, 1959, S. 5 — 11, 16-20, 124E
4 1516 wurde Hersbruck dem Nürnberger Landpflegamt unterstellt.
5 Vgl. Karl Wild, Baiern und Böhmen. Beiträge zur Geschichte ihrer
Beziehungen im Mittelalter, in: VHVO 88, 1938, S.ioiff. und 13 8 ff. Auf
ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl der Stadt Hersbruck zur böhmi-
schen Krone weist auch die zu Karls Zeiten ausgezeichnete Devise im
Stadtsiegel: »Hersbruck hält gehorsam Böhmen die Treue« (Ferdinand
Seibt, Karl IV., 1994, S. 278).
6 Karl Schornbaum, Die Einführung der Reformation in der Stadt
Hersbruck, München 1928, S. 3 (Anm. 3).
7 Schwemmer, 1959, S. 125, bleibt vage: »im 14. oder zu Beginn des 15.
Jahrhunderts«. Später war es insbesondere die nicht weiter begründete
Datierung der Wenzelschen Fensterstiftung »um 1400« selbst, die für
eine entsprechende Datierung des Chores den Ausschlag gab (erstmals in
Kat. Ausst. Wien 1962, S. 235, Nr. 231).
8 Vgl. Schwemmer, 1959, S. 125).
HERSBRUCK • STADTKIRCHE
führt. Fünf weitere Rechteckfelder, ebenfalls spätes 14. Jahrhundert bzw. 1520, füllen seither die ersten Zeilen der
beiden Fenster nord III und süd III, das große böhmische Rundwappen die Spitze des Fensters süd II (Fig. 114,
116,120-128, Abb. 119—138).
Fünf Wappenrundscheiben in der Spitze von nord II und den jeweils zweiten Zeilen von nord III und süd III stam-
men erst aus nachmittelalterlicher Zeit1. In den Chorflankenfenstern nord II und süd II sitzen historistische Fenster
der Jahre 1898 und 1904 aus der Werkstatt Samuel Kellner, Nürnberg2.
Geschichte des Baues: Die Kirche von Hersbruck, anfänglich eine Filiale von Altensittenbach, war im späten
10. Jahrhundert (976) von der bayerischen Herzogenwitwe Wiltrud gestiftet und zusammen mit einem Teil der aus
Reichsgewalt zurückerhaltenen nordgauischen Herzogsgüter in und um Hersbruck dem neugegründeten Kloster Ber-
gen übereignet worden3. Nachdem diese Eigenkirche im Bereich des Hersbrucker Klosterhofes einschließlich der
übrigen Hersbrucker Klostergüter bereits im Jahr 1007 zusammen mit Kloster Bergen an das neugegründete Hochstift
Bamberg gefallen war und König Heinrich II. auch seine Eigengüter in Hersbruck 1011 dem von ihm gestifteten
Bistum übertrug, war Herbruck wieder in einer Hand vereinigt. 1057 erreichte der Bischof von Bamberg von Kaiser
Heinrich IV. für Hersbruck die Gründung eines Marktes mit Bannrecht, Münze und Zoll. Die Vogtei über das Bam-
berger Kirchengut im bayerischen Nordgau lag zunächst bei den Grafen von Sulzbach. Nach dem Aussterben des
Grafenhauses (1188) ging die weltliche Hoheit an die Hohenstaufen und nach dem Tod Konradins (1268) an die Wit-
telsbacher über, die sie - mit einem kurzen, für Bau und Ausstattung der Hersbrucker Pfarrkirche freilich ganz ent-
scheidenden böhmischen Intermezzo (1353-1373)- bis zur Eroberung durch die Truppen der Reichstadt Nürnberg
1504 innehatten4. In die kurze, nur zwei Jahrzehnte währende Phase, in der Hersbruck als Teil »Neuböhmens« der
böhmischen Krone angehörte5, fällt die Stadterhebung (zwischen 1359 und 1364) und auch der Baubeginn der neuen
Stadtpfarrkirche: Im Jahr 1362 stellten Erzbischof Petrus von Smyrna und 14 Bischöfe zu Avignon einen Ablaßbrief
zugunsten der Pfarrkirche Unser Lieben Frau in Hersbruck aus6. Mindestens der moderat bemessene Chorbau muß
bereits in den siebziger Jahren fertiggestellt gewesen sein, da die heraldisch beglaubigte Fensterstiftung des böhmi-
schen Königs für den neuen Chor aus politischen Gründen nach 1373 kaum noch zu erklären ist, spätestens aber vor
1376 datiert werden muß (vgl. S. 226-231). Schriftliche Quellen zur frühen Baugeschichte sind nicht bekannt, doch
der stilistische Befund am Schlußstein des Gewölbes mit dem Christuskopf fügt sich ebenso wie jener an den Fenstern
zwanglos zu den genannten Daten?. Von weiteren Baumaßnahmen erfahren wir erst im 17. Jahrhundert: 1610 wurde
der schadhafte Chor restauriert und dabei sehr wahrscheinlich auch die Maßwerkunterteilungen der Chorfenster
zugunsten einfacher Eisenarmierungen ausgeräumt. Jedenfalls ist den Bauakten zu entnehmen, daß Fenster in der Kir-
che ausgebrochen wurden8. 1737/38 wurde das alte gotische Langhaus des 14. Jahrhunderts zur Gänze abgebrochen
1 Chor n II: 9b: großes Rundwappen der fünf Nürnberger Landpfleger
(Nikolaus Albrecht Rieter; Jakob Welser; Hieronymus Wilhelm Kress;
Burkhard Löffelholz; Christoph Derrer von der Unternburg), datiert:
1644', von Würfel, 1759, S. 115 noch im Achsenfenster überliefert. -
Chor n III, 2a, b: zwei zusammengehörige Rundwappen ohne Datum
und Inschrift im Lorbeerkranz, A. 17. Jh. - Chor s III: 3b: Rundscheibe
mit Umschrift: Johann ■ Jacob Haller von Hallerstain Pfleger der Statt
und Mühl Herspruck Anno 1640. - Lhs. n VI: Rundscheibe mit Wappen
und Inschrift: H(err) Jacob Starck V. Rechenhoffler): Verwalt(er): vo(...)
die Geist(lichen): Giett(er): /.../Ehewiertt(in): Eh(r)sa(men): Ußlerin
vo(n) Goßlar u(nd) Magdal(ena): Rieter(in) vo(n) : kornb(urg): 1607 (die
Scheibe saß im 18. Jh. noch im Fenster bei der Kanzel). - Ein bei
Würfel, 1759, S. 115, noch erwähntes, zwischenzeitlich verschollenes
»Zeichen der Rothgerber mit dem Schabmesser« trug die Umschrift: Ein
Ersames Handwerk der Rothgerber alhier, stiftet dieses Fenster zum
Gedächtnis Ao. 1738.
1 Chor n II: Christus als Kinderfreund mit Inschrift: Gestiftet zur Ehre
Gottes / von Friedrich und Babette Alt. Nürnberg 1898; in der ersten
Zeile in kleiner Schrift: entworfen von Th. Eyrich und Christ. Bär. Glas-
malerei von Sam. Kellner / Nürnberg. - Chor süd II: Abendmahl mit
Inschrift: Gestiftet von den Familien Carl Heide & S. Westphall in Hers-
bruck; entworfen von Christian Bär. Anno (1904), gemalt von Samuel
Kellner, Nbg.
3 Vgl. im folgenden Rudolf Geiger, Hersbruck, Propstei des Klosters
Bergen, in: MVGN 43, 1952, S. 154-224; Fritz Schnelbögl, Lauf-
Schnaittach. Eine Heimatgeschichte, Lauf 1941, insbesondere S. 14;
Schwemmer, 1959, S. 5 — 11, 16-20, 124E
4 1516 wurde Hersbruck dem Nürnberger Landpflegamt unterstellt.
5 Vgl. Karl Wild, Baiern und Böhmen. Beiträge zur Geschichte ihrer
Beziehungen im Mittelalter, in: VHVO 88, 1938, S.ioiff. und 13 8 ff. Auf
ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl der Stadt Hersbruck zur böhmi-
schen Krone weist auch die zu Karls Zeiten ausgezeichnete Devise im
Stadtsiegel: »Hersbruck hält gehorsam Böhmen die Treue« (Ferdinand
Seibt, Karl IV., 1994, S. 278).
6 Karl Schornbaum, Die Einführung der Reformation in der Stadt
Hersbruck, München 1928, S. 3 (Anm. 3).
7 Schwemmer, 1959, S. 125, bleibt vage: »im 14. oder zu Beginn des 15.
Jahrhunderts«. Später war es insbesondere die nicht weiter begründete
Datierung der Wenzelschen Fensterstiftung »um 1400« selbst, die für
eine entsprechende Datierung des Chores den Ausschlag gab (erstmals in
Kat. Ausst. Wien 1962, S. 235, Nr. 231).
8 Vgl. Schwemmer, 1959, S. 125).