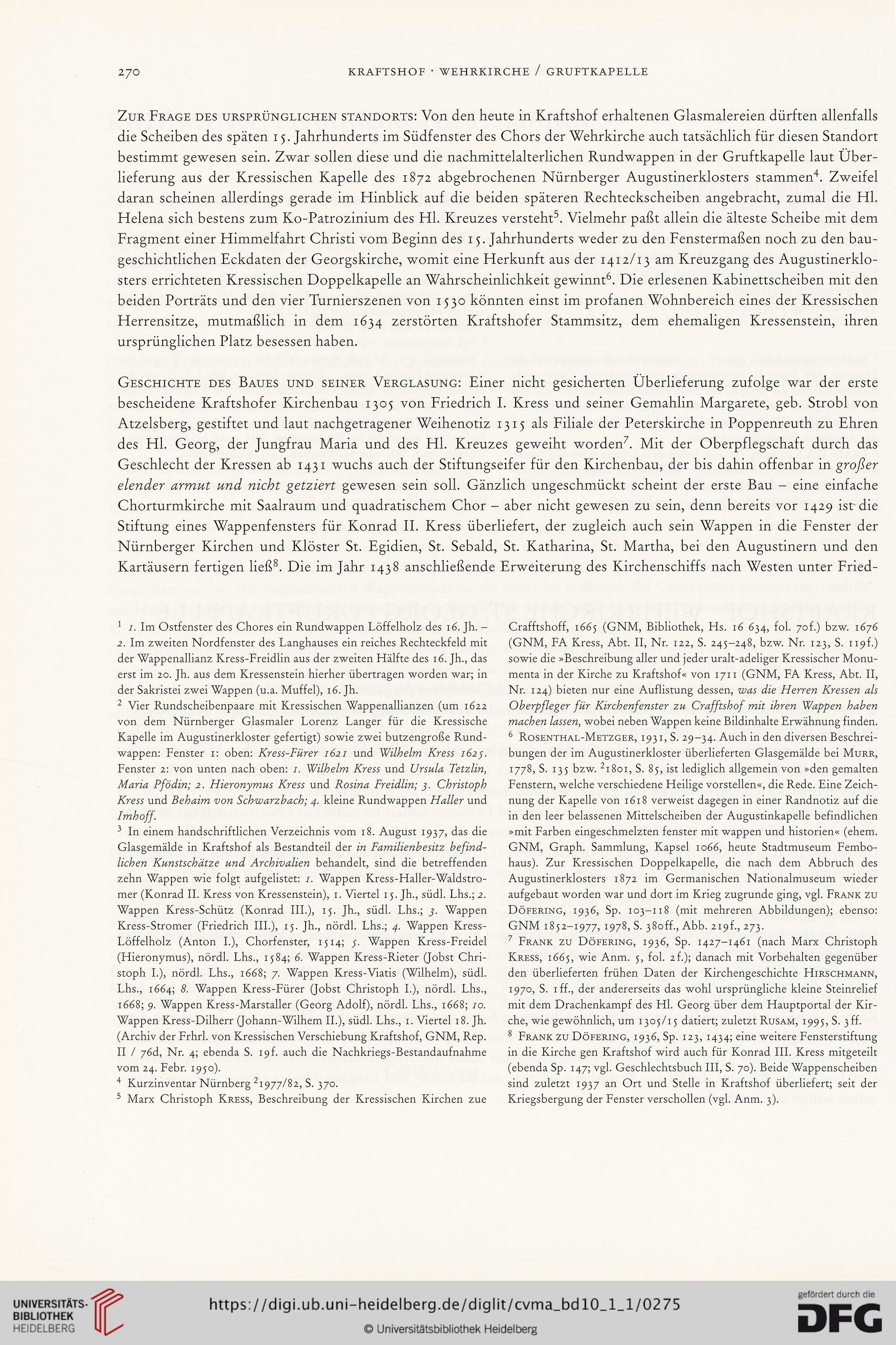2/0
KRAFTSHOF • WEHRKIRCHE / GRUFTKAPELLE
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Von den heute in Kraftshof erhaltenen Glasmalereien dürften allenfalls
die Scheiben des späten 15. Jahrhunderts im Südfenster des Chors der Wehrkirche auch tatsächlich für diesen Standort
bestimmt gewesen sein. Zwar sollen diese und die nachmittelalterlichen Rundwappen in der Gruftkapelle laut Über-
lieferung aus der Kressischen Kapelle des 1872 abgebrochenen Nürnberger Augustinerklosters stammen1 2 3 4. Zweifel
daran scheinen allerdings gerade im Hinblick auf die beiden späteren Rechteckscheiben angebracht, zumal die Hl.
Helena sich bestens zum Ko-Patrozinium des Hl. Kreuzes versteht5. Vielmehr paßt allein die älteste Scheibe mit dem
Fragment einer Himmelfahrt Christi vom Beginn des 15. Jahrhunderts weder zu den Fenstermaßen noch zu den bau-
geschichtlichen Eckdaten der Georgskirche, womit eine Herkunft aus der 1412/13 am Kreuzgang des Augustinerklo-
sters errichteten Kressischen Doppelkapelle an Wahrscheinlichkeit gewinnt6. Die erlesenen Kabinettscheiben mit den
beiden Porträts und den vier Turnierszenen von 1530 könnten einst im profanen Wohnbereich eines der Kressischen
Herrensitze, mutmaßlich in dem 1634 zerstörten Kraftshofer Stammsitz, dem ehemaligen Kressenstein, ihren
ursprünglichen Platz besessen haben.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Einer nicht gesicherten Überlieferung zufolge war der erste
bescheidene Kraftshofer Kirchenbau 1305 von Friedrich I. Kress und seiner Gemahlin Margarete, geb. Strobl von
Atzelsberg, gestiftet und laut nachgetragener Weihenotiz 1315 als Filiale der Peterskirche in Poppenreuth zu Ehren
des Hl. Georg, der Jungfrau Maria und des Hl. Kreuzes geweiht worden7. Mit der Oberpflegschaft durch das
Geschlecht der Kressen ab 1431 wuchs auch der Stiftungseifer für den Kirchenbau, der bis dahin offenbar in großer
elender armut und nicht getziert gewesen sein soll. Gänzlich ungeschmückt scheint der erste Bau - eine einfache
Chorturmkirche mit Saalraum und quadratischem Chor - aber nicht gewesen zu sein, denn bereits vor 1429 ist die
Stiftung eines Wappenfensters für Konrad IE Kress überliefert, der zugleich auch sein Wappen in die Fenster der
Nürnberger Kirchen und Klöster St. Egidien, St. Sebald, St. Katharina, St. Martha, bei den Augustinern und den
Kartäusern fertigen ließ8. Die im Jahr 1438 anschließende Erweiterung des Kirchenschiffs nach Westen unter Fried-
1 1. Im Ostfenster des Chores ein Rundwappen Löffelholz des 16. Jh. -
2. Im zweiten Nordfenster des Langhauses ein reiches Rechteckfeld mit
der Wappenallianz Kress-Freidlin aus der zweiten Hälfte des 16. Jh., das
erst im 20. Jh. aus dem Kressenstein hierher übertragen worden war; in
der Sakristei zwei Wappen (u.a. Muffel), 16. Jh.
2 Vier Rundscheibenpaare mit Kressischen Wappenallianzen (um 1622
von dem Nürnberger Glasmaler Lorenz Langer für die Kressische
Kapelle im Augustinerkloster gefertigt) sowie zwei butzengroße Rund-
wappen: Fenster 1: oben: Kress-Fürer 1621 und Wilhelm Kress 1625.
Fenster 2: von unten nach oben: 1. Wilhelm Kress und Ursula Tetzlin,
Maria Pfödin; 2. Hieronymus Kress und Rosina Freidlin; 3. Christoph
Kress und Behaim von Schwarzbach; 4. kleine Rundwappen Haller und
Imhoff.
3 In einem handschriftlichen Verzeichnis vom 18. August 1937, das die
Glasgemälde in Kraftshof als Bestandteil der in Familienbesitz befind-
lichen Kunstschätze und Archivalien behandelt, sind die betreffenden
zehn Wappen wie folgt aufgelistet: 1. Wappen Kress-Haller-Waldstro-
mer (Konrad II. Kress von Kressenstein), 1. Viertel 15. Jh., südl. Lhs.; 2.
Wappen Kress-Schütz (Konrad IIL), 15. Jh., südl. Lhs.; 3. Wappen
Kress-Stromer (Friedrich IIL), 15. Jh., nördl. Lhs.; 4. Wappen Kress-
Löffelholz (Anton L), Chorfenster, 1514; 5. Wappen Kress-Freidel
(Hieronymus), nördl. Lhs., 1584; 6. Wappen Kress-Rieter (Jobst Chri-
stoph L), nördl. Lhs., 1668; 7. Wappen Kress-Viatis (Wilhelm), südl.
Lhs., 1664; 8. Wappen Kress-Fürer (Jobst Christoph L), nördl. Lhs.,
1668; 9. Wappen Kress-Marstaller (Georg Adolf), nördl. Lhs., 1668; 10.
Wappen Kress-Dilherr (Johann-Wilhem II.), südl. Lhs., 1. Viertel 18. Jh.
(Archiv der Frhrl. von Kressischen Verschiebung Kraftshof, GNM, Rep.
II / 7Öd, Nr. 4; ebenda S. 19L auch die Nachkriegs-Bestandaufnahme
vom 24. Febr. 1950).
4 Kurzinventar Nürnberg 21977/82, S. 370.
5 Marx Christoph Kress, Beschreibung der Kressischen Kirchen zue
Crafftshoff, 1665 (GNM, Bibliothek, Hs. 16 634, fol. 70f.) bzw. 1676
(GNM, FA Kress, Abt. II, Nr. 122, S. 245-248, bzw. Nr. 123, S. 119E)
sowie die »Beschreibung aller und jeder uralt-adeliger Kressischer Monu-
menta in der Kirche zu Kraftshof« von 1711 (GNM, FA Kress, Abt. II,
Nr. 124) bieten nur eine Auflistung dessen, was die Herren Kressen als
Oberpfleger für Kirchenfenster zu Crafftshof mit ihren Wappen haben
machen lassen, wobei neben Wappen keine Bildinhalte Erwähnung finden.
6 Rosenthal-Metzger, 1931,$. 29-34. Auch in den diversen Beschrei-
bungen der im Augustinerkloster überlieferten Glasgemälde bei Murr,
1778, S. 135 bzw. 21801, S. 85, ist lediglich allgemein von »den gemalten
Fenstern, welche verschiedene Heilige vorstellen«, die Rede. Eine Zeich-
nung der Kapelle von 1618 verweist dagegen in einer Randnotiz auf die
in den leer belassenen Mittelscheiben der Augustinkapelle befindlichen
»mit Farben eingeschmelzten fenster mit wappen und historien« (ehern.
GNM, Graph. Sammlung, Kapsel 1066, heute Stadtmuseum Fembo-
haus). Zur Kressischen Doppelkapelle, die nach dem Abbruch des
Augustinerklosters 1872 im Germanischen Nationalmuseum wieder
aufgebaut worden war und dort im Krieg zugrunde ging, vgl. Frank zu
Döfering, 1936, Sp. 103-118 (mit mehreren Abbildungen); ebenso:
GNM 1852-1977, 1978, S. 38off., Abb. 219L, 273.
7 Frank zu Döfering, 1936, Sp. 1427-1461 (nach Marx Christoph
Kress, 1665, wie Anm. 5, fol. af.); danach mit Vorbehalten gegenüber
den überlieferten frühen Daten der Kirchengeschichte Hirschmann,
1970, S. 1 ff., der andererseits das wohl ursprüngliche kleine Steinrelief
mit dem Drachenkampf des Hl. Georg über dem Hauptportal der Kir-
che, wie gewöhnlich, um 1305/15 datiert; zuletzt Rusam, 1995, S. 3 ff.
8 Frank zu Döfering, 1936, Sp. 123, 1434; eine weitere Fensterstiftung
in die Kirche gen Kraftshof wird auch für Konrad IIL Kress mitgeteilt
(ebenda Sp. 147; vgl. Geschlechtsbuch III, S. 70). Beide Wappenscheiben
sind zuletzt 1937 an Ort und Stelle in Kraftshof überliefert; seit der
Kriegsbergung der Fenster verschollen (vgl. Anm. 3).
KRAFTSHOF • WEHRKIRCHE / GRUFTKAPELLE
Zur Frage des ursprünglichen Standorts: Von den heute in Kraftshof erhaltenen Glasmalereien dürften allenfalls
die Scheiben des späten 15. Jahrhunderts im Südfenster des Chors der Wehrkirche auch tatsächlich für diesen Standort
bestimmt gewesen sein. Zwar sollen diese und die nachmittelalterlichen Rundwappen in der Gruftkapelle laut Über-
lieferung aus der Kressischen Kapelle des 1872 abgebrochenen Nürnberger Augustinerklosters stammen1 2 3 4. Zweifel
daran scheinen allerdings gerade im Hinblick auf die beiden späteren Rechteckscheiben angebracht, zumal die Hl.
Helena sich bestens zum Ko-Patrozinium des Hl. Kreuzes versteht5. Vielmehr paßt allein die älteste Scheibe mit dem
Fragment einer Himmelfahrt Christi vom Beginn des 15. Jahrhunderts weder zu den Fenstermaßen noch zu den bau-
geschichtlichen Eckdaten der Georgskirche, womit eine Herkunft aus der 1412/13 am Kreuzgang des Augustinerklo-
sters errichteten Kressischen Doppelkapelle an Wahrscheinlichkeit gewinnt6. Die erlesenen Kabinettscheiben mit den
beiden Porträts und den vier Turnierszenen von 1530 könnten einst im profanen Wohnbereich eines der Kressischen
Herrensitze, mutmaßlich in dem 1634 zerstörten Kraftshofer Stammsitz, dem ehemaligen Kressenstein, ihren
ursprünglichen Platz besessen haben.
Geschichte des Baues und seiner Verglasung: Einer nicht gesicherten Überlieferung zufolge war der erste
bescheidene Kraftshofer Kirchenbau 1305 von Friedrich I. Kress und seiner Gemahlin Margarete, geb. Strobl von
Atzelsberg, gestiftet und laut nachgetragener Weihenotiz 1315 als Filiale der Peterskirche in Poppenreuth zu Ehren
des Hl. Georg, der Jungfrau Maria und des Hl. Kreuzes geweiht worden7. Mit der Oberpflegschaft durch das
Geschlecht der Kressen ab 1431 wuchs auch der Stiftungseifer für den Kirchenbau, der bis dahin offenbar in großer
elender armut und nicht getziert gewesen sein soll. Gänzlich ungeschmückt scheint der erste Bau - eine einfache
Chorturmkirche mit Saalraum und quadratischem Chor - aber nicht gewesen zu sein, denn bereits vor 1429 ist die
Stiftung eines Wappenfensters für Konrad IE Kress überliefert, der zugleich auch sein Wappen in die Fenster der
Nürnberger Kirchen und Klöster St. Egidien, St. Sebald, St. Katharina, St. Martha, bei den Augustinern und den
Kartäusern fertigen ließ8. Die im Jahr 1438 anschließende Erweiterung des Kirchenschiffs nach Westen unter Fried-
1 1. Im Ostfenster des Chores ein Rundwappen Löffelholz des 16. Jh. -
2. Im zweiten Nordfenster des Langhauses ein reiches Rechteckfeld mit
der Wappenallianz Kress-Freidlin aus der zweiten Hälfte des 16. Jh., das
erst im 20. Jh. aus dem Kressenstein hierher übertragen worden war; in
der Sakristei zwei Wappen (u.a. Muffel), 16. Jh.
2 Vier Rundscheibenpaare mit Kressischen Wappenallianzen (um 1622
von dem Nürnberger Glasmaler Lorenz Langer für die Kressische
Kapelle im Augustinerkloster gefertigt) sowie zwei butzengroße Rund-
wappen: Fenster 1: oben: Kress-Fürer 1621 und Wilhelm Kress 1625.
Fenster 2: von unten nach oben: 1. Wilhelm Kress und Ursula Tetzlin,
Maria Pfödin; 2. Hieronymus Kress und Rosina Freidlin; 3. Christoph
Kress und Behaim von Schwarzbach; 4. kleine Rundwappen Haller und
Imhoff.
3 In einem handschriftlichen Verzeichnis vom 18. August 1937, das die
Glasgemälde in Kraftshof als Bestandteil der in Familienbesitz befind-
lichen Kunstschätze und Archivalien behandelt, sind die betreffenden
zehn Wappen wie folgt aufgelistet: 1. Wappen Kress-Haller-Waldstro-
mer (Konrad II. Kress von Kressenstein), 1. Viertel 15. Jh., südl. Lhs.; 2.
Wappen Kress-Schütz (Konrad IIL), 15. Jh., südl. Lhs.; 3. Wappen
Kress-Stromer (Friedrich IIL), 15. Jh., nördl. Lhs.; 4. Wappen Kress-
Löffelholz (Anton L), Chorfenster, 1514; 5. Wappen Kress-Freidel
(Hieronymus), nördl. Lhs., 1584; 6. Wappen Kress-Rieter (Jobst Chri-
stoph L), nördl. Lhs., 1668; 7. Wappen Kress-Viatis (Wilhelm), südl.
Lhs., 1664; 8. Wappen Kress-Fürer (Jobst Christoph L), nördl. Lhs.,
1668; 9. Wappen Kress-Marstaller (Georg Adolf), nördl. Lhs., 1668; 10.
Wappen Kress-Dilherr (Johann-Wilhem II.), südl. Lhs., 1. Viertel 18. Jh.
(Archiv der Frhrl. von Kressischen Verschiebung Kraftshof, GNM, Rep.
II / 7Öd, Nr. 4; ebenda S. 19L auch die Nachkriegs-Bestandaufnahme
vom 24. Febr. 1950).
4 Kurzinventar Nürnberg 21977/82, S. 370.
5 Marx Christoph Kress, Beschreibung der Kressischen Kirchen zue
Crafftshoff, 1665 (GNM, Bibliothek, Hs. 16 634, fol. 70f.) bzw. 1676
(GNM, FA Kress, Abt. II, Nr. 122, S. 245-248, bzw. Nr. 123, S. 119E)
sowie die »Beschreibung aller und jeder uralt-adeliger Kressischer Monu-
menta in der Kirche zu Kraftshof« von 1711 (GNM, FA Kress, Abt. II,
Nr. 124) bieten nur eine Auflistung dessen, was die Herren Kressen als
Oberpfleger für Kirchenfenster zu Crafftshof mit ihren Wappen haben
machen lassen, wobei neben Wappen keine Bildinhalte Erwähnung finden.
6 Rosenthal-Metzger, 1931,$. 29-34. Auch in den diversen Beschrei-
bungen der im Augustinerkloster überlieferten Glasgemälde bei Murr,
1778, S. 135 bzw. 21801, S. 85, ist lediglich allgemein von »den gemalten
Fenstern, welche verschiedene Heilige vorstellen«, die Rede. Eine Zeich-
nung der Kapelle von 1618 verweist dagegen in einer Randnotiz auf die
in den leer belassenen Mittelscheiben der Augustinkapelle befindlichen
»mit Farben eingeschmelzten fenster mit wappen und historien« (ehern.
GNM, Graph. Sammlung, Kapsel 1066, heute Stadtmuseum Fembo-
haus). Zur Kressischen Doppelkapelle, die nach dem Abbruch des
Augustinerklosters 1872 im Germanischen Nationalmuseum wieder
aufgebaut worden war und dort im Krieg zugrunde ging, vgl. Frank zu
Döfering, 1936, Sp. 103-118 (mit mehreren Abbildungen); ebenso:
GNM 1852-1977, 1978, S. 38off., Abb. 219L, 273.
7 Frank zu Döfering, 1936, Sp. 1427-1461 (nach Marx Christoph
Kress, 1665, wie Anm. 5, fol. af.); danach mit Vorbehalten gegenüber
den überlieferten frühen Daten der Kirchengeschichte Hirschmann,
1970, S. 1 ff., der andererseits das wohl ursprüngliche kleine Steinrelief
mit dem Drachenkampf des Hl. Georg über dem Hauptportal der Kir-
che, wie gewöhnlich, um 1305/15 datiert; zuletzt Rusam, 1995, S. 3 ff.
8 Frank zu Döfering, 1936, Sp. 123, 1434; eine weitere Fensterstiftung
in die Kirche gen Kraftshof wird auch für Konrad IIL Kress mitgeteilt
(ebenda Sp. 147; vgl. Geschlechtsbuch III, S. 70). Beide Wappenscheiben
sind zuletzt 1937 an Ort und Stelle in Kraftshof überliefert; seit der
Kriegsbergung der Fenster verschollen (vgl. Anm. 3).