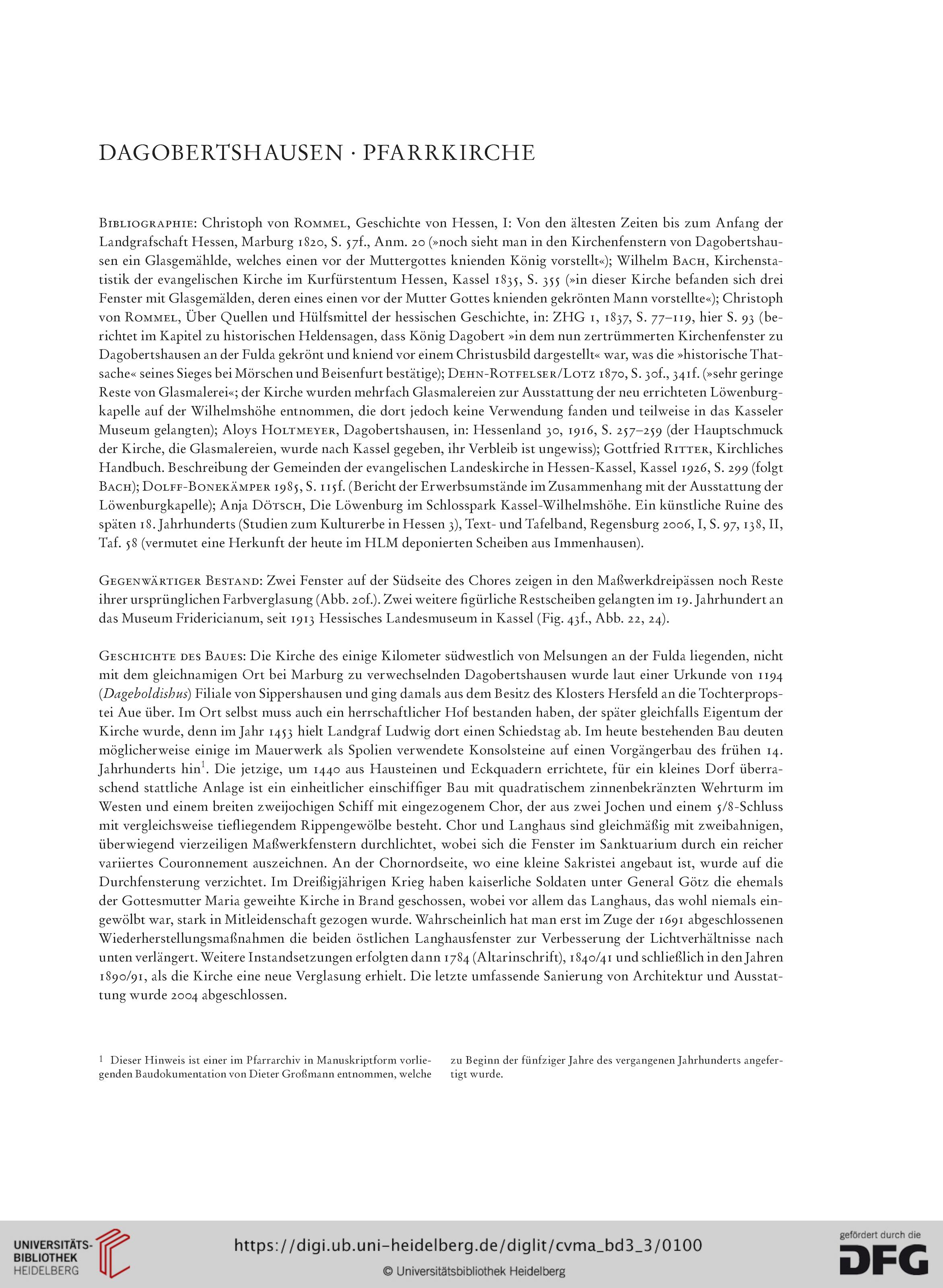DAGOBERTSHAUSEN • PFARRKIRCHE
Bibliographie: Christoph von Rommel, Geschichte von Hessen, I: Von den ältesten Zeiten bis zum Anfang der
Landgrafschaft Hessen, Marburg 1820, S. 57E, Anm. 20 (»noch sieht man in den Kirchenfenstern von Dagobertshau-
sen ein Glasgemählde, welches einen vor der Muttergottes knienden König vorstellt«); Wilhelm Bach, Kirchensta-
tistik der evangelischen Kirche im Kurfürstentum Hessen, Kassel 1835, S. 355 (»in dieser Kirche befanden sich drei
Fenster mit Glasgemälden, deren eines einen vor der Mutter Gottes knienden gekrönten Mann vorstellte«); Christoph
von Rommel, Über Quellen und Hülfsmittel der hessischen Geschichte, in: ZHG 1, 1837, S. 77-119, hier S. 93 (be-
richtet im Kapitel zu historischen Heldensagen, dass König Dagobert »in dem nun zertrümmerten Kirchenfenster zu
Dagobertshausen an der Fulda gekrönt und kniend vor einem Christusbild dargestellt« war, was die »historische That-
sache« seines Sieges bei Morschen und Beisenfurt bestätige); Dehn-Rotfelser/Lotz 1870, S. 30L, 341E (»sehr geringe
Reste von Glasmalerei«; der Kirche wurden mehrfach Glasmalereien zur Ausstattung der neu errichteten Löwenburg-
kapelle auf der Wilhelmshöhe entnommen, die dort jedoch keine Verwendung fanden und teilweise in das Kasseler
Museum gelangten); Aloys Holtmeyer, Dagobertshausen, in: Hessenland 30, 1916, S. 257-259 (der Hauptschmuck
der Kirche, die Glasmalereien, wurde nach Kassel gegeben, ihr Verbleib ist ungewiss); Gottfried Ritter, Kirchliches
Handbuch. Beschreibung der Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Hessen-Kassel, Kassel 1926, S. 299 (folgt
Bach); Dolff-Bonekämper 1985, S. 115L (Bericht der Erwerbsumstände im Zusammenhang mit der Ausstattung der
Löwenburgkapelle); Anja Dötsch, Die Löwenburg im Schlosspark Kassel-Wilhelmshöhe. Ein künstliche Ruine des
späten 18. Jahrhunderts (Studien zum Kulturerbe in Hessen 3), Text- und Tafelband, Regensburg 2006,1, S. 97, 138, II,
Taf. 58 (vermutet eine Herkunft der heute im HLM deponierten Scheiben aus Immenhausen).
Gegenwärtiger Bestand: Zwei Fenster auf der Südseite des Chores zeigen in den Maßwerkdreipässen noch Reste
ihrer ursprünglichen Farbverglasung (Abb. 20L). Zwei weitere figürliche Restscheiben gelangten im 19. Jahrhundert an
das Museum Fridericianum, seit 1913 Hessisches Landesmuseum in Kassel (Fig. 43L, Abb. 22, 24).
Geschichte des Baues: Die Kirche des einige Kilometer südwestlich von Melsungen an der Fulda liegenden, nicht
mit dem gleichnamigen Ort bei Marburg zu verwechselnden Dagobertshausen wurde laut einer Urkunde von 1194
{Dageboldishus) Filiale von Sippershausen und ging damals aus dem Besitz des Klosters Hersfeld an die Tochterprops-
tei Aue über. Im Ort selbst muss auch ein herrschaftlicher Hof bestanden haben, der später gleichfalls Eigentum der
Kirche wurde, denn im Jahr 1453 hielt Landgraf Ludwig dort einen Schiedstag ab. Im heute bestehenden Bau deuten
möglicherweise einige im Mauerwerk als Spolien verwendete Konsolsteine auf einen Vorgängerbau des frühen 14.
Jahrhunderts hin1. Die jetzige, um 1440 aus Hausteinen und Eckquadern errichtete, für ein kleines Dorf überra-
schend stattliche Anlage ist ein einheitlicher einschiffiger Bau mit quadratischem zinnenbekränzten Wehrturm im
Westen und einem breiten zweijochigen Schiff mit eingezogenem Chor, der aus zwei Jochen und einem 5/8-Schluss
mit vergleichsweise tiefliegendem Rippengewölbe besteht. Chor und Langhaus sind gleichmäßig mit zweibahnigen,
überwiegend vierzeiligen Maßwerkfenstern durchlichtet, wobei sich die Fenster im Sanktuarium durch ein reicher
variiertes Couronnement auszeichnen. An der Chornordseite, wo eine kleine Sakristei angebaut ist, wurde auf die
Durchfensterung verzichtet. Im Dreißigjährigen Krieg haben kaiserliche Soldaten unter General Götz die ehemals
der Gottesmutter Maria geweihte Kirche in Brand geschossen, wobei vor allem das Langhaus, das wohl niemals ein-
gewölbt war, stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wahrscheinlich hat man erst im Zuge der 1691 abgeschlossenen
Wiederherstellungsmaßnahmen die beiden östlichen Langhausfenster zur Verbesserung der Lichtverhältnisse nach
unten verlängert. Weitere Instandsetzungen erfolgten dann 1784 (Altarinschrift), 1840/41 und schließlich in den Jahren
1890/91, als die Kirche eine neue Verglasung erhielt. Die letzte umfassende Sanierung von Architektur und Ausstat-
tung wurde 2004 abgeschlossen.
1 Dieser Hinweis ist einer im Pfarrarchiv in Manuskriptform vorlie- zu Beginn der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts angefer-
genden Baudokumentation von Dieter Großmann entnommen, welche tigt wurde.
Bibliographie: Christoph von Rommel, Geschichte von Hessen, I: Von den ältesten Zeiten bis zum Anfang der
Landgrafschaft Hessen, Marburg 1820, S. 57E, Anm. 20 (»noch sieht man in den Kirchenfenstern von Dagobertshau-
sen ein Glasgemählde, welches einen vor der Muttergottes knienden König vorstellt«); Wilhelm Bach, Kirchensta-
tistik der evangelischen Kirche im Kurfürstentum Hessen, Kassel 1835, S. 355 (»in dieser Kirche befanden sich drei
Fenster mit Glasgemälden, deren eines einen vor der Mutter Gottes knienden gekrönten Mann vorstellte«); Christoph
von Rommel, Über Quellen und Hülfsmittel der hessischen Geschichte, in: ZHG 1, 1837, S. 77-119, hier S. 93 (be-
richtet im Kapitel zu historischen Heldensagen, dass König Dagobert »in dem nun zertrümmerten Kirchenfenster zu
Dagobertshausen an der Fulda gekrönt und kniend vor einem Christusbild dargestellt« war, was die »historische That-
sache« seines Sieges bei Morschen und Beisenfurt bestätige); Dehn-Rotfelser/Lotz 1870, S. 30L, 341E (»sehr geringe
Reste von Glasmalerei«; der Kirche wurden mehrfach Glasmalereien zur Ausstattung der neu errichteten Löwenburg-
kapelle auf der Wilhelmshöhe entnommen, die dort jedoch keine Verwendung fanden und teilweise in das Kasseler
Museum gelangten); Aloys Holtmeyer, Dagobertshausen, in: Hessenland 30, 1916, S. 257-259 (der Hauptschmuck
der Kirche, die Glasmalereien, wurde nach Kassel gegeben, ihr Verbleib ist ungewiss); Gottfried Ritter, Kirchliches
Handbuch. Beschreibung der Gemeinden der evangelischen Landeskirche in Hessen-Kassel, Kassel 1926, S. 299 (folgt
Bach); Dolff-Bonekämper 1985, S. 115L (Bericht der Erwerbsumstände im Zusammenhang mit der Ausstattung der
Löwenburgkapelle); Anja Dötsch, Die Löwenburg im Schlosspark Kassel-Wilhelmshöhe. Ein künstliche Ruine des
späten 18. Jahrhunderts (Studien zum Kulturerbe in Hessen 3), Text- und Tafelband, Regensburg 2006,1, S. 97, 138, II,
Taf. 58 (vermutet eine Herkunft der heute im HLM deponierten Scheiben aus Immenhausen).
Gegenwärtiger Bestand: Zwei Fenster auf der Südseite des Chores zeigen in den Maßwerkdreipässen noch Reste
ihrer ursprünglichen Farbverglasung (Abb. 20L). Zwei weitere figürliche Restscheiben gelangten im 19. Jahrhundert an
das Museum Fridericianum, seit 1913 Hessisches Landesmuseum in Kassel (Fig. 43L, Abb. 22, 24).
Geschichte des Baues: Die Kirche des einige Kilometer südwestlich von Melsungen an der Fulda liegenden, nicht
mit dem gleichnamigen Ort bei Marburg zu verwechselnden Dagobertshausen wurde laut einer Urkunde von 1194
{Dageboldishus) Filiale von Sippershausen und ging damals aus dem Besitz des Klosters Hersfeld an die Tochterprops-
tei Aue über. Im Ort selbst muss auch ein herrschaftlicher Hof bestanden haben, der später gleichfalls Eigentum der
Kirche wurde, denn im Jahr 1453 hielt Landgraf Ludwig dort einen Schiedstag ab. Im heute bestehenden Bau deuten
möglicherweise einige im Mauerwerk als Spolien verwendete Konsolsteine auf einen Vorgängerbau des frühen 14.
Jahrhunderts hin1. Die jetzige, um 1440 aus Hausteinen und Eckquadern errichtete, für ein kleines Dorf überra-
schend stattliche Anlage ist ein einheitlicher einschiffiger Bau mit quadratischem zinnenbekränzten Wehrturm im
Westen und einem breiten zweijochigen Schiff mit eingezogenem Chor, der aus zwei Jochen und einem 5/8-Schluss
mit vergleichsweise tiefliegendem Rippengewölbe besteht. Chor und Langhaus sind gleichmäßig mit zweibahnigen,
überwiegend vierzeiligen Maßwerkfenstern durchlichtet, wobei sich die Fenster im Sanktuarium durch ein reicher
variiertes Couronnement auszeichnen. An der Chornordseite, wo eine kleine Sakristei angebaut ist, wurde auf die
Durchfensterung verzichtet. Im Dreißigjährigen Krieg haben kaiserliche Soldaten unter General Götz die ehemals
der Gottesmutter Maria geweihte Kirche in Brand geschossen, wobei vor allem das Langhaus, das wohl niemals ein-
gewölbt war, stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wahrscheinlich hat man erst im Zuge der 1691 abgeschlossenen
Wiederherstellungsmaßnahmen die beiden östlichen Langhausfenster zur Verbesserung der Lichtverhältnisse nach
unten verlängert. Weitere Instandsetzungen erfolgten dann 1784 (Altarinschrift), 1840/41 und schließlich in den Jahren
1890/91, als die Kirche eine neue Verglasung erhielt. Die letzte umfassende Sanierung von Architektur und Ausstat-
tung wurde 2004 abgeschlossen.
1 Dieser Hinweis ist einer im Pfarrarchiv in Manuskriptform vorlie- zu Beginn der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts angefer-
genden Baudokumentation von Dieter Großmann entnommen, welche tigt wurde.