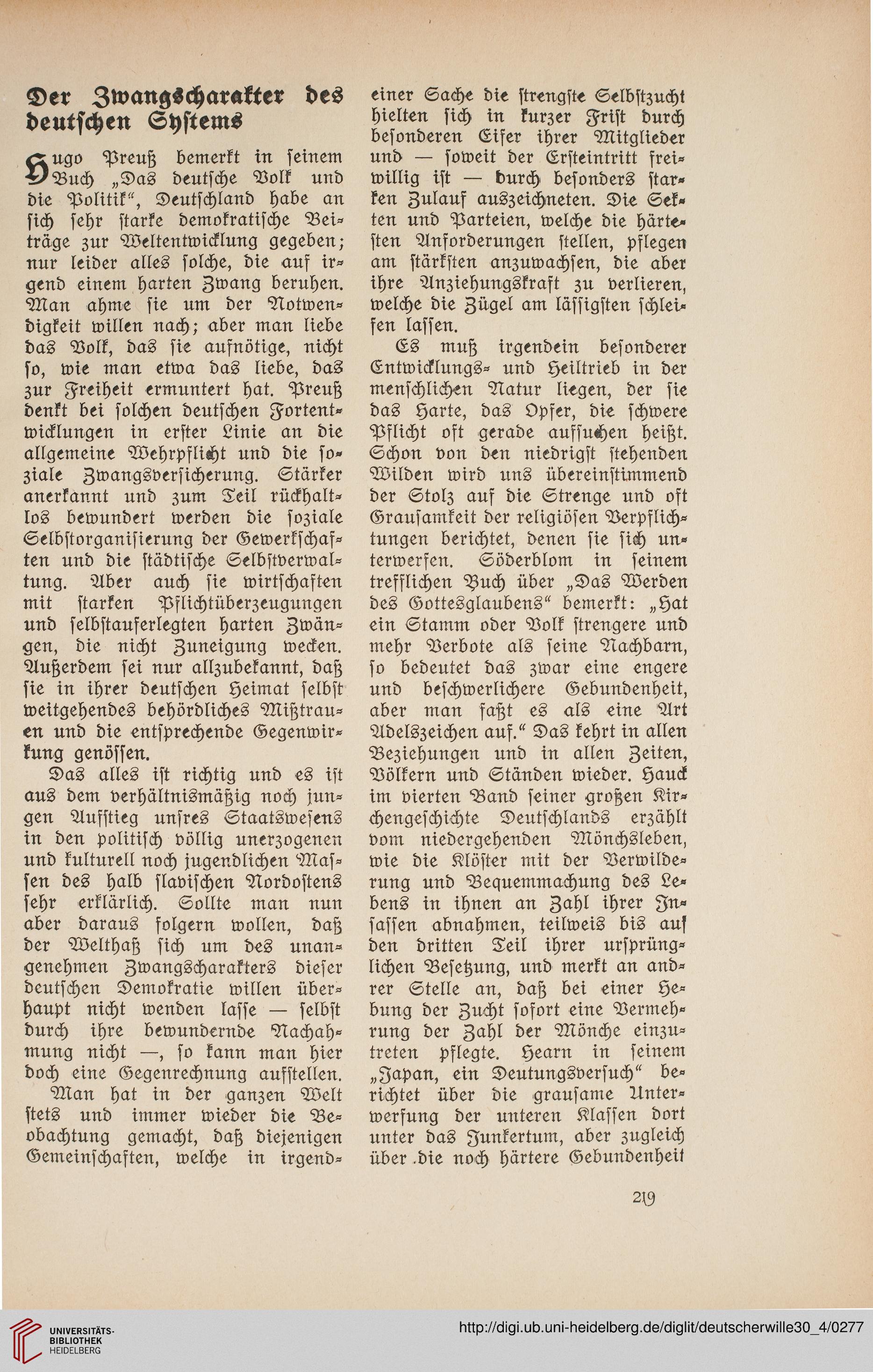>
Der ZwangScharakter des
deutschen Syftems
^Lugo Preuß bemerkt in seinem
VBuch „Das deutsche Volk und
die Politik", Deutschland habe an
sich sehr starke demokratische Bei«
träge zur Weltentwicklung gegeben;
nur leider alles solche, die <ruf ir-
gend einem harten Zwang beruhen.
Man ahme sie um der Botwen»
digkeit willen nach; aber man liebe
das Volk, das sie aufnötige, nicht
so, wie man etwa das liebe, das
zur Freiheit ermuntert hat. Preuß
denkt bei solchen deutschen Fortent-
wicklungen in erster Linie an die
allgemeine Wehrpflicht und die so»
ziale Zwangsversicherung. Stärker
anerkannt und zum Teil rückhalt-
los bewundert werden die soziale
Selbstorganisierung der Gewerkschaf«
ten und die städtische Selbstverwal-
tung. Aber auch sie wirtschaften
mit starken Pflichtüberzeugungen
und selbstauferlegten harten Zwän--
gen, die nicht Zuneigung wecken.
Außerdem sei nur allzubekannt, daß
sie in ihrer deutschen tzeimat selbst
weitgehendes behördliches Mißtrau-
en und die entsprechende Gegenwir-
kung genössen.
Das alles ist richtig und es ist
aus dem verhältnismäßig noch jun»
gen Aufstieg unsres Staatswesens
in den politisch völlig unerzogenen
und kulturell noch jugendlichen Mas«
sen des halb slavischen Nordostens
sehr erklärlich. Sollte man nun
aber daraus folgern wollen, daß
der Welthaß sich um des unan«
genehmen Zwangscharakters dieser
deutschen Demokratie willen über«
haupt nicht wenden lasse — selbst
durch ihre bewundernde Nachah-
mung nicht —, so kann man hier
doch eine Gegenrechnung aufstellen.
Man hat in der ganzen Welt
stets und immer wieder die Be«
obachtung gemacht, daß diejenigen
Gemeinschaften, welche in irgend-
einer Sache die strengste Selbstzuchl
hielten sich in kurzer Frist durch
besonderen Eifer ihrer Mitglieder
und — soweit der Lrsteintritt frei-
willig ist — durch besonders star»
ken Zulauf auszeichneten. Die Sek«
ten und Parteien, welche die HLrte-
sten Anforderungen stellen, pflegen
am stärksten anzuwachsen, die aber
ihre Anziehungskraft zu verlieren,
welche die Zügel am lässigsten schlei-
fen lassen.
Es muß irgendein besonderer
Entwicklungs- und Heiltrieb in der
menschlichen Natur liegen, der sie
das tzarte, das Opfer, die schwere
Pflicht oft gerade aufsuchen heißt.
Schon von den niedrigst stehenden
Wilden wird uns übereinstimmend
der Stolz auf die Strenge und oft
Grausamkeit der religiösen Verpflich-
Lungen berichtet, denen sie sich un>
terwerfen. Söderblom in seinem
trefflichen Puch über „Das Werden
des Gottesglaubens^ bemerkt: „tzat
ein Stamm oder Volk strengere und
mehr Verbote als seine Nachbarn,
so bedeutet das zwar eine engere
und beschwerlichere Gebundenheit,
aber man faßt es uls eine Art
Adelszeichen auf." Das kehrt in allen
Beziehungen und in allen Zeiten,
Völkern und Ständen wieder. tzauck
im vierten Band seiner großen Kir-
chengeschichte Deutschlands erzählt
vom niedergehenden Mönchsleben,
wie die Klöster mit der Verwilde«
rung und Bequemmachung des Le-
bens in ihnen an Zahl ihrer In«
sassen abnahmen, teilweis bis aus
den dritten Teil ihrer ursprüng-
lichen Besetzung, und merkt an and-
rer Stelle an, daß bei einer tze-
bung der Zucht sofort eine Vermeh«
rung der Zahl der Mönche einzu-
treten pflegte. Hearn in seinem
„Iapan, ein Deutungsversuch" be-
richtet über die grausame Unter-
werfung der unteren Klassen dort
unter das Iunkertum, aber zugleich
über.die noch härtere Gebundenheit
2V
Der ZwangScharakter des
deutschen Syftems
^Lugo Preuß bemerkt in seinem
VBuch „Das deutsche Volk und
die Politik", Deutschland habe an
sich sehr starke demokratische Bei«
träge zur Weltentwicklung gegeben;
nur leider alles solche, die <ruf ir-
gend einem harten Zwang beruhen.
Man ahme sie um der Botwen»
digkeit willen nach; aber man liebe
das Volk, das sie aufnötige, nicht
so, wie man etwa das liebe, das
zur Freiheit ermuntert hat. Preuß
denkt bei solchen deutschen Fortent-
wicklungen in erster Linie an die
allgemeine Wehrpflicht und die so»
ziale Zwangsversicherung. Stärker
anerkannt und zum Teil rückhalt-
los bewundert werden die soziale
Selbstorganisierung der Gewerkschaf«
ten und die städtische Selbstverwal-
tung. Aber auch sie wirtschaften
mit starken Pflichtüberzeugungen
und selbstauferlegten harten Zwän--
gen, die nicht Zuneigung wecken.
Außerdem sei nur allzubekannt, daß
sie in ihrer deutschen tzeimat selbst
weitgehendes behördliches Mißtrau-
en und die entsprechende Gegenwir-
kung genössen.
Das alles ist richtig und es ist
aus dem verhältnismäßig noch jun»
gen Aufstieg unsres Staatswesens
in den politisch völlig unerzogenen
und kulturell noch jugendlichen Mas«
sen des halb slavischen Nordostens
sehr erklärlich. Sollte man nun
aber daraus folgern wollen, daß
der Welthaß sich um des unan«
genehmen Zwangscharakters dieser
deutschen Demokratie willen über«
haupt nicht wenden lasse — selbst
durch ihre bewundernde Nachah-
mung nicht —, so kann man hier
doch eine Gegenrechnung aufstellen.
Man hat in der ganzen Welt
stets und immer wieder die Be«
obachtung gemacht, daß diejenigen
Gemeinschaften, welche in irgend-
einer Sache die strengste Selbstzuchl
hielten sich in kurzer Frist durch
besonderen Eifer ihrer Mitglieder
und — soweit der Lrsteintritt frei-
willig ist — durch besonders star»
ken Zulauf auszeichneten. Die Sek«
ten und Parteien, welche die HLrte-
sten Anforderungen stellen, pflegen
am stärksten anzuwachsen, die aber
ihre Anziehungskraft zu verlieren,
welche die Zügel am lässigsten schlei-
fen lassen.
Es muß irgendein besonderer
Entwicklungs- und Heiltrieb in der
menschlichen Natur liegen, der sie
das tzarte, das Opfer, die schwere
Pflicht oft gerade aufsuchen heißt.
Schon von den niedrigst stehenden
Wilden wird uns übereinstimmend
der Stolz auf die Strenge und oft
Grausamkeit der religiösen Verpflich-
Lungen berichtet, denen sie sich un>
terwerfen. Söderblom in seinem
trefflichen Puch über „Das Werden
des Gottesglaubens^ bemerkt: „tzat
ein Stamm oder Volk strengere und
mehr Verbote als seine Nachbarn,
so bedeutet das zwar eine engere
und beschwerlichere Gebundenheit,
aber man faßt es uls eine Art
Adelszeichen auf." Das kehrt in allen
Beziehungen und in allen Zeiten,
Völkern und Ständen wieder. tzauck
im vierten Band seiner großen Kir-
chengeschichte Deutschlands erzählt
vom niedergehenden Mönchsleben,
wie die Klöster mit der Verwilde«
rung und Bequemmachung des Le-
bens in ihnen an Zahl ihrer In«
sassen abnahmen, teilweis bis aus
den dritten Teil ihrer ursprüng-
lichen Besetzung, und merkt an and-
rer Stelle an, daß bei einer tze-
bung der Zucht sofort eine Vermeh«
rung der Zahl der Mönche einzu-
treten pflegte. Hearn in seinem
„Iapan, ein Deutungsversuch" be-
richtet über die grausame Unter-
werfung der unteren Klassen dort
unter das Iunkertum, aber zugleich
über.die noch härtere Gebundenheit
2V