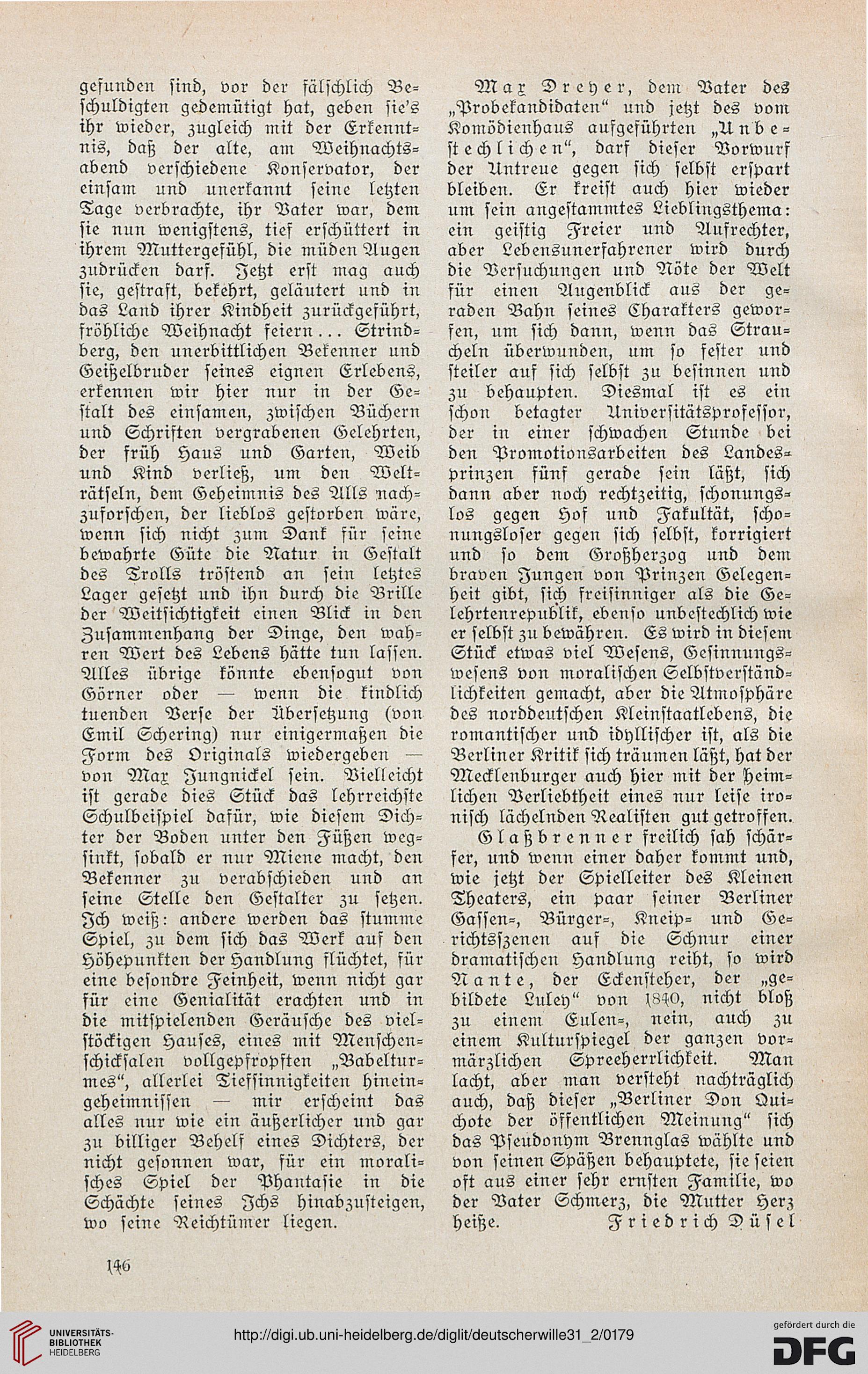gefunden sind, vor der fälschlich Be-
schuldigten gedemütigt hat, geben sie's
ihr wieder, zugleich mit der Erkennt-
nis, daß der alte, am Weihnachts-
abend verschiedene Konservator, der
einsam und unerkannt seine letzten
Tage verbrachte, ihr Vater war, dem
sie nun wenigstens, ties erschüttert in
ihrem Muttergefühl, die müden Augen
zudrücken darf. Ietzt erst mag auch
sie, gestraft, bekehrt, geläutert und in
das Land ihrer Kindheit zurückgeführt,
fröhliche Weihnacht feiern ... Strind-
berg, den unerbittlichen Bekenner und
Geißelbruder seines eignen Erlebens,
erkennen wir hier nur in der Ge-
stalt des einsamen, zwischen Büchern
und Schriften vergrabenen Gelehrten,
der früh Haus und Garten, Weib
und Kind verließ, um den Welt-
rätseln, dem Geheimnis des Alls uach-
zuforschen, der lieblos gestorben wäre,
wenn sich nicht zum Dank für scine
bewahrte Güte die Natur in Gestalt
des Trolls tröstend an sein letztes
Lager gesetzt und ihn durch die Brille
der Weitsichtigkeit einen Blick in den
Zusammenhang der Dinge, den wah-
ren Wert des Lebens hätte tun lassen.
Alles übrige könnte ebensogut von
Görner oder — wenn die kindlich
tuenden Verse der Äbersetzung (von
Emil Schering) nur einigermaßen die
Form des Originals wiedergeben —
von Max Iungnickel sein. Vielleicht
ist gerade dies Stück das lehrreichste
Schulbeispiel dafür, wie diesem Dich-
ter der Boden unter den Füßeu weg-
sinkt, sobald er nur Miene macht, den
Bekenner zu verabschieden und an
seine Stelle den Gestalter zu setzen.
Ich weiß: andere werden das stumme
Spiel, zu dem sich das Werk auf den
Höhepunkten der Handlung flüchtet, für
eine besondre Feinheit, wenn nicht gar
für eine Genialität erachten und in
die mitspielenden Geräusche des viel-
stöckigen Hauses, eines mit Menschen-
schicksalen vollgepfropften „Babeltur-
mes", allerlei Tiefsinnigkeiten hinein-
geheimnissen — mir erscheint das
alles nur wie ein äußerlicher und gar
zu billiger Behelf eines Dichters, der
nicht gesonnen war, für ein morali-
sches Spiel der Phantasie in die
Schächte seines Ichs hinabzusteigen,
wo seine Reichtümer liegen.
Max Dreyer, dem Vater des
„Probekandidaten" und jetzt des vom
Komödienhaus aufgeführteu „Uub e-
stechlichen", darf diescr Vorwurf
der Antreue gegen sich selbst erspart
bleiben. Er kreist auch hier wieder
um sein angestammtes Lieblingsthema:
ein geistig Freier und Aufrechter,
aber Lebensunerfahrener wird durch
die Versuchungen und Nöte der Welt
für einen Augenblick aus der ge-
raden Bahn seines Charakters gewor-
fen, um sich dann, wenn das Strau-
cheln überwunden, um so fester und
steiler auf sich selbst zu besinnen und
zu behaupten. Diesmal ist es ein
schon betagter Aniversitätsprofessor,
der in einer schwachen Stuude bei
den Promotionsarbeiten des Landes-
prinzen fünf gerade sein läßt, sich
dann aber uoch rechtzeitig, schonungs-
los gegen Hof und Fakultät, scho-
nungsloser gegen sich selbst, korrigiert
und so dem Großherzog und dem
braven Iungen von Prinzen Gelegen-
heit gibt, sich freisinniger als die Ge-
lehrtenrepublik, ebenso unbestechlich wie
er selbst zu bewähren. Es wird in diesem
Stück etwas viel Wesens, Gesinnungs-
wesens von moralischen Selbstverständ-
lichkeiten gemacht, aber die Atmosphäre
dcs norddeutschen Kleinstaatlebens, die
romantischer und idhllischer ist, als die
Berliner Kritik sich träumen läßt, hat der
Mecklenburger auch hier mit der heim-
lichen Verliebtheit eines nur leise iro-
nisch lächelnden Realisten gut getroffen.
Glaßbrenner freilich sah schär-
fer, und wenn einer daher kommt und,
wie jetzt der Spielleiter des Kleinen
Theaters, ein paar seiner Berliner
Gassen-, Bürger-, Kneip- und Ge-
richtsszenen auf die Schnur einer
dramatischen Handlung reiht, so wird
Nante, der Eckensteher, der „ge-
bildete Luley" von (8^0, nicht bloß
zu einem Eulen-, nein, auch zu
einem Kulturspiegel der ganzen vor-
märzlichen Spreeherrlichkeit. Man
lacht, aber man versteht nachträglich
auch, daß dieser „Berliner Don Qui-
chote der öffentlichen Meinung" sich
das Pseudonhm Brennglas wählte und
von seinen Späßen behauptete, sie seien
oft aus einer sehr ernsten Familie, wo
der Vater Schmerz, die Mutter Herz
heiße. Friedrich Düsel
schuldigten gedemütigt hat, geben sie's
ihr wieder, zugleich mit der Erkennt-
nis, daß der alte, am Weihnachts-
abend verschiedene Konservator, der
einsam und unerkannt seine letzten
Tage verbrachte, ihr Vater war, dem
sie nun wenigstens, ties erschüttert in
ihrem Muttergefühl, die müden Augen
zudrücken darf. Ietzt erst mag auch
sie, gestraft, bekehrt, geläutert und in
das Land ihrer Kindheit zurückgeführt,
fröhliche Weihnacht feiern ... Strind-
berg, den unerbittlichen Bekenner und
Geißelbruder seines eignen Erlebens,
erkennen wir hier nur in der Ge-
stalt des einsamen, zwischen Büchern
und Schriften vergrabenen Gelehrten,
der früh Haus und Garten, Weib
und Kind verließ, um den Welt-
rätseln, dem Geheimnis des Alls uach-
zuforschen, der lieblos gestorben wäre,
wenn sich nicht zum Dank für scine
bewahrte Güte die Natur in Gestalt
des Trolls tröstend an sein letztes
Lager gesetzt und ihn durch die Brille
der Weitsichtigkeit einen Blick in den
Zusammenhang der Dinge, den wah-
ren Wert des Lebens hätte tun lassen.
Alles übrige könnte ebensogut von
Görner oder — wenn die kindlich
tuenden Verse der Äbersetzung (von
Emil Schering) nur einigermaßen die
Form des Originals wiedergeben —
von Max Iungnickel sein. Vielleicht
ist gerade dies Stück das lehrreichste
Schulbeispiel dafür, wie diesem Dich-
ter der Boden unter den Füßeu weg-
sinkt, sobald er nur Miene macht, den
Bekenner zu verabschieden und an
seine Stelle den Gestalter zu setzen.
Ich weiß: andere werden das stumme
Spiel, zu dem sich das Werk auf den
Höhepunkten der Handlung flüchtet, für
eine besondre Feinheit, wenn nicht gar
für eine Genialität erachten und in
die mitspielenden Geräusche des viel-
stöckigen Hauses, eines mit Menschen-
schicksalen vollgepfropften „Babeltur-
mes", allerlei Tiefsinnigkeiten hinein-
geheimnissen — mir erscheint das
alles nur wie ein äußerlicher und gar
zu billiger Behelf eines Dichters, der
nicht gesonnen war, für ein morali-
sches Spiel der Phantasie in die
Schächte seines Ichs hinabzusteigen,
wo seine Reichtümer liegen.
Max Dreyer, dem Vater des
„Probekandidaten" und jetzt des vom
Komödienhaus aufgeführteu „Uub e-
stechlichen", darf diescr Vorwurf
der Antreue gegen sich selbst erspart
bleiben. Er kreist auch hier wieder
um sein angestammtes Lieblingsthema:
ein geistig Freier und Aufrechter,
aber Lebensunerfahrener wird durch
die Versuchungen und Nöte der Welt
für einen Augenblick aus der ge-
raden Bahn seines Charakters gewor-
fen, um sich dann, wenn das Strau-
cheln überwunden, um so fester und
steiler auf sich selbst zu besinnen und
zu behaupten. Diesmal ist es ein
schon betagter Aniversitätsprofessor,
der in einer schwachen Stuude bei
den Promotionsarbeiten des Landes-
prinzen fünf gerade sein läßt, sich
dann aber uoch rechtzeitig, schonungs-
los gegen Hof und Fakultät, scho-
nungsloser gegen sich selbst, korrigiert
und so dem Großherzog und dem
braven Iungen von Prinzen Gelegen-
heit gibt, sich freisinniger als die Ge-
lehrtenrepublik, ebenso unbestechlich wie
er selbst zu bewähren. Es wird in diesem
Stück etwas viel Wesens, Gesinnungs-
wesens von moralischen Selbstverständ-
lichkeiten gemacht, aber die Atmosphäre
dcs norddeutschen Kleinstaatlebens, die
romantischer und idhllischer ist, als die
Berliner Kritik sich träumen läßt, hat der
Mecklenburger auch hier mit der heim-
lichen Verliebtheit eines nur leise iro-
nisch lächelnden Realisten gut getroffen.
Glaßbrenner freilich sah schär-
fer, und wenn einer daher kommt und,
wie jetzt der Spielleiter des Kleinen
Theaters, ein paar seiner Berliner
Gassen-, Bürger-, Kneip- und Ge-
richtsszenen auf die Schnur einer
dramatischen Handlung reiht, so wird
Nante, der Eckensteher, der „ge-
bildete Luley" von (8^0, nicht bloß
zu einem Eulen-, nein, auch zu
einem Kulturspiegel der ganzen vor-
märzlichen Spreeherrlichkeit. Man
lacht, aber man versteht nachträglich
auch, daß dieser „Berliner Don Qui-
chote der öffentlichen Meinung" sich
das Pseudonhm Brennglas wählte und
von seinen Späßen behauptete, sie seien
oft aus einer sehr ernsten Familie, wo
der Vater Schmerz, die Mutter Herz
heiße. Friedrich Düsel