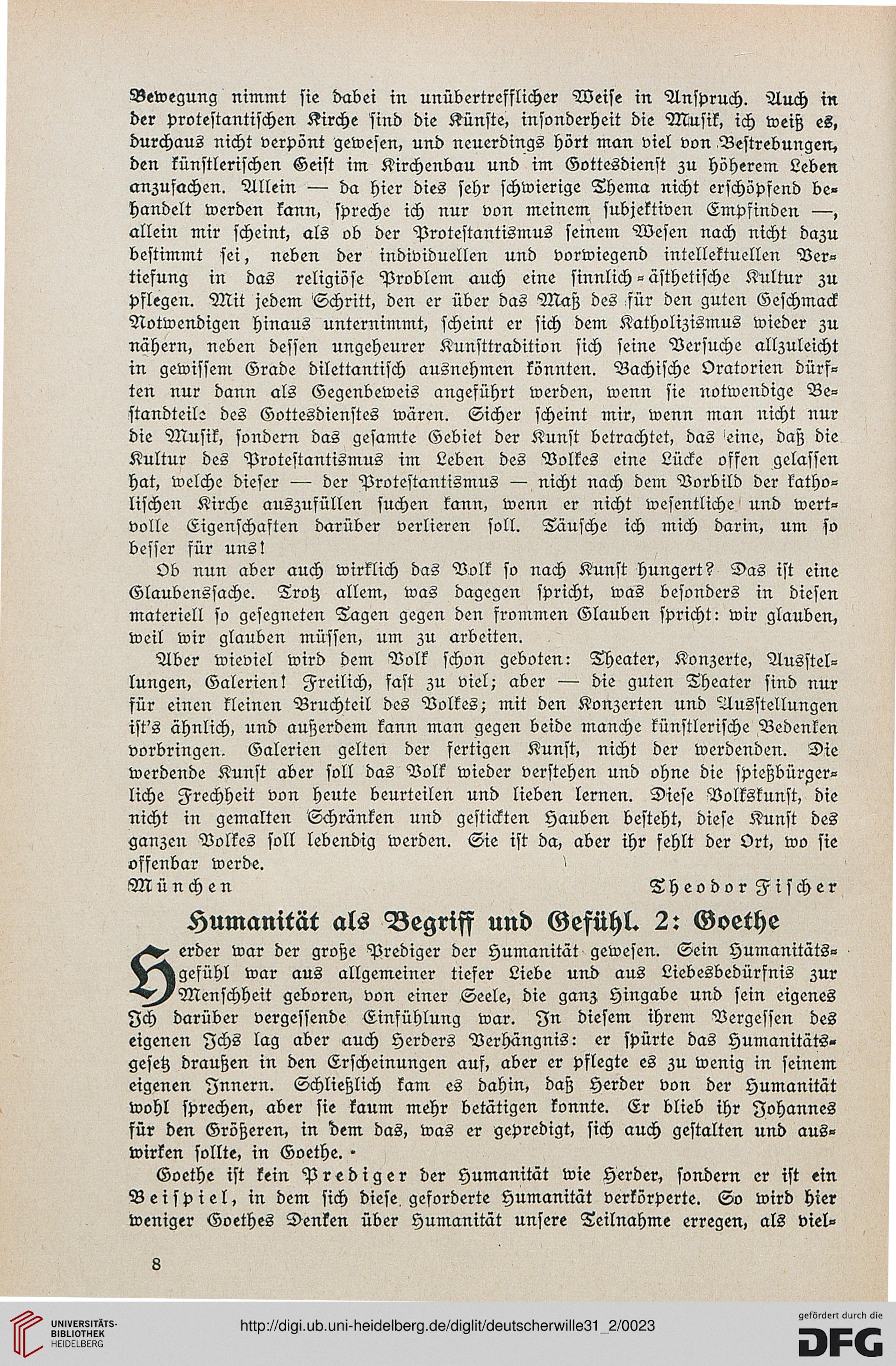Bewegung nimmt sie dabei in nnübertrefflicher Weise in Anspruch. Auch in
der protestantischen Kirche sind die Künste, insonderheit die Musik, ich weiß es,
durchaus nicht verpönt gewesen, und neuerdings hört man viel von Bestrebungen,
den künstlerischen Geist im Kirchenbau und im Gottesdienst zu höherem Leben
anzufachen. Allein — da hier dies sehr schwierige Thema nicht erschöpfend be-
handelt werden kann, spreche ich nur von meinem subjektiven Empfinden —,
allein mir scheint, als ob der Protestantismus seinem Wesen nach nicht dazu
bestimmt sei, neben der individuellen und vorwiegend intellektuellen Ver--
tiefung in das religiöse Problem auch eine sinnlich - ästhetische Kultur zu
pflegen. Mit jedem 'Schritt, den er über das Maß des für den guten Geschmack
Notwendigen hinaus unternimmt, scheint er sich dem Katholizismus wieder zu
nähern, neben dessen ungeheurer Kunsttradition sich seine Versuche allzuleicht
in gewisseni. Grade dilettantisch ansnehmen könnten. Bachische Oratorien dürf-
ten nur dann als Gegenbeweis angeführt werden, wenn sie notwendige Be-
standteile des Gottesdienstes wären. Sicher scheint mir, wenn man nicht nur
die Musik, sondern das gesamte Gebiet der Kunst betrachtet, das mne, daß die
Kultur des Protestantismus im Leben des Volkes eine Lücke offen gelassen
hat, welche dieser ^— der Protestantismus — nicht nach dem Vorbild der kätho-
lischen Kirche anszufüllen suchen kann, wenn er nicht wesentliche und wert-
volle Eigenschaften darüber verlieren soll. Täusche ich mich darin, um so
besser für uns!
Ob nun aber auch wirklich das Volk so nach Künst hungert? Das ist eine
Glaubenssache. Trotz allem, was dagegen spricht, was besonders in diesen
materiell so gesegneten Tagen gegen den frommen Glauben spricht: wir glanben,
weil wir glauben müssen, um zu arbeiten.
Aber wieviel wird dem Volk schon geboten: Theater, Konzerte, Ausstel-
lungen, Galerien! Freilich, fast zu viel; aber — die guten Theater sind nur
für einen kleinen Bruchteil des Volkes; mit den Konzerten und Ausstellungen
ist's ähnlich, und außerdem kann man gegen beide manche künstlerische Pedenken
vorbringen. Galerien gelten der fertigen Kunst, nicht der werdenden. Die
werdende Kunst aber soll das Volk wieder verstehen und ohne die spießbürger-
liche Frechheit von heute beurteilen und lieben lernen. Diese Volkskunst, die
nicht in gemalten Schränken und gestickten Hauben besteht, diese Kunst des
ganzen Volkes soll lebendig werden. Sie ist da, aber ihr fehlt der Ort, wo sie
offenbar werde. !
München LheodorFischer
Hurnanität als Begriff und Gefühl. 2: Goethe
erder war der große Prediger der Humanität gewesen. Sein Humanitäts-
VHgefühl war aus allgemeiner tiefer Liebe und aus Liebesbedürfnis zur
^^Menschheit geboren, von einer Seele, die ganz Hingabe und sein eigenes
Ich darüber vergessende Einfühlung war. In diesem ihrem Vergessen des
eigenen Jchs lag aber auch Herders Verhängnis: er spürte das Humanitäts-
gesetz dranßen in den Erscheinungen auf, aber er pflegte es zu wenig in seinem
eigenen Innern. Schließlich kam es dahin, daß Herder von der Humanität
wohl sprechen, aber sie kaum mehr betätigen konnte. Er blieb ihr Iohannes
für den Größeren, in dem das, was er gepredigt, sich auch gestalten und aus-
wirken sollte, in Goethe. -
Goethe ist kein Prediger der Humanität wie Herder, sondern er ist «in
Beispiel, in dem sich diese geforderte Humanität verkörperte. So wird hier
weniger Goethes Denken über Humanität unsere Teilnahme erregen, als viel-
8
der protestantischen Kirche sind die Künste, insonderheit die Musik, ich weiß es,
durchaus nicht verpönt gewesen, und neuerdings hört man viel von Bestrebungen,
den künstlerischen Geist im Kirchenbau und im Gottesdienst zu höherem Leben
anzufachen. Allein — da hier dies sehr schwierige Thema nicht erschöpfend be-
handelt werden kann, spreche ich nur von meinem subjektiven Empfinden —,
allein mir scheint, als ob der Protestantismus seinem Wesen nach nicht dazu
bestimmt sei, neben der individuellen und vorwiegend intellektuellen Ver--
tiefung in das religiöse Problem auch eine sinnlich - ästhetische Kultur zu
pflegen. Mit jedem 'Schritt, den er über das Maß des für den guten Geschmack
Notwendigen hinaus unternimmt, scheint er sich dem Katholizismus wieder zu
nähern, neben dessen ungeheurer Kunsttradition sich seine Versuche allzuleicht
in gewisseni. Grade dilettantisch ansnehmen könnten. Bachische Oratorien dürf-
ten nur dann als Gegenbeweis angeführt werden, wenn sie notwendige Be-
standteile des Gottesdienstes wären. Sicher scheint mir, wenn man nicht nur
die Musik, sondern das gesamte Gebiet der Kunst betrachtet, das mne, daß die
Kultur des Protestantismus im Leben des Volkes eine Lücke offen gelassen
hat, welche dieser ^— der Protestantismus — nicht nach dem Vorbild der kätho-
lischen Kirche anszufüllen suchen kann, wenn er nicht wesentliche und wert-
volle Eigenschaften darüber verlieren soll. Täusche ich mich darin, um so
besser für uns!
Ob nun aber auch wirklich das Volk so nach Künst hungert? Das ist eine
Glaubenssache. Trotz allem, was dagegen spricht, was besonders in diesen
materiell so gesegneten Tagen gegen den frommen Glauben spricht: wir glanben,
weil wir glauben müssen, um zu arbeiten.
Aber wieviel wird dem Volk schon geboten: Theater, Konzerte, Ausstel-
lungen, Galerien! Freilich, fast zu viel; aber — die guten Theater sind nur
für einen kleinen Bruchteil des Volkes; mit den Konzerten und Ausstellungen
ist's ähnlich, und außerdem kann man gegen beide manche künstlerische Pedenken
vorbringen. Galerien gelten der fertigen Kunst, nicht der werdenden. Die
werdende Kunst aber soll das Volk wieder verstehen und ohne die spießbürger-
liche Frechheit von heute beurteilen und lieben lernen. Diese Volkskunst, die
nicht in gemalten Schränken und gestickten Hauben besteht, diese Kunst des
ganzen Volkes soll lebendig werden. Sie ist da, aber ihr fehlt der Ort, wo sie
offenbar werde. !
München LheodorFischer
Hurnanität als Begriff und Gefühl. 2: Goethe
erder war der große Prediger der Humanität gewesen. Sein Humanitäts-
VHgefühl war aus allgemeiner tiefer Liebe und aus Liebesbedürfnis zur
^^Menschheit geboren, von einer Seele, die ganz Hingabe und sein eigenes
Ich darüber vergessende Einfühlung war. In diesem ihrem Vergessen des
eigenen Jchs lag aber auch Herders Verhängnis: er spürte das Humanitäts-
gesetz dranßen in den Erscheinungen auf, aber er pflegte es zu wenig in seinem
eigenen Innern. Schließlich kam es dahin, daß Herder von der Humanität
wohl sprechen, aber sie kaum mehr betätigen konnte. Er blieb ihr Iohannes
für den Größeren, in dem das, was er gepredigt, sich auch gestalten und aus-
wirken sollte, in Goethe. -
Goethe ist kein Prediger der Humanität wie Herder, sondern er ist «in
Beispiel, in dem sich diese geforderte Humanität verkörperte. So wird hier
weniger Goethes Denken über Humanität unsere Teilnahme erregen, als viel-
8