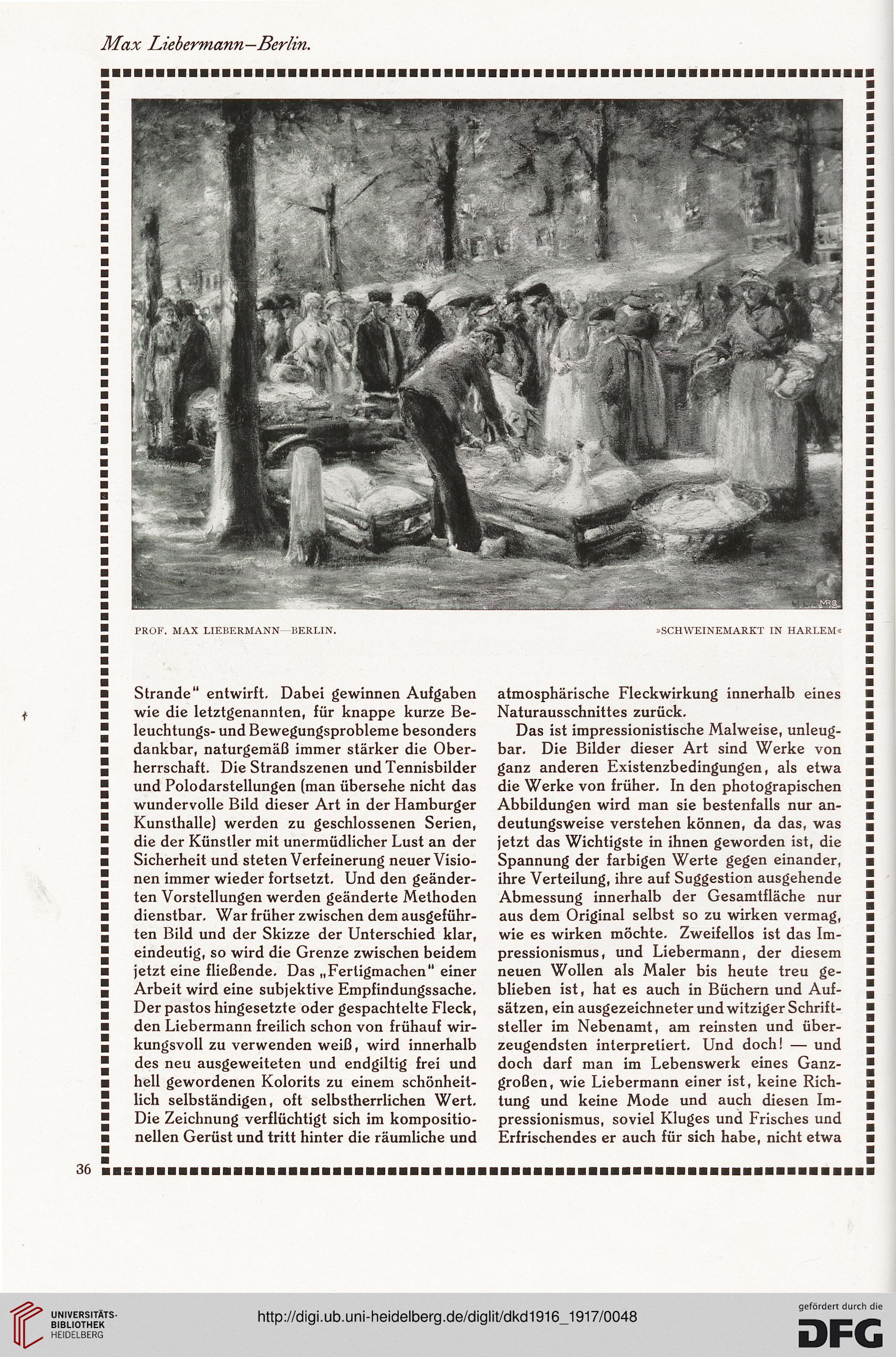Max Liebermann—Berlin.
Strande" entwirft. Dabei gewinnen Aufgaben
wie die letztgenannten, für knappe kurze Be-
leuchtungs- und Bewegungsprobleme besonders
dankbar, naturgemäß immer stärker die Ober-
herrschaft. Die Strandszenen und Tennisbilder
und Polodarstellungen (man übersehe nicht das
wundervolle Bild dieser Art in der Hamburger
Kunsthalle) werden zu geschlossenen Serien,
die der Künstler mit unermüdlicher Lust an der
Sicherheit und steten Verfeinerung neuer Visio-
nen immer wieder fortsetzt. Und den geänder-
ten Vorstellungen werden geänderte Methoden
dienstbar. War früher zwischen dem ausgeführ-
ten Bild und der Skizze der Unterschied klar,
eindeutig, so wird die Grenze zwischen beidem
jetzt eine fließende. Das „Fertigmachen" einer
Arbeit wird eine subjektive Empfindungssache.
Der pastos hingesetzte oder gespachtelte Fleck,
den Liebermann freilich schon von frühauf wir-
kungsvoll zu verwenden weiß, wird innerhalb
des neu ausgeweiteten und endgiltig frei und
hell gewordenen Kolorits zu einem schönheit-
lich selbständigen, oft selbstherrlichen Wert.
Die Zeichnung verflüchtigt sich im kompositio-
neilen Gerüst und tritt hinter die räumliche und
atmosphärische Fleckwirkung innerhalb eines
Naturausschnittes zurück.
Das ist impressionistische Malweise, unleug-
bar. Die Bilder dieser Art sind Werke von
ganz anderen Existenzbedingungen, als etwa
die Werke von früher. In den photograpischen
Abbildungen wird man sie bestenfalls nur an-
deutungsweise verstehen können, da das, was
jetzt das Wichtigste in ihnen geworden ist, die
Spannung der farbigen Werte gegen einander,
ihre Verteilung, ihre auf Suggestion ausgehende
Abmessung innerhalb der Gesamtfläche nur
aus dem Original selbst so zu wirken vermag,
wie es wirken möchte. Zweifellos ist das Im-
pressionismus, und Liebermann, der diesem
neuen Wollen als Maler bis heute treu ge-
blieben ist, hat es auch in Büchern und Auf-
sätzen, ein ausgezeichneter und witziger Schrift-
steller im Nebenamt, am reinsten und über-
zeugendsten interpretiert. Und doch! — und
doch darf man im Lebenswerk eines Ganz-
großen, wie Liebermann einer ist, keine Rich-
tung und keine Mode und auch diesen Im-
pressionismus, soviel Kluges und Frisches und
Erfrischendes er auch für sich habe, nicht etwa
Strande" entwirft. Dabei gewinnen Aufgaben
wie die letztgenannten, für knappe kurze Be-
leuchtungs- und Bewegungsprobleme besonders
dankbar, naturgemäß immer stärker die Ober-
herrschaft. Die Strandszenen und Tennisbilder
und Polodarstellungen (man übersehe nicht das
wundervolle Bild dieser Art in der Hamburger
Kunsthalle) werden zu geschlossenen Serien,
die der Künstler mit unermüdlicher Lust an der
Sicherheit und steten Verfeinerung neuer Visio-
nen immer wieder fortsetzt. Und den geänder-
ten Vorstellungen werden geänderte Methoden
dienstbar. War früher zwischen dem ausgeführ-
ten Bild und der Skizze der Unterschied klar,
eindeutig, so wird die Grenze zwischen beidem
jetzt eine fließende. Das „Fertigmachen" einer
Arbeit wird eine subjektive Empfindungssache.
Der pastos hingesetzte oder gespachtelte Fleck,
den Liebermann freilich schon von frühauf wir-
kungsvoll zu verwenden weiß, wird innerhalb
des neu ausgeweiteten und endgiltig frei und
hell gewordenen Kolorits zu einem schönheit-
lich selbständigen, oft selbstherrlichen Wert.
Die Zeichnung verflüchtigt sich im kompositio-
neilen Gerüst und tritt hinter die räumliche und
atmosphärische Fleckwirkung innerhalb eines
Naturausschnittes zurück.
Das ist impressionistische Malweise, unleug-
bar. Die Bilder dieser Art sind Werke von
ganz anderen Existenzbedingungen, als etwa
die Werke von früher. In den photograpischen
Abbildungen wird man sie bestenfalls nur an-
deutungsweise verstehen können, da das, was
jetzt das Wichtigste in ihnen geworden ist, die
Spannung der farbigen Werte gegen einander,
ihre Verteilung, ihre auf Suggestion ausgehende
Abmessung innerhalb der Gesamtfläche nur
aus dem Original selbst so zu wirken vermag,
wie es wirken möchte. Zweifellos ist das Im-
pressionismus, und Liebermann, der diesem
neuen Wollen als Maler bis heute treu ge-
blieben ist, hat es auch in Büchern und Auf-
sätzen, ein ausgezeichneter und witziger Schrift-
steller im Nebenamt, am reinsten und über-
zeugendsten interpretiert. Und doch! — und
doch darf man im Lebenswerk eines Ganz-
großen, wie Liebermann einer ist, keine Rich-
tung und keine Mode und auch diesen Im-
pressionismus, soviel Kluges und Frisches und
Erfrischendes er auch für sich habe, nicht etwa