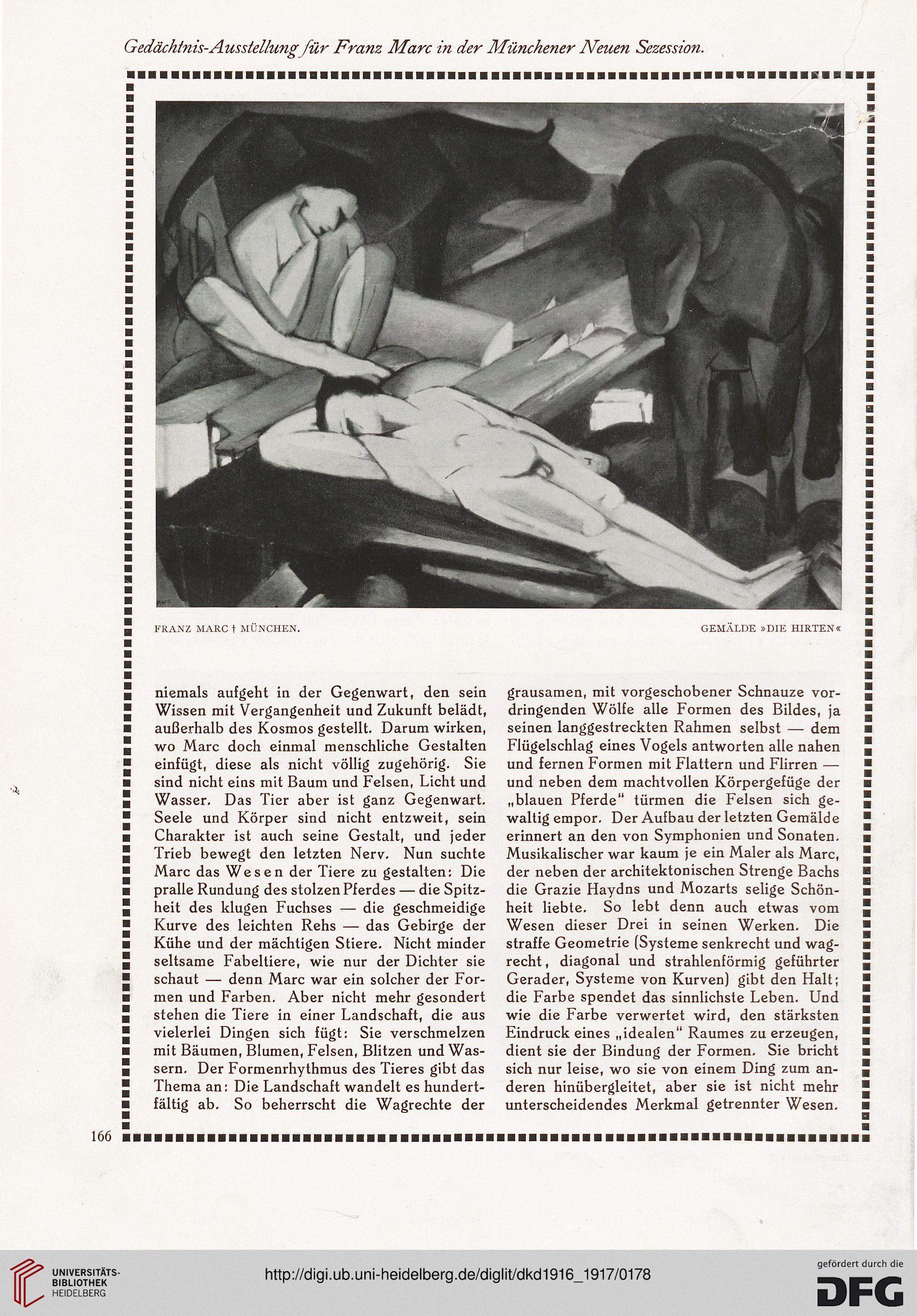Gedächtnis-Ausstellung für Franz Marc in der Münchener Neuen Sezession.
niemals aufgeht in der Gegenwart, den sein
Wissen mit Vergangenheit und Zukunft belädt,
außerhalb des Kosmos gestellt. Darum wirken,
wo Marc doch einmal menschliche Gestalten
einfügt, diese als nicht völlig zugehörig. Sie
sind nicht eins mit Baum und Felsen, Licht und
Wasser. Das Tier aber ist ganz Gegenwart.
Seele und Körper sind nicht entzweit, sein
Charakter ist auch seine Gestalt, und jeder
Trieb bewegt den letzten Nerv. Nun suchte
Marc das Wesen der Tiere zu gestalten: Die
pralle Rundung des stolzen Pferdes — die Spitz-
heit des klugen Fuchses — die geschmeidige
Kurve des leichten Rehs — das Gebirge der
Kühe und der mächtigen Stiere. Nicht minder
seltsame Fabeltiere, wie nur der Dichter sie
schaut — denn Marc war ein solcher der For-
men und Farben. Aber nicht mehr gesondert
stehen die Tiere in einer Landschaft, die aus
vielerlei Dingen sich fügt: Sie verschmelzen
mit Bäumen, Blumen, Felsen, Blitzen und Was-
sern. Der Formenrhythmus des Tieres gibt das
Thema an: Die Landschaft wandelt es hundert-
fältig ab. So beherrscht die Wagrechte der
grausamen, mit vorgeschobener Schnauze vor-
dringenden Wölfe alle Formen des Bildes, ja
seinen langgestreckten Rahmen selbst — dem
Flügelschlag eines Vogels antworten alle nahen
und fernen Formen mit Flattern und Flirren —
und neben dem machtvollen Körpergefüge der
„blauen Pferde" türmen die Felsen sich ge-
waltig empor. Der Aufbau der letzten Gemälde
erinnert an den von Symphonien und Sonaten.
Musikalischer war kaum je ein Maler als Marc,
der neben der architektonischen Strenge Bachs
die Grazie Haydns und Mozarts selige Schön-
heit liebte. So lebt denn auch etwas vom
Wesen dieser Drei in seinen Werken. Die
straffe Geometrie (Systeme senkrecht und wag-
recht , diagonal und strahlenförmig geführter
Gerader, Systeme von Kurven) gibt den Halt;
die Farbe spendet das sinnlichste Leben. Und
wie die Farbe verwertet wird, den stärksten
Eindruck eines „idealen" Raumes zu erzeugen,
dient sie der Bindung der Formen. Sie bricht
sich nur leise, wo sie von einem Ding zum an-
deren hinübergleitet, aber sie ist nicht mehr
unterscheidendes Merkmal getrennter Wesen.
niemals aufgeht in der Gegenwart, den sein
Wissen mit Vergangenheit und Zukunft belädt,
außerhalb des Kosmos gestellt. Darum wirken,
wo Marc doch einmal menschliche Gestalten
einfügt, diese als nicht völlig zugehörig. Sie
sind nicht eins mit Baum und Felsen, Licht und
Wasser. Das Tier aber ist ganz Gegenwart.
Seele und Körper sind nicht entzweit, sein
Charakter ist auch seine Gestalt, und jeder
Trieb bewegt den letzten Nerv. Nun suchte
Marc das Wesen der Tiere zu gestalten: Die
pralle Rundung des stolzen Pferdes — die Spitz-
heit des klugen Fuchses — die geschmeidige
Kurve des leichten Rehs — das Gebirge der
Kühe und der mächtigen Stiere. Nicht minder
seltsame Fabeltiere, wie nur der Dichter sie
schaut — denn Marc war ein solcher der For-
men und Farben. Aber nicht mehr gesondert
stehen die Tiere in einer Landschaft, die aus
vielerlei Dingen sich fügt: Sie verschmelzen
mit Bäumen, Blumen, Felsen, Blitzen und Was-
sern. Der Formenrhythmus des Tieres gibt das
Thema an: Die Landschaft wandelt es hundert-
fältig ab. So beherrscht die Wagrechte der
grausamen, mit vorgeschobener Schnauze vor-
dringenden Wölfe alle Formen des Bildes, ja
seinen langgestreckten Rahmen selbst — dem
Flügelschlag eines Vogels antworten alle nahen
und fernen Formen mit Flattern und Flirren —
und neben dem machtvollen Körpergefüge der
„blauen Pferde" türmen die Felsen sich ge-
waltig empor. Der Aufbau der letzten Gemälde
erinnert an den von Symphonien und Sonaten.
Musikalischer war kaum je ein Maler als Marc,
der neben der architektonischen Strenge Bachs
die Grazie Haydns und Mozarts selige Schön-
heit liebte. So lebt denn auch etwas vom
Wesen dieser Drei in seinen Werken. Die
straffe Geometrie (Systeme senkrecht und wag-
recht , diagonal und strahlenförmig geführter
Gerader, Systeme von Kurven) gibt den Halt;
die Farbe spendet das sinnlichste Leben. Und
wie die Farbe verwertet wird, den stärksten
Eindruck eines „idealen" Raumes zu erzeugen,
dient sie der Bindung der Formen. Sie bricht
sich nur leise, wo sie von einem Ding zum an-
deren hinübergleitet, aber sie ist nicht mehr
unterscheidendes Merkmal getrennter Wesen.