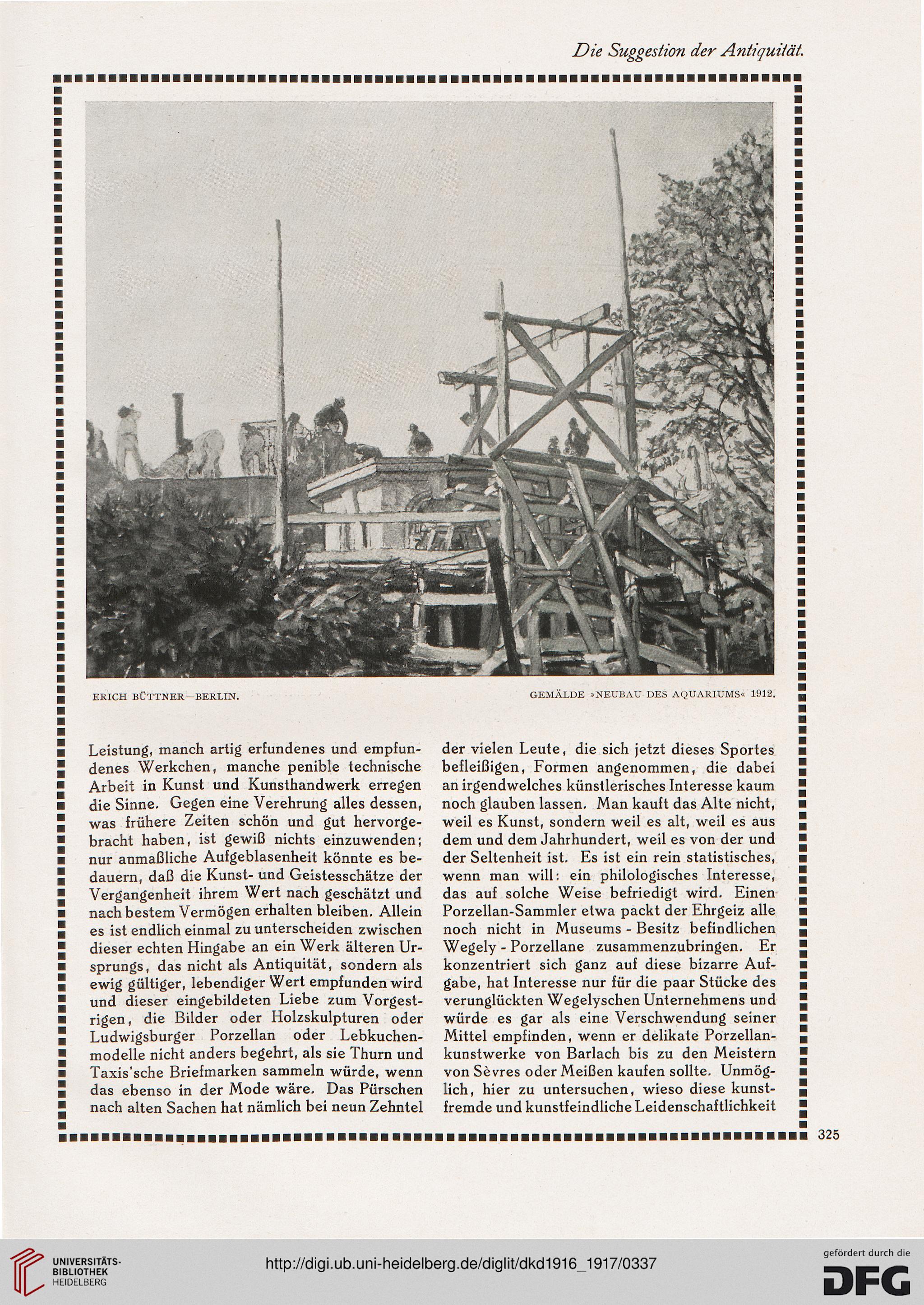Die Suggestion der Antiquität.
ERICH BUTTNER BERLIN.
GEMÄLDE »NEUBAU DES AQUARIUMS« 1912.
Leistung, manch artig erfundenes und empfun-
denes Werkchen, manche penible technische
Arbeit in Kunst und Kunsthandwerk erregen
die Sinne. Gegen eine Verehrung alles dessen,
was frühere Zeiten schön und gut hervorge-
bracht haben, ist gewiß nichts einzuwenden;
nur anmaßliche Aufgeblasenheit könnte es be-
dauern, daß die Kunst- und Geistesschätze der
Vergangenheit ihrem Wert nach geschätzt und
nach bestem Vermögen erhalten bleiben. Allein
es ist endlich einmal zu unterscheiden zwischen
dieser echten Hingabe an ein Werk älteren Ur-
sprungs, das nicht als Antiquität, sondern als
ewig gültiger, lebendiger Wert empfunden wird
und dieser eingebildeten Liebe zum Vorgest-
rigen, die Bilder oder Holzskulpturen oder
Ludwigsburger Porzellan oder Lebkuchen-
modelle nicht anders begehrt, als sie Thum und
Taxis'sche Briefmarken sammeln würde, wenn
das ebenso in der Mode wäre. Das Pürschen
nach alten Sachen hat nämlich bei neun Zehntel
der vielen Leute, die sich jetzt dieses Sportes
befleißigen, Formen angenommen, die dabei
an irgendwelches künstlerisches Interesse kaum
noch glauben lassen. Man kauft das Alte nicht,
weil es Kunst, sondern weil es alt, weil es aus
dem und dem Jahrhundert, weil es von der und
der Seltenheit ist. Es ist ein rein statistisches,
wenn man will: ein philologisches Interesse,
das auf solche Weise befriedigt wird. Einen
Porzellan-Sammler etwa packt der Ehrgeiz alle
noch nicht in Museums - Besitz befindlichen
Wegely - Porzellane zusammenzubringen. Er
konzentriert sich ganz auf diese bizarre Auf-
gabe, hat Interesse nur für die paar Stücke des
verunglückten Wegelyschen Unternehmens und
würde es gar als eine Verschwendung seiner
Mittel empfinden, wenn er delikate Porzellan-
kunstwerke von Barlach bis zu den Meistern
von Sevres oder Meißen kaufen sollte. Unmög-
lich, hier zu untersuchen, wieso diese kunst-
fremde und kunstfeindliche Leidenschaftlichkeit
ERICH BUTTNER BERLIN.
GEMÄLDE »NEUBAU DES AQUARIUMS« 1912.
Leistung, manch artig erfundenes und empfun-
denes Werkchen, manche penible technische
Arbeit in Kunst und Kunsthandwerk erregen
die Sinne. Gegen eine Verehrung alles dessen,
was frühere Zeiten schön und gut hervorge-
bracht haben, ist gewiß nichts einzuwenden;
nur anmaßliche Aufgeblasenheit könnte es be-
dauern, daß die Kunst- und Geistesschätze der
Vergangenheit ihrem Wert nach geschätzt und
nach bestem Vermögen erhalten bleiben. Allein
es ist endlich einmal zu unterscheiden zwischen
dieser echten Hingabe an ein Werk älteren Ur-
sprungs, das nicht als Antiquität, sondern als
ewig gültiger, lebendiger Wert empfunden wird
und dieser eingebildeten Liebe zum Vorgest-
rigen, die Bilder oder Holzskulpturen oder
Ludwigsburger Porzellan oder Lebkuchen-
modelle nicht anders begehrt, als sie Thum und
Taxis'sche Briefmarken sammeln würde, wenn
das ebenso in der Mode wäre. Das Pürschen
nach alten Sachen hat nämlich bei neun Zehntel
der vielen Leute, die sich jetzt dieses Sportes
befleißigen, Formen angenommen, die dabei
an irgendwelches künstlerisches Interesse kaum
noch glauben lassen. Man kauft das Alte nicht,
weil es Kunst, sondern weil es alt, weil es aus
dem und dem Jahrhundert, weil es von der und
der Seltenheit ist. Es ist ein rein statistisches,
wenn man will: ein philologisches Interesse,
das auf solche Weise befriedigt wird. Einen
Porzellan-Sammler etwa packt der Ehrgeiz alle
noch nicht in Museums - Besitz befindlichen
Wegely - Porzellane zusammenzubringen. Er
konzentriert sich ganz auf diese bizarre Auf-
gabe, hat Interesse nur für die paar Stücke des
verunglückten Wegelyschen Unternehmens und
würde es gar als eine Verschwendung seiner
Mittel empfinden, wenn er delikate Porzellan-
kunstwerke von Barlach bis zu den Meistern
von Sevres oder Meißen kaufen sollte. Unmög-
lich, hier zu untersuchen, wieso diese kunst-
fremde und kunstfeindliche Leidenschaftlichkeit