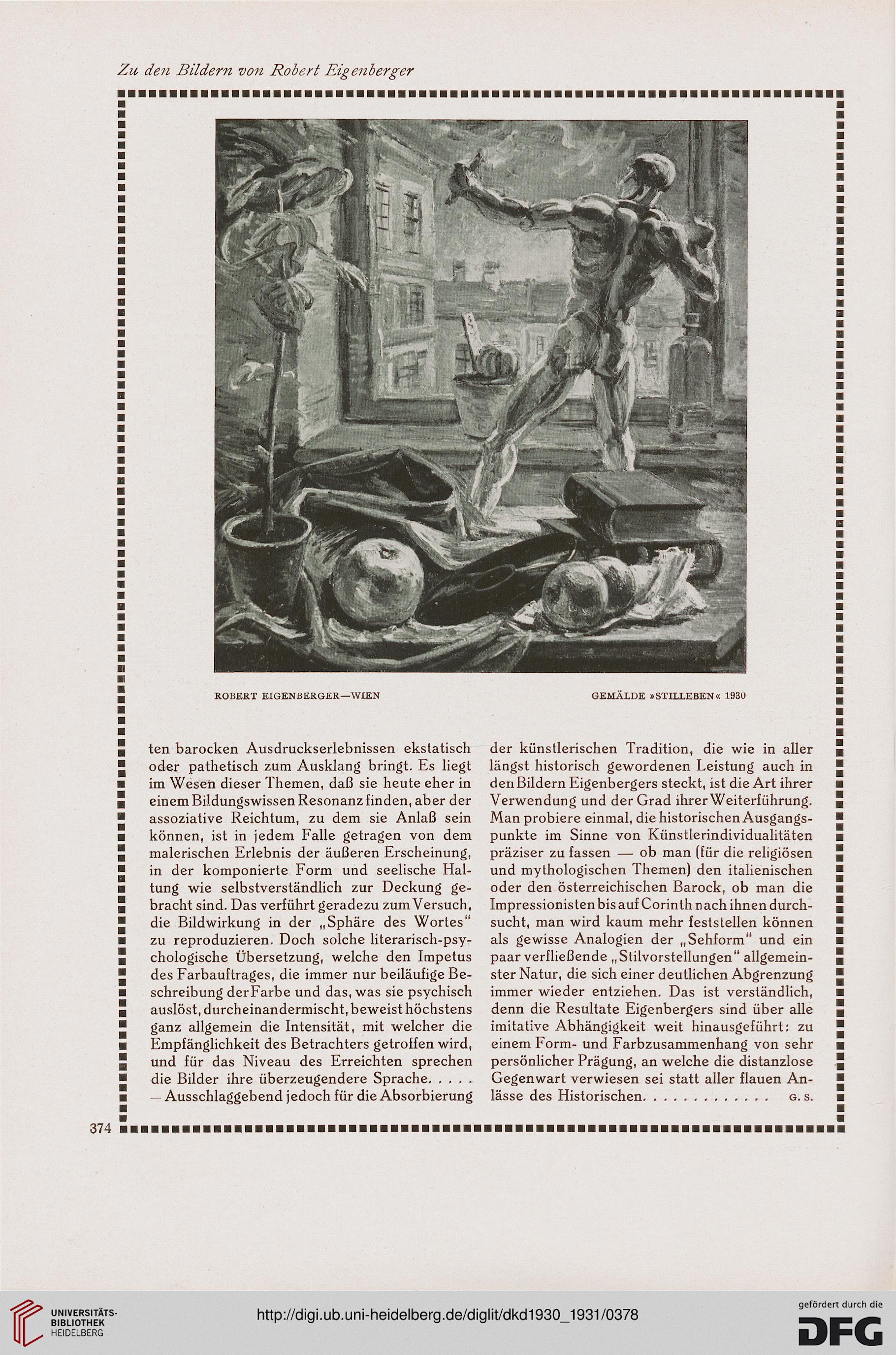Zu, den Bildern von Robert Eigenberger
robert eigenberger—wien
gemälde »stilleben« 1930
ten barocken Ausdruckserlebnissen ekstatisch
oder pathetisch zum Ausklang bringt. Es liegt
im Wesen dieser Themen, daß sie heute eher in
einem Bildungswissen Resonanz finden, aber der
assoziative Reichtum, zu dem sie Anlaß sein
können, ist in jedem Falle getragen von dem
malerischen Erlebnis der äußeren Erscheinung,
in der komponierte Form und seelische Hal-
tung wie selbstverständlich zur Deckung ge-
bracht sind. Das verführt geradezu zum Versuch,
die Bildwirkung in der „Sphäre des Wortes"
zu reproduzieren. Doch solche literarisch-psy-
chologische Übersetzung, welche den Impetus
des Farbauftrages, die immer nur beiläufige Be-
schreibung derFarbe und das, was sie psychisch
auslöst, durcheinandermischt, beweist höchstens
ganz allgemein die Intensität, mit welcher die
Empfänglichkeit des Betrachters getroffen wird,
und für das Niveau des Erreichten sprechen
die Bilder ihre überzeugendere Sprache.....
— Ausschlaggebend jedoch für die Absorbierung
der künstlerischen Tradition, die wie in aller
längst historisch gewordenen Leistung auch in
den Bildern Eigenbergers steckt, ist die Art ihrer
Verwendung und der Grad ihrer Weiterführung.
Man probiere einmal, die historischen Ausgangs-
punkte im Sinne von Künstlerindividualitäten
präziser zu fassen — ob man (für die religiösen
und mythologischen Themen) den italienischen
oder den österreichischen Barock, ob man die
Impressionisten bis auf Corinth n ach ihnen durch-
sucht, man wird kaum mehr feststellen können
als gewisse Analogien der „Sehform" und ein
paar verfließende „Stilvorstellungen" allgemein-
ster Natur, die sich einer deutlichen Abgrenzung
immer wieder entziehen. Das ist verständlich,
denn die Resultate Eigenbergers sind über alle
imitative Abhängigkeit weit hinausgeführt: zu
einem Form- und Farbzusammenhang von sehr
persönlicher Prägung, an welche die distanzlose
Gegenwart verwiesen sei statt aller flauen An-
lässe des Historischen............. g. s.
robert eigenberger—wien
gemälde »stilleben« 1930
ten barocken Ausdruckserlebnissen ekstatisch
oder pathetisch zum Ausklang bringt. Es liegt
im Wesen dieser Themen, daß sie heute eher in
einem Bildungswissen Resonanz finden, aber der
assoziative Reichtum, zu dem sie Anlaß sein
können, ist in jedem Falle getragen von dem
malerischen Erlebnis der äußeren Erscheinung,
in der komponierte Form und seelische Hal-
tung wie selbstverständlich zur Deckung ge-
bracht sind. Das verführt geradezu zum Versuch,
die Bildwirkung in der „Sphäre des Wortes"
zu reproduzieren. Doch solche literarisch-psy-
chologische Übersetzung, welche den Impetus
des Farbauftrages, die immer nur beiläufige Be-
schreibung derFarbe und das, was sie psychisch
auslöst, durcheinandermischt, beweist höchstens
ganz allgemein die Intensität, mit welcher die
Empfänglichkeit des Betrachters getroffen wird,
und für das Niveau des Erreichten sprechen
die Bilder ihre überzeugendere Sprache.....
— Ausschlaggebend jedoch für die Absorbierung
der künstlerischen Tradition, die wie in aller
längst historisch gewordenen Leistung auch in
den Bildern Eigenbergers steckt, ist die Art ihrer
Verwendung und der Grad ihrer Weiterführung.
Man probiere einmal, die historischen Ausgangs-
punkte im Sinne von Künstlerindividualitäten
präziser zu fassen — ob man (für die religiösen
und mythologischen Themen) den italienischen
oder den österreichischen Barock, ob man die
Impressionisten bis auf Corinth n ach ihnen durch-
sucht, man wird kaum mehr feststellen können
als gewisse Analogien der „Sehform" und ein
paar verfließende „Stilvorstellungen" allgemein-
ster Natur, die sich einer deutlichen Abgrenzung
immer wieder entziehen. Das ist verständlich,
denn die Resultate Eigenbergers sind über alle
imitative Abhängigkeit weit hinausgeführt: zu
einem Form- und Farbzusammenhang von sehr
persönlicher Prägung, an welche die distanzlose
Gegenwart verwiesen sei statt aller flauen An-
lässe des Historischen............. g. s.