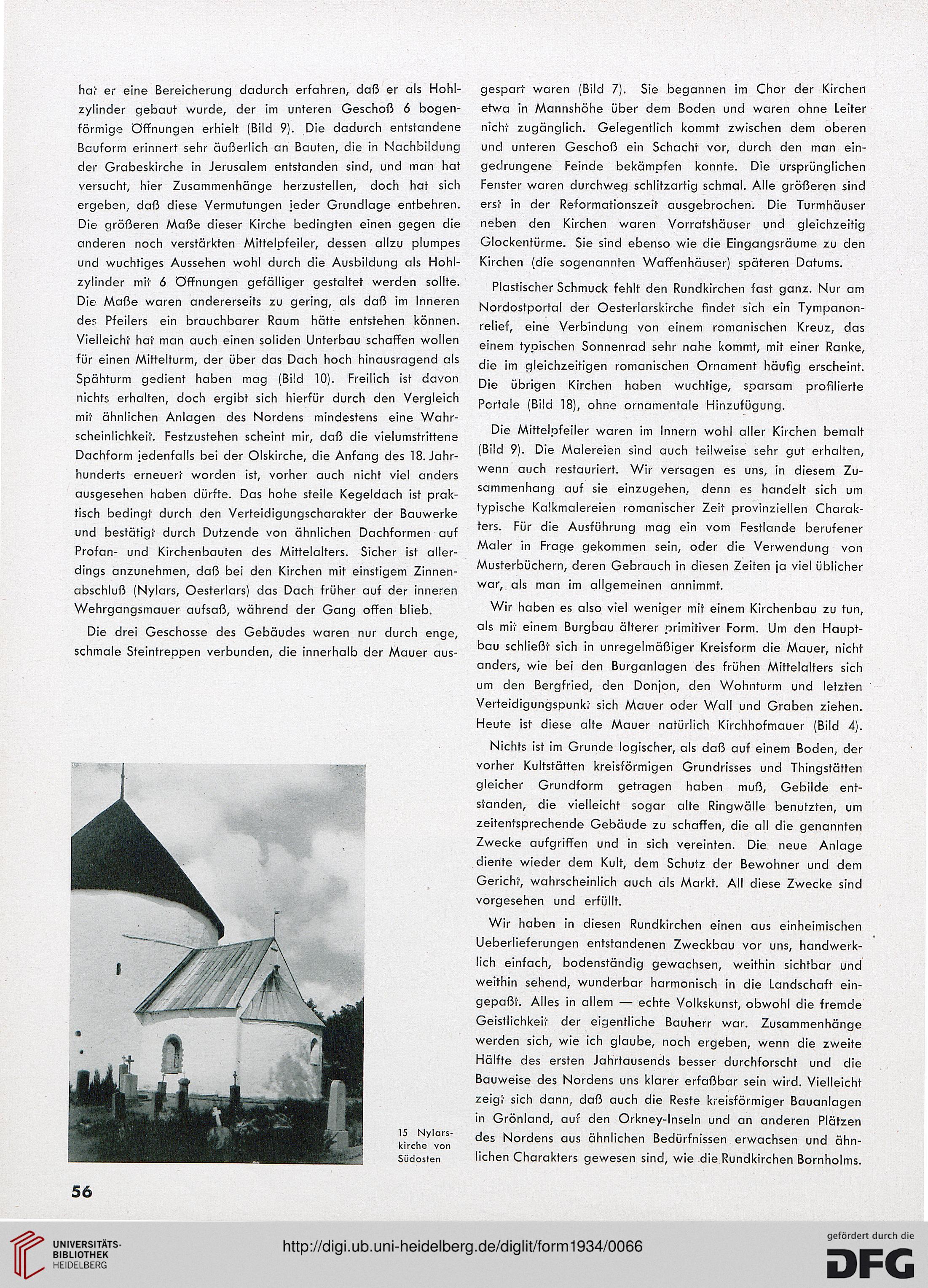haf er eine Bereicherung dadurch erfahren, daß er als Hohl-
zylinder gebaut wurde, der im unteren Geschoß 6 bogen-
förmige Offnungen erhielt (Bild 9). Die dadurch entstandene
Bauform erinnert sehr äußerlich an Bauten, die in Nachbildung
der Grabeskirche in Jerusalem entstanden sind, und man hat
versucht, hier Zusammenhänge herzustellen, doch hat sich
ergeben,, daß diese Vermutungen jeder Grundlage entbehren.
Die größeren Maße dieser Kirche bedingten einen gegen die
anderen noch verstärkten Mittelpfeiler, dessen allzu plumpes
und wuchtiges Aussehen wohl durch die Ausbildung als Hohl-
zylinder mit 6 Öffnungen gefälliger gestaltet werden sollte.
Die Maße waren andererseits zu gering, als daß im Inneren
der Pfeilers ein brauchbarer Raum hätte entstehen können.
Vielleicht hat man auch einen soliden Unterbau schaffen wollen
für einen Mittelturm, der über das Dach hoch hinausragend als
Spähturm gedient haben mag (Bild 10). Freilich ist davon
nichts erhalten, doch ergibt sich hierfür durch den Vergleich
mit ähnlichen Anlagen des Nordens mindestens eine Wahr-
scheinlichkeit. Festzustehen scheint mir, daß die vielumstrittene
Dachform jedenfalls bei der Olskirche, die Anfang des 18. Jahr-
hunderts erneuert worden ist, vorher auch nicht viel anders
ausgesehen haben dürfte. Das hohe steile Kegeldach ist prak-
tisch bedingt durch den Verteidigungscharakter der Bauwerke
und bestätigt durch Dutzende von ähnlichen Dachformen auf
Profan- und Kirchenbauten des Mittelalters. Sicher ist aller-
dings anzunehmen, daß bei den Kirchen mit einstigem Zinnen-
abschluß (Nylars, Oesterlars) das Dach früher auf der inneren
Wehrgangsmauer aufsaß, während der Gang offen blieb.
Die drei Geschosse des Gebäudes waren nur durch enge,
schmale Steintreppen verbunden, die innerhalb der Mauer aus-
15 Nylars-
kirche von
Südosten
gespart waren (Bild 7). Sie begannen im Chor der Kirchen
etwa in Mannshöhe über dem Boden und waren ohne Leiter
nicht zugänglich. Gelegentlich kommt zwischen dem oberen
und unteren Geschoß ein Schacht vor, durch den man ein-
gedrungene Feinde bekämpfen konnte. Die ursprünglichen
Fenster waren durchweg schlitzartig schmal. Alle größeren sind
erst in der Reformationszeit ausgebrochen. Die Turmhäuser
neben den Kirchen waren Vorratshäuser und gleichzeitig
Glockentürme. Sie sind ebenso wie die Eingangsräume zu den
Kirchen (die sogenannten Waffenhäuser) späteren Datums.
Plastischer Schmuck fehlt den Rundkirchen fast ganz. Nur am
Nordostportal der Oesteriarskirche findet sich ein Tympanon-
relief, eine Verbindung von einem romanischen Kreuz, das
einem typischen Sonnenrad sehr nahe kommt, mit einer Ranke,
die im gleichzeitigen romanischen Ornament häufig erscheint.
Die übrigen Kirchen haben wuchtige, sparsam profilierte
Portale (Büd 18), ohne ornamentale Hinzufügung.
Die Mittelpfeiler waren im Innern wohl aller Kirchen bemalt
(Bild 9). Die Malereien sind auch teilweise sehr gut erhalten,
wenn auch restauriert. Wir versagen es uns, in diesem Zu-
sammenhang auf sie einzugehen, denn es handelt sich um
typische Kaikmaiereien romanischer Zeit provinziellen Charak-
ters. Für die Ausführung mag ein vom Festlande berufener
Maler in Frage gekommen sein, oder die Verwendung von
Musterbüchern, deren Gebrauch in diesen Zeiten ja viel üblicher
war, als man im allgemeinen annimmt.
Wir haben es also viel weniger mit einem Kirchenbau zu tun,
als mit einem Burgbau älterer primitiver Form. Um den Haupt-
bau schließt sich in unregelmäßiger Kreisform die Mauer, nicht
anders, wie bei den Burganlagen des frühen Mittelalters sich
um den Bergfried, den Donjon, den Wohnturm und letzten
Verteidigungspunkt sich Mauer oder Wall und Graben ziehen.
Heute ist diese alte Mauer natürlich Kirchhofmauer (Bild 4).
Nichts ist im Grunde logischer, als daß auf einem Boden, der
vorher Kultstätten kreisförmigen Grundrisses und Thingstätten
gleicher Grundform getragen haben muß, Gebilde ent-
standen, die vielleicht sogar alte Ringwälle benutzten, um
zeitentsprechende Gebäude zu schaffen, die all die genannten
Zwecke aufgriffen und in sich vereinten. Die neue Anlage
diente wieder dem Kult, dem Schutz der Bewohner und dem
Gericht, wahrscheinlich auch als Markt. All diese Zwecke sind
vorgesehen und erfüllt.
Wir haben in diesen Rundkirchen einen aus einheimischen
Ueberlieferungen entstandenen Zweckbau vor uns, handwerk-
lich einfach, bodenständig gewachsen, weithin sichtbar und
weithin sehend, wunderbar harmonisch in die Landschaft ein-
gepaßt. Alles in allem — echte Volkskunst, obwohl die fremde
Geistlichkeit der eigentliche Bauherr war. Zusammenhänge
werden sich, wie ich glaube, noch ergeben, wenn die zweite
Hälfte des ersten Jahrtausends besser durchforscht und die
Bauweise des Nordens uns klarer erfaßbar sein wird. Vielleicht
zeigt sich dann, daß auch die Reste kreisförmiger Bauanlagen
in Grönland, auf den Orkney-Inseln und an anderen Plätzen
des Nordens aus ähnlichen Bedürfnissen erwachsen und ähn-
lichen Charakters gewesen sind, wie die Rundkirchen Bornholms.
56
zylinder gebaut wurde, der im unteren Geschoß 6 bogen-
förmige Offnungen erhielt (Bild 9). Die dadurch entstandene
Bauform erinnert sehr äußerlich an Bauten, die in Nachbildung
der Grabeskirche in Jerusalem entstanden sind, und man hat
versucht, hier Zusammenhänge herzustellen, doch hat sich
ergeben,, daß diese Vermutungen jeder Grundlage entbehren.
Die größeren Maße dieser Kirche bedingten einen gegen die
anderen noch verstärkten Mittelpfeiler, dessen allzu plumpes
und wuchtiges Aussehen wohl durch die Ausbildung als Hohl-
zylinder mit 6 Öffnungen gefälliger gestaltet werden sollte.
Die Maße waren andererseits zu gering, als daß im Inneren
der Pfeilers ein brauchbarer Raum hätte entstehen können.
Vielleicht hat man auch einen soliden Unterbau schaffen wollen
für einen Mittelturm, der über das Dach hoch hinausragend als
Spähturm gedient haben mag (Bild 10). Freilich ist davon
nichts erhalten, doch ergibt sich hierfür durch den Vergleich
mit ähnlichen Anlagen des Nordens mindestens eine Wahr-
scheinlichkeit. Festzustehen scheint mir, daß die vielumstrittene
Dachform jedenfalls bei der Olskirche, die Anfang des 18. Jahr-
hunderts erneuert worden ist, vorher auch nicht viel anders
ausgesehen haben dürfte. Das hohe steile Kegeldach ist prak-
tisch bedingt durch den Verteidigungscharakter der Bauwerke
und bestätigt durch Dutzende von ähnlichen Dachformen auf
Profan- und Kirchenbauten des Mittelalters. Sicher ist aller-
dings anzunehmen, daß bei den Kirchen mit einstigem Zinnen-
abschluß (Nylars, Oesterlars) das Dach früher auf der inneren
Wehrgangsmauer aufsaß, während der Gang offen blieb.
Die drei Geschosse des Gebäudes waren nur durch enge,
schmale Steintreppen verbunden, die innerhalb der Mauer aus-
15 Nylars-
kirche von
Südosten
gespart waren (Bild 7). Sie begannen im Chor der Kirchen
etwa in Mannshöhe über dem Boden und waren ohne Leiter
nicht zugänglich. Gelegentlich kommt zwischen dem oberen
und unteren Geschoß ein Schacht vor, durch den man ein-
gedrungene Feinde bekämpfen konnte. Die ursprünglichen
Fenster waren durchweg schlitzartig schmal. Alle größeren sind
erst in der Reformationszeit ausgebrochen. Die Turmhäuser
neben den Kirchen waren Vorratshäuser und gleichzeitig
Glockentürme. Sie sind ebenso wie die Eingangsräume zu den
Kirchen (die sogenannten Waffenhäuser) späteren Datums.
Plastischer Schmuck fehlt den Rundkirchen fast ganz. Nur am
Nordostportal der Oesteriarskirche findet sich ein Tympanon-
relief, eine Verbindung von einem romanischen Kreuz, das
einem typischen Sonnenrad sehr nahe kommt, mit einer Ranke,
die im gleichzeitigen romanischen Ornament häufig erscheint.
Die übrigen Kirchen haben wuchtige, sparsam profilierte
Portale (Büd 18), ohne ornamentale Hinzufügung.
Die Mittelpfeiler waren im Innern wohl aller Kirchen bemalt
(Bild 9). Die Malereien sind auch teilweise sehr gut erhalten,
wenn auch restauriert. Wir versagen es uns, in diesem Zu-
sammenhang auf sie einzugehen, denn es handelt sich um
typische Kaikmaiereien romanischer Zeit provinziellen Charak-
ters. Für die Ausführung mag ein vom Festlande berufener
Maler in Frage gekommen sein, oder die Verwendung von
Musterbüchern, deren Gebrauch in diesen Zeiten ja viel üblicher
war, als man im allgemeinen annimmt.
Wir haben es also viel weniger mit einem Kirchenbau zu tun,
als mit einem Burgbau älterer primitiver Form. Um den Haupt-
bau schließt sich in unregelmäßiger Kreisform die Mauer, nicht
anders, wie bei den Burganlagen des frühen Mittelalters sich
um den Bergfried, den Donjon, den Wohnturm und letzten
Verteidigungspunkt sich Mauer oder Wall und Graben ziehen.
Heute ist diese alte Mauer natürlich Kirchhofmauer (Bild 4).
Nichts ist im Grunde logischer, als daß auf einem Boden, der
vorher Kultstätten kreisförmigen Grundrisses und Thingstätten
gleicher Grundform getragen haben muß, Gebilde ent-
standen, die vielleicht sogar alte Ringwälle benutzten, um
zeitentsprechende Gebäude zu schaffen, die all die genannten
Zwecke aufgriffen und in sich vereinten. Die neue Anlage
diente wieder dem Kult, dem Schutz der Bewohner und dem
Gericht, wahrscheinlich auch als Markt. All diese Zwecke sind
vorgesehen und erfüllt.
Wir haben in diesen Rundkirchen einen aus einheimischen
Ueberlieferungen entstandenen Zweckbau vor uns, handwerk-
lich einfach, bodenständig gewachsen, weithin sichtbar und
weithin sehend, wunderbar harmonisch in die Landschaft ein-
gepaßt. Alles in allem — echte Volkskunst, obwohl die fremde
Geistlichkeit der eigentliche Bauherr war. Zusammenhänge
werden sich, wie ich glaube, noch ergeben, wenn die zweite
Hälfte des ersten Jahrtausends besser durchforscht und die
Bauweise des Nordens uns klarer erfaßbar sein wird. Vielleicht
zeigt sich dann, daß auch die Reste kreisförmiger Bauanlagen
in Grönland, auf den Orkney-Inseln und an anderen Plätzen
des Nordens aus ähnlichen Bedürfnissen erwachsen und ähn-
lichen Charakters gewesen sind, wie die Rundkirchen Bornholms.
56