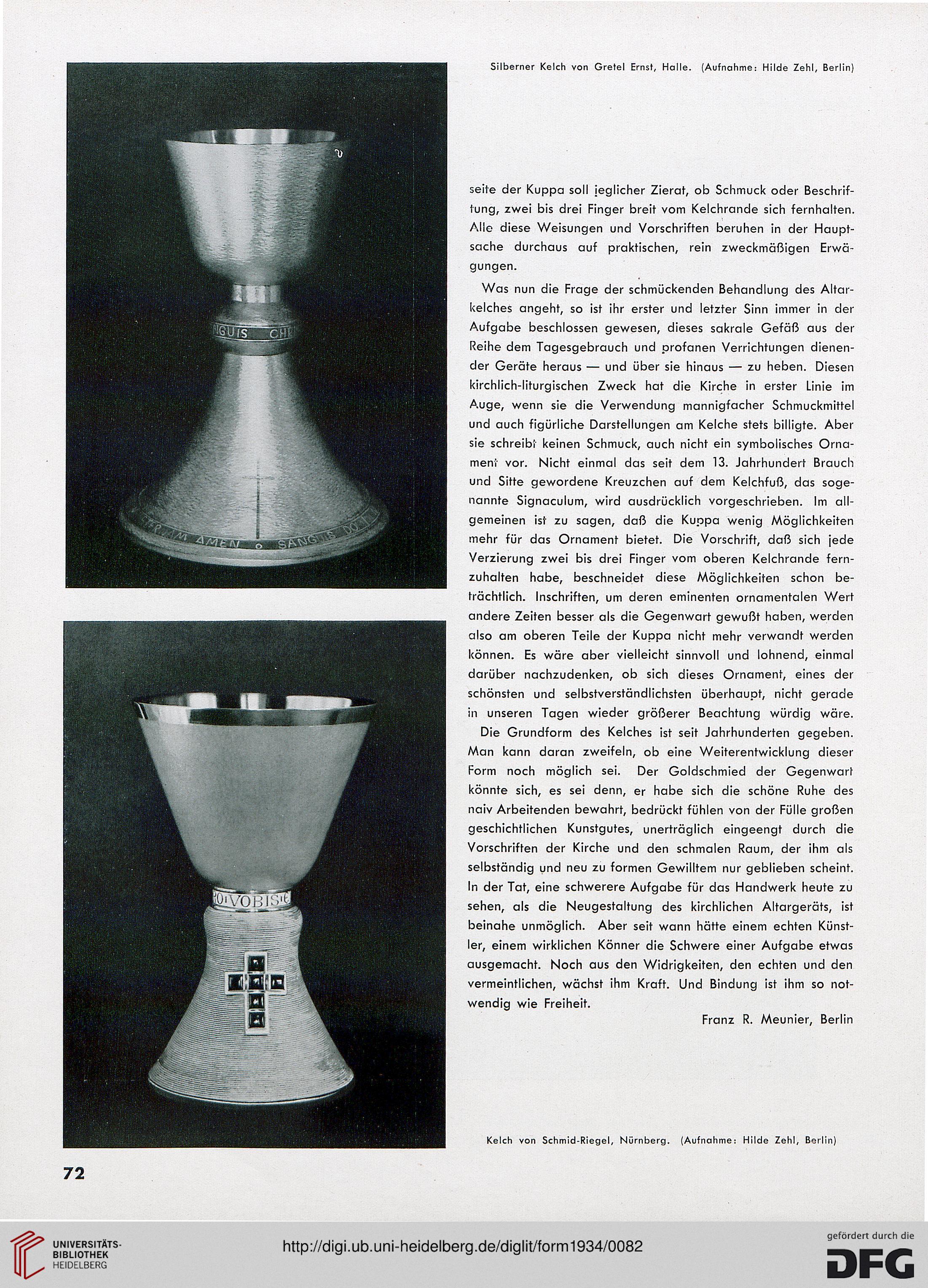Silberner Kelch von Gretel Ernst, Halle. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)
seite der Kuppa soll jeglicher Zierat, ob Schmuck oder Beschrif-
tung, zwei bis drei Finger breit vom Kelchrande sich fernhalten.
Alle diese Weisungen und Vorschriften beruhen in der Haupt-
sache durchaus auf praktischen, rein zweckmäßigen Erwä-
gungen.
Was nun die Frage der schmückenden Behandlung des Altar-
kelches angeht, so ist ihr erster und letzter Sinn immer in der
Aufgabe beschlossen gewesen, dieses sakrale Gefäß aus der
Reihe dem Tagesgebrauch und profanen Verrichtungen dienen-
der Geräte heraus — und über sie hinaus — zu heben. Diesen
kirchlich-liturgischen Zweck hat die Kirche in erster Linie im
Auge, wenn sie die Verwendung mannigfacher Schmuckmittel
und auch figürliche Darstellungen am Kelche stets billigte. Aber
sie schreib! keinen Schmuck, auch nicht ein symbolisches Orna-
ment vor. Nicht einmal das seit dem 13. Jahrhundert Brauch
und Sitte gewordene Kreuzchen auf dem Kelchfuß, das soge-
nannte Signaculum, wird ausdrücklich vorgeschrieben. Im all-
gemeinen ist zu sagen, daß die Kuppa wenig Möglichkeiten
mehr für das Ornament bietet. Die Vorschrift, daß sich jede
Verzierung zwei bis drei Finger vom oberen Kelchrande fern-
zuhalten habe, beschneidet diese Möglichkeiten schon be-
trächtlich. Inschriften, um deren eminenten ornamentalen Wert
andere Zeiten besser als die Gegenwart gewußt haben, werden
also am oberen Teile der Kuppa nicht mehr verwandt werden
können. Es wäre aber vielleicht sinnvoll und lohnend, einmal
darüber nachzudenken, ob sich dieses Ornament, eines der
schönsten und selbstverständlichsten überhaupt, nicht gerade
in unseren Tagen wieder größerer Beachtung würdig wäre.
Die Grundform des Kelches ist seit Jahrhunderten gegeben.
Man kann daran zweifeln, ob eine Weiterentwicklung dieser
Form noch möglich sei. Der Goldschmied der Gegenwart
könnte sich, es sei denn, er habe sich die schöne Ruhe des
naiv Arbeitenden bewahrt, bedrückt fühlen von der Fülle großen
geschichtlichen Kunstgutes, unerträglich eingeengt durch die
Vorschriften der Kirche und den schmalen Raum, der ihm als
selbständig und neu zu formen Gewilltem nur geblieben scheint.
In der Tat, eine schwerere Aufgabe für das Handwerk heute zu
sehen, als die Neugestaltung des kirchlichen Altargeräts, ist
beinahe unmöglich. Aber seit wann hätte einem echten Künst-
ler, einem wirklichen Könner die Schwere einer Aufgabe etwas
ausgemacht. Noch aus den Widrigkeiten, den echten und den
vermeintlichen, wächst ihm Kraft. Und Bindung ist ihm so not-
wendig wie Freiheit.
Franz R. Meunier, Berlin
Kelch von Schmid-Riegel, Nürnberg. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)
72
seite der Kuppa soll jeglicher Zierat, ob Schmuck oder Beschrif-
tung, zwei bis drei Finger breit vom Kelchrande sich fernhalten.
Alle diese Weisungen und Vorschriften beruhen in der Haupt-
sache durchaus auf praktischen, rein zweckmäßigen Erwä-
gungen.
Was nun die Frage der schmückenden Behandlung des Altar-
kelches angeht, so ist ihr erster und letzter Sinn immer in der
Aufgabe beschlossen gewesen, dieses sakrale Gefäß aus der
Reihe dem Tagesgebrauch und profanen Verrichtungen dienen-
der Geräte heraus — und über sie hinaus — zu heben. Diesen
kirchlich-liturgischen Zweck hat die Kirche in erster Linie im
Auge, wenn sie die Verwendung mannigfacher Schmuckmittel
und auch figürliche Darstellungen am Kelche stets billigte. Aber
sie schreib! keinen Schmuck, auch nicht ein symbolisches Orna-
ment vor. Nicht einmal das seit dem 13. Jahrhundert Brauch
und Sitte gewordene Kreuzchen auf dem Kelchfuß, das soge-
nannte Signaculum, wird ausdrücklich vorgeschrieben. Im all-
gemeinen ist zu sagen, daß die Kuppa wenig Möglichkeiten
mehr für das Ornament bietet. Die Vorschrift, daß sich jede
Verzierung zwei bis drei Finger vom oberen Kelchrande fern-
zuhalten habe, beschneidet diese Möglichkeiten schon be-
trächtlich. Inschriften, um deren eminenten ornamentalen Wert
andere Zeiten besser als die Gegenwart gewußt haben, werden
also am oberen Teile der Kuppa nicht mehr verwandt werden
können. Es wäre aber vielleicht sinnvoll und lohnend, einmal
darüber nachzudenken, ob sich dieses Ornament, eines der
schönsten und selbstverständlichsten überhaupt, nicht gerade
in unseren Tagen wieder größerer Beachtung würdig wäre.
Die Grundform des Kelches ist seit Jahrhunderten gegeben.
Man kann daran zweifeln, ob eine Weiterentwicklung dieser
Form noch möglich sei. Der Goldschmied der Gegenwart
könnte sich, es sei denn, er habe sich die schöne Ruhe des
naiv Arbeitenden bewahrt, bedrückt fühlen von der Fülle großen
geschichtlichen Kunstgutes, unerträglich eingeengt durch die
Vorschriften der Kirche und den schmalen Raum, der ihm als
selbständig und neu zu formen Gewilltem nur geblieben scheint.
In der Tat, eine schwerere Aufgabe für das Handwerk heute zu
sehen, als die Neugestaltung des kirchlichen Altargeräts, ist
beinahe unmöglich. Aber seit wann hätte einem echten Künst-
ler, einem wirklichen Könner die Schwere einer Aufgabe etwas
ausgemacht. Noch aus den Widrigkeiten, den echten und den
vermeintlichen, wächst ihm Kraft. Und Bindung ist ihm so not-
wendig wie Freiheit.
Franz R. Meunier, Berlin
Kelch von Schmid-Riegel, Nürnberg. (Aufnahme: Hilde Zehl, Berlin)
72