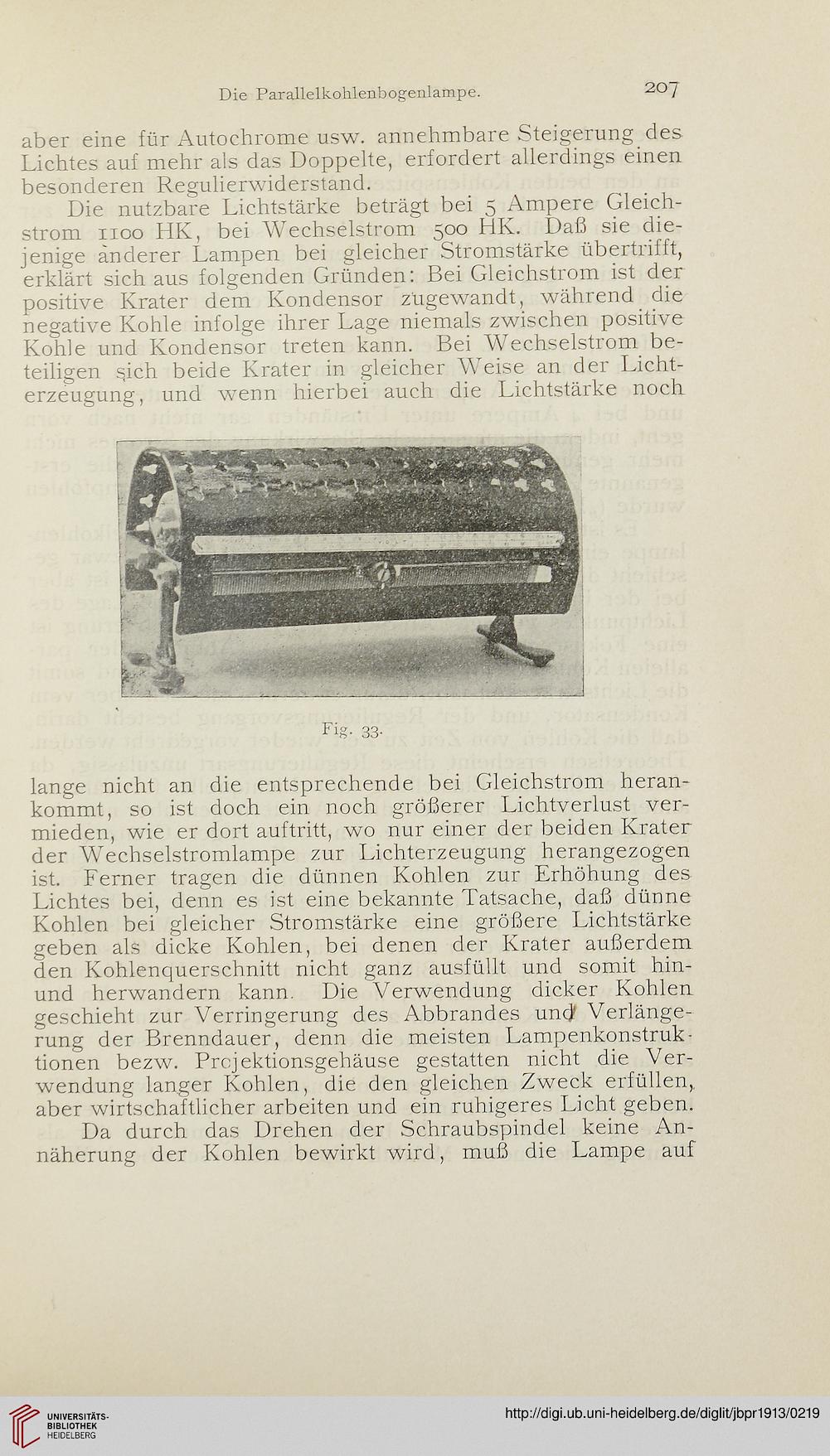Die Parallelkohlenbogenlampe.
207
aber eine für Autochrome usw. annehmbare Steigerung des
Lichtes auf mehr als das Doppelte, erfordert allerdings einen
besonderen Regulierwiderstand.
Die nutzbare Lichtstärke beträgt bei 5 Ampere Gleich-
strom 1100 HK, bei Wechselstrom 500 HK. Daß sie die-
jenige anderer Lampen bei gleicher Stromstärke übertrifft,
erklärt sich aus folgenden Gründen: Bei Gleichstrom ist der
positive Krater dem Kondensor zugewandt, während die
negative Kohle infolge ihrer Lage niemals zwischen positive
Kohle und Kondensor treten kann. Bei Wechselstrom be-
teiligen §ich beide Krater in gleicher Weise an der Licht-
erzeugung, und wenn hierbei auch die Lichtstärke noch
lange nicht an die entsprechende bei Gleichstrom heran-
kommt, so ist doch ein noch größerer Lichtverlust ver-
mieden, wie er dort auftritt, wo nur einer der beiden Krater
der Wechselstromlampe zur Lichterzeugung herangezogen
ist. Ferner tragen die dünnen Kohlen zur Erhöhung des
Lichtes bei, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß dünne
Kohlen bei gleicher Stromstärke eine größere Lichtstärke
geben als dicke Kohlen, bei denen der Krater außerdem
den Kohlenquerschnitt nicht ganz ausfüllt und somit hin-
und herwandern kann. Die Verwendung dicker Kohlen
geschieht zur Verringerung des Abbrandes und Verlänge-
rung der Brenndauer, denn die meisten Lampenkonstruk-
tionen bezw. Prcjektionsgehäuse gestatten nicht die Ver-
wendung langer Kohlen, die den gleichen Zweck erfüllen,,
aber wirtschaftlicher arbeiten und ein ruhigeres Licht geben.
Da durch das Drehen der Schraubspindel keine An-
näherung der Kohlen bewirkt wird, muß die Lampe auf
207
aber eine für Autochrome usw. annehmbare Steigerung des
Lichtes auf mehr als das Doppelte, erfordert allerdings einen
besonderen Regulierwiderstand.
Die nutzbare Lichtstärke beträgt bei 5 Ampere Gleich-
strom 1100 HK, bei Wechselstrom 500 HK. Daß sie die-
jenige anderer Lampen bei gleicher Stromstärke übertrifft,
erklärt sich aus folgenden Gründen: Bei Gleichstrom ist der
positive Krater dem Kondensor zugewandt, während die
negative Kohle infolge ihrer Lage niemals zwischen positive
Kohle und Kondensor treten kann. Bei Wechselstrom be-
teiligen §ich beide Krater in gleicher Weise an der Licht-
erzeugung, und wenn hierbei auch die Lichtstärke noch
lange nicht an die entsprechende bei Gleichstrom heran-
kommt, so ist doch ein noch größerer Lichtverlust ver-
mieden, wie er dort auftritt, wo nur einer der beiden Krater
der Wechselstromlampe zur Lichterzeugung herangezogen
ist. Ferner tragen die dünnen Kohlen zur Erhöhung des
Lichtes bei, denn es ist eine bekannte Tatsache, daß dünne
Kohlen bei gleicher Stromstärke eine größere Lichtstärke
geben als dicke Kohlen, bei denen der Krater außerdem
den Kohlenquerschnitt nicht ganz ausfüllt und somit hin-
und herwandern kann. Die Verwendung dicker Kohlen
geschieht zur Verringerung des Abbrandes und Verlänge-
rung der Brenndauer, denn die meisten Lampenkonstruk-
tionen bezw. Prcjektionsgehäuse gestatten nicht die Ver-
wendung langer Kohlen, die den gleichen Zweck erfüllen,,
aber wirtschaftlicher arbeiten und ein ruhigeres Licht geben.
Da durch das Drehen der Schraubspindel keine An-
näherung der Kohlen bewirkt wird, muß die Lampe auf