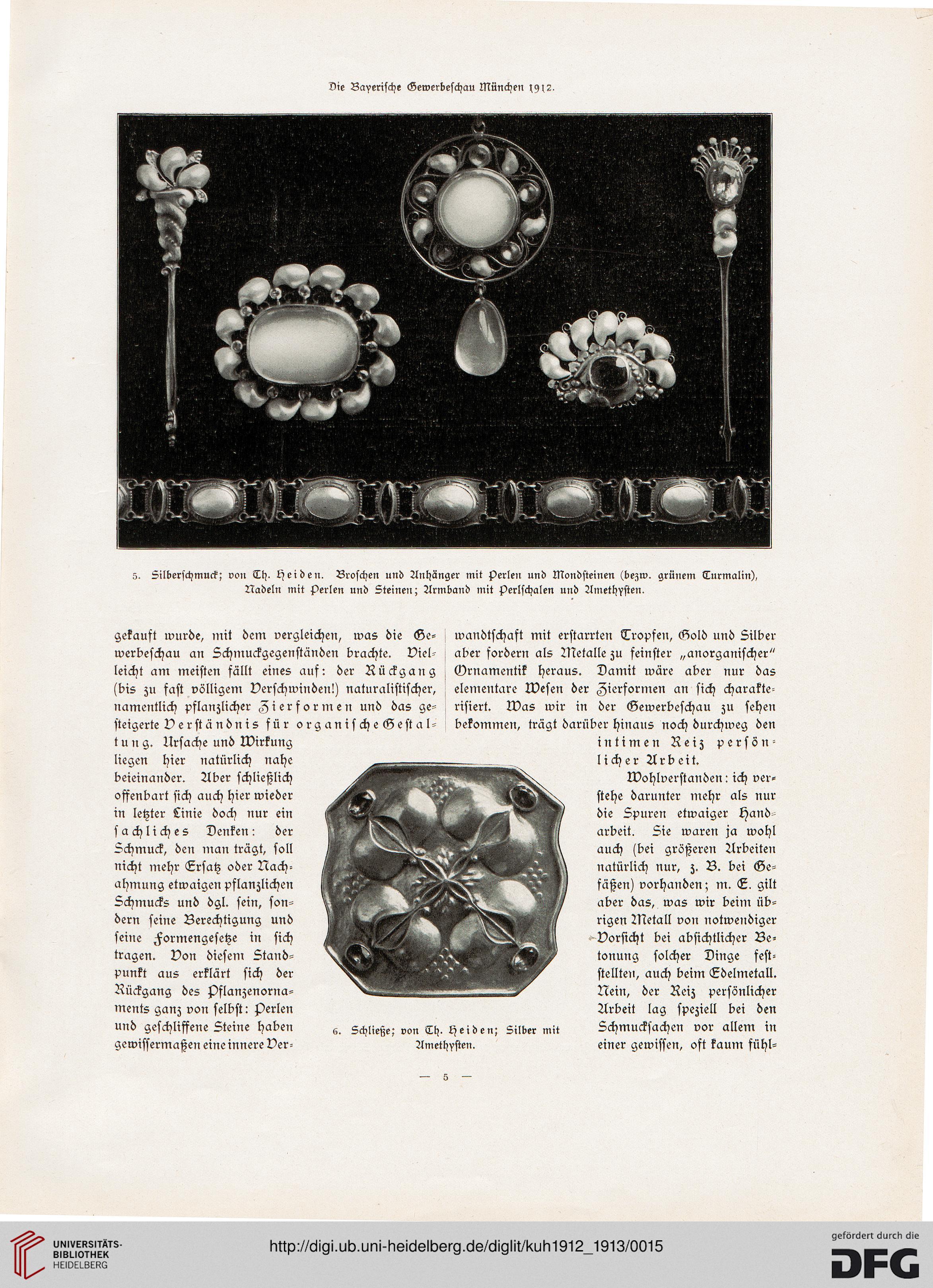Die Bayerische Gewerbeschau München {°i{2.
5. Silberschmuck; von Ctj. Heiden. Broschen und Anhänger mit perlen und Mondsteinen (bezw. grünem Turmalin),
Nadeln mit Perlen und Steinen; Armband mit Perlschalen und Amethysten.
gekauft wurde, mit dem vergleichen, was die Ge-
werbeschau au Schmuckgegenständen brachte, viel-
leicht am meisten fällt eines auf: der Rückgang
(bis zu fast völligem verschwinden!) naturalistischer,
namentlich pflanzlicher Zierformen und das ge-
steigerte Verständnis für organifcheGestal-
tu ng. Ursache und Wirkung
liegen hier natürlich nahe
beieinander. Aber schließlich
offenbart sich auch hier wieder
in letzter Linie doch nur ein
sachliches Denken: der
Schmuck, den man trägt, soll
nicht mehr Ersatz oder Nach-
ahmung etwaigen pflanzlichen
Schmucks uud dgl. sein, son-
dern seine Berechtigung und
seine Formengesetze in sich
tragen. Von diesen: Stand-
punkt aus erklärt sich der
Rückgang des pflanzenorna-
tnents ganz von selbst: Perlen
und geschliffene Steine haben
gewissermaßen eine innere Ver-
wandtschaft mit erstarrten Tropfen, Gold und Silber
aber fordern als Metalle zu feinster „anorganischer"
Ornamentik heraus. Damit wäre aber nur das
elementare Wesen der Zierformen an sich charakte-
risiert. Was wir in der Gewerbeschau zu sehen
bekommen, trägt darüber hinaus noch durchweg den
intimen Reiz persön-
licher Arbeit.
Wohlverstanden: ich ver-
stehe darunter mehr als nur
die Spuren etwaiger Hand
arbeit. Sie waren ja wohl
auch (bei größeren Arbeiten
natürlich nur, z. B. bei Ge-
fäßen) vorhanden; m. E. gilt
aber das, was wir beim üb-
rigen Metall von notwendiger
- Vorsicht bei absichtlicher Be-
tonung solcher Dinge fest-
stellte», auch beim Edelmetall.
Nein, der Reiz persönlicher
Arbeit lag speziell bei den
Schmucksachen vor allem in
einer gewissen, oft kaum fühl-
5. Silberschmuck; von Ctj. Heiden. Broschen und Anhänger mit perlen und Mondsteinen (bezw. grünem Turmalin),
Nadeln mit Perlen und Steinen; Armband mit Perlschalen und Amethysten.
gekauft wurde, mit dem vergleichen, was die Ge-
werbeschau au Schmuckgegenständen brachte, viel-
leicht am meisten fällt eines auf: der Rückgang
(bis zu fast völligem verschwinden!) naturalistischer,
namentlich pflanzlicher Zierformen und das ge-
steigerte Verständnis für organifcheGestal-
tu ng. Ursache und Wirkung
liegen hier natürlich nahe
beieinander. Aber schließlich
offenbart sich auch hier wieder
in letzter Linie doch nur ein
sachliches Denken: der
Schmuck, den man trägt, soll
nicht mehr Ersatz oder Nach-
ahmung etwaigen pflanzlichen
Schmucks uud dgl. sein, son-
dern seine Berechtigung und
seine Formengesetze in sich
tragen. Von diesen: Stand-
punkt aus erklärt sich der
Rückgang des pflanzenorna-
tnents ganz von selbst: Perlen
und geschliffene Steine haben
gewissermaßen eine innere Ver-
wandtschaft mit erstarrten Tropfen, Gold und Silber
aber fordern als Metalle zu feinster „anorganischer"
Ornamentik heraus. Damit wäre aber nur das
elementare Wesen der Zierformen an sich charakte-
risiert. Was wir in der Gewerbeschau zu sehen
bekommen, trägt darüber hinaus noch durchweg den
intimen Reiz persön-
licher Arbeit.
Wohlverstanden: ich ver-
stehe darunter mehr als nur
die Spuren etwaiger Hand
arbeit. Sie waren ja wohl
auch (bei größeren Arbeiten
natürlich nur, z. B. bei Ge-
fäßen) vorhanden; m. E. gilt
aber das, was wir beim üb-
rigen Metall von notwendiger
- Vorsicht bei absichtlicher Be-
tonung solcher Dinge fest-
stellte», auch beim Edelmetall.
Nein, der Reiz persönlicher
Arbeit lag speziell bei den
Schmucksachen vor allem in
einer gewissen, oft kaum fühl-