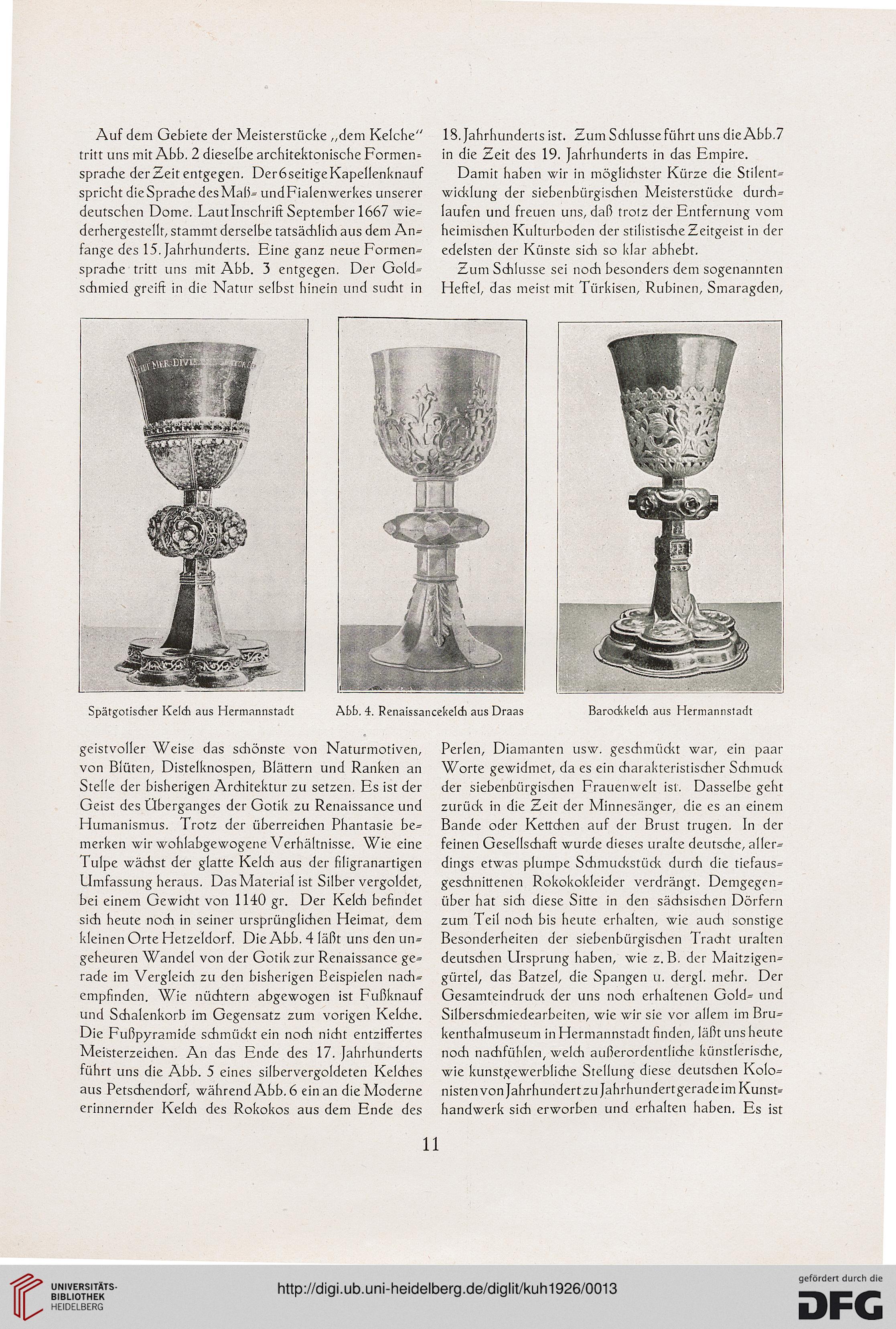Auf dem Gebiete der Meisterstücke „dem Kelche"
tritt uns mit Abb. 2 dieselbe architektonische Formen»
Sprache derZeit entgegen. DeröseitigeKapellenknauf
spricht dieSprache des Maß» undFialenwerkes unserer
deutschen Dome. Lautlnschrift September 1667 wie»
derhergestellt, stammt derselbe tatsächlich aus dem An»
fange des 15. Jahrhunderts. Eine ganz neue Formen»
spräche tritt uns mit Abb. 3 entgegen. Der Gold»
schmied greift in die Natur selbst hinein und sucht in
18. Jahrhunderts ist. Zum Schlüsse führt uns die Abb.7
in die Zeit des 19. Jahrhunderts in das Empire.
Damit haben wir in möglichster Kürze die Stilent-
wicklung der siebenbürgischen Meisterstücke durch»
laufen und freuen uns, daß trotz der Entfernung vom
heimischen Kulturboden der stilistische Zeitgeist in der
edelsten der Künste sich so klar abhebt.
Zum Schlüsse sei noch besonders dem sogenannten
Heftel, das meist mit Türkisen, Rubinen, Smaragden,
Spätgotischer Keldi aus Hermannstadt
Abb. 4. Renaissancekelch, aus Draas
Barockkelch aus Hermannstadt
geistvoller Weise das schönste von Naturmotiven,
von Blüten, Distelknospen, Blättern und Ranken an
Stelle der bisherigen Architektur zu setzen. Es ist der
Geist des Überganges der Gotik zu Renaissance und
Humanismus. Trotz der überreichen Phantasie be»
merken wir wohlabgewogene Verhältnisse. Wie eine
Tulpe wächst der glatte Kelch aus der filigranartigen
Umfassung heraus. Das Material ist Silber vergoldet,
bei einem Gewicht von 1140 gr. Der Kelch befindet
sich heute noch in seiner ursprünglichen Heimat, dem
kleinen Orte Hetzeldorf. Die Abb. 4 läßt uns den un»
geheuren Wandel von der Gotik zur Renaissance ge-
rade im Vergleich zu den bisherigen Beispielen nach»
empfinden. Wie nüchtern abgewogen ist Fußknauf
und Schalenkorb im Gegensatz zum vorigen Kelche.
Die Fußpyramide schmüdct ein noch nicht entziffertes
Meisterzeichen. An das Ende des 17. Jahrhunderts
führt uns die Abb. 5 eines silbervergoldeten Kelches
aus Petschendorf, während Abb. 6 ein an die Moderne
erinnernder Kelch des Rokokos aus dem Ende des
Perlen, Diamanten usw. geschmückt war, ein paar
Worte gewidmet, da es ein charakteristischer Schmudc
der siebenbürgischen Frauenwelt ist. Dasselbe geht
zurück in die Zeit der Minnesänger, die es an einem
Bande oder Kettchen auf der Brust trugen. In der
feinen Gesellschaft wurde dieses uralte deutsche, aller»
dings etwas plumpe Schmuckstüdc durch die tiefaus»
geschnittenen Rokokokleider verdrängt. Demgegen»
über hat sich diese Sitte in den sächsischen Dörfern
zum Teil noch bis heute erhalten, wie auch sonstige
Besonderheiten der siebenbürgischen Tracht uralten
deutschen Ursprung haben, wie z. B. der Maitzigen»
gürtel, das Batzel, die Spangen u. dergl. mehr. Der
Gesamteindrude der uns noch erhaltenen Gold» und
Silberschmiedearbeiten, wie wir sie vor allem im Bru»
kenthalmuseum in Hermannstadt finden, läßt uns heute
noch nachfühlen, welch außerordentliche künstlerische,
wie kunstgewerbliche Stellung diese deutschen Kolo»
nisten von Jahrhundertzu Jahrhundertgerade im Kunst»
handwerk sich erworben und erhalten haben. Es ist
11
tritt uns mit Abb. 2 dieselbe architektonische Formen»
Sprache derZeit entgegen. DeröseitigeKapellenknauf
spricht dieSprache des Maß» undFialenwerkes unserer
deutschen Dome. Lautlnschrift September 1667 wie»
derhergestellt, stammt derselbe tatsächlich aus dem An»
fange des 15. Jahrhunderts. Eine ganz neue Formen»
spräche tritt uns mit Abb. 3 entgegen. Der Gold»
schmied greift in die Natur selbst hinein und sucht in
18. Jahrhunderts ist. Zum Schlüsse führt uns die Abb.7
in die Zeit des 19. Jahrhunderts in das Empire.
Damit haben wir in möglichster Kürze die Stilent-
wicklung der siebenbürgischen Meisterstücke durch»
laufen und freuen uns, daß trotz der Entfernung vom
heimischen Kulturboden der stilistische Zeitgeist in der
edelsten der Künste sich so klar abhebt.
Zum Schlüsse sei noch besonders dem sogenannten
Heftel, das meist mit Türkisen, Rubinen, Smaragden,
Spätgotischer Keldi aus Hermannstadt
Abb. 4. Renaissancekelch, aus Draas
Barockkelch aus Hermannstadt
geistvoller Weise das schönste von Naturmotiven,
von Blüten, Distelknospen, Blättern und Ranken an
Stelle der bisherigen Architektur zu setzen. Es ist der
Geist des Überganges der Gotik zu Renaissance und
Humanismus. Trotz der überreichen Phantasie be»
merken wir wohlabgewogene Verhältnisse. Wie eine
Tulpe wächst der glatte Kelch aus der filigranartigen
Umfassung heraus. Das Material ist Silber vergoldet,
bei einem Gewicht von 1140 gr. Der Kelch befindet
sich heute noch in seiner ursprünglichen Heimat, dem
kleinen Orte Hetzeldorf. Die Abb. 4 läßt uns den un»
geheuren Wandel von der Gotik zur Renaissance ge-
rade im Vergleich zu den bisherigen Beispielen nach»
empfinden. Wie nüchtern abgewogen ist Fußknauf
und Schalenkorb im Gegensatz zum vorigen Kelche.
Die Fußpyramide schmüdct ein noch nicht entziffertes
Meisterzeichen. An das Ende des 17. Jahrhunderts
führt uns die Abb. 5 eines silbervergoldeten Kelches
aus Petschendorf, während Abb. 6 ein an die Moderne
erinnernder Kelch des Rokokos aus dem Ende des
Perlen, Diamanten usw. geschmückt war, ein paar
Worte gewidmet, da es ein charakteristischer Schmudc
der siebenbürgischen Frauenwelt ist. Dasselbe geht
zurück in die Zeit der Minnesänger, die es an einem
Bande oder Kettchen auf der Brust trugen. In der
feinen Gesellschaft wurde dieses uralte deutsche, aller»
dings etwas plumpe Schmuckstüdc durch die tiefaus»
geschnittenen Rokokokleider verdrängt. Demgegen»
über hat sich diese Sitte in den sächsischen Dörfern
zum Teil noch bis heute erhalten, wie auch sonstige
Besonderheiten der siebenbürgischen Tracht uralten
deutschen Ursprung haben, wie z. B. der Maitzigen»
gürtel, das Batzel, die Spangen u. dergl. mehr. Der
Gesamteindrude der uns noch erhaltenen Gold» und
Silberschmiedearbeiten, wie wir sie vor allem im Bru»
kenthalmuseum in Hermannstadt finden, läßt uns heute
noch nachfühlen, welch außerordentliche künstlerische,
wie kunstgewerbliche Stellung diese deutschen Kolo»
nisten von Jahrhundertzu Jahrhundertgerade im Kunst»
handwerk sich erworben und erhalten haben. Es ist
11