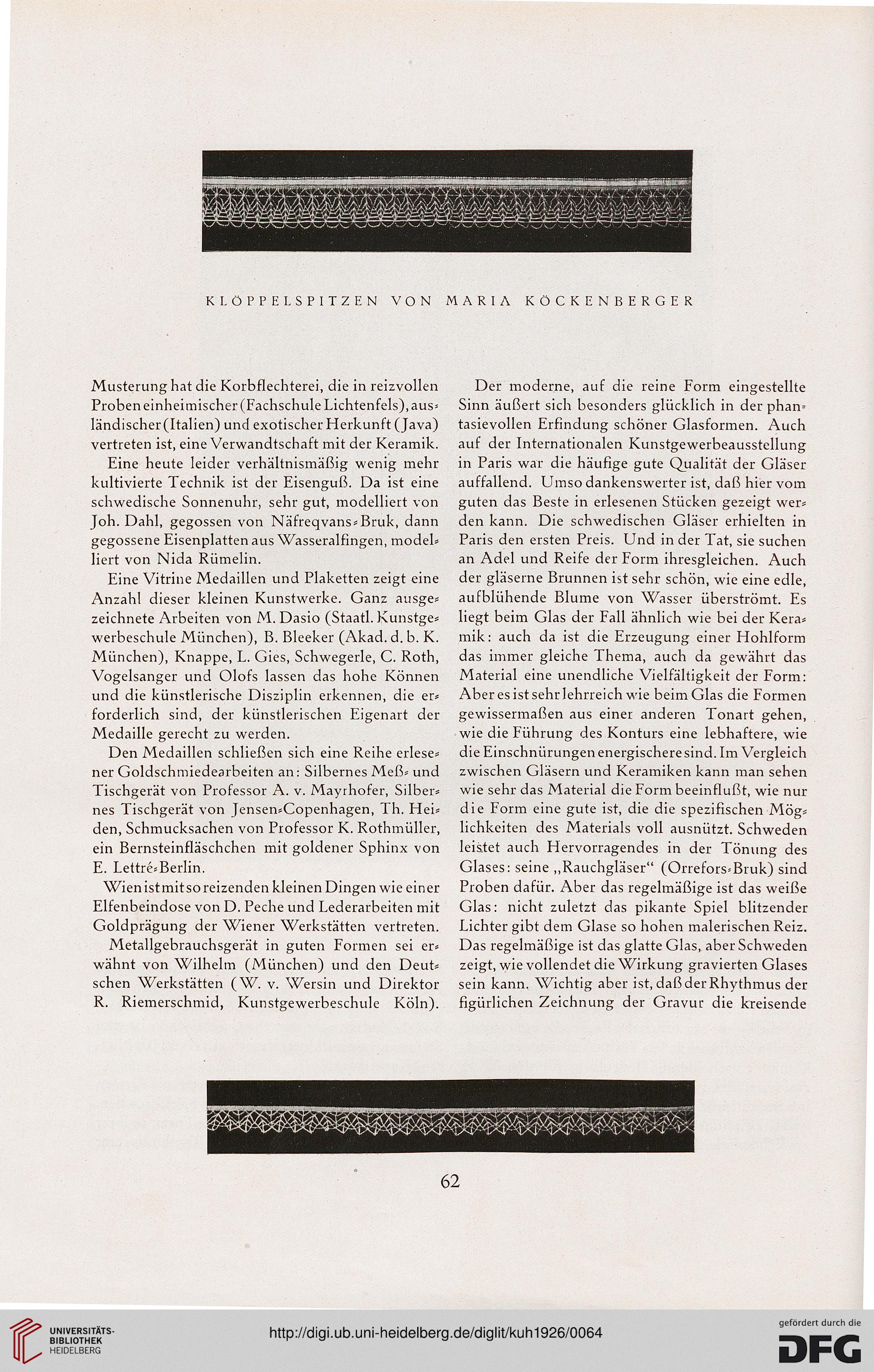KLÖPPELSPITZEN VON MARIA KÖCKENBERGER
Musterung hat die Korbflechterei, die in reizvollen
Proben einheimischer (Fachschule Lichtenfels), aus*
ländischer(Italien) und exotischer Herkunft (Java)
vertreten ist, eine Verwandtschaft mit der Keramik.
Eine heute leider verhältnismäßig wenig mehr
kultivierte Technik ist der Eisenguß. Da ist eine
schwedische Sonnenuhr, sehr gut, modelliert von
Joh. Dahl, gegossen von Näfreqvans*Bruk, dann
gegossene Eisenplatten aus Wasseralfingen, model*
liert von Nida Rümelin.
Eine Vitrine Medaillen und Plaketten zeigt eine
Anzahl dieser kleinen Kunstwerke. Ganz ausge*
zeichnete Arbeiten von M. Dasio (Staatl. Kunstge*
werbeschule München), B. Bleeker (Akad. d. b. K.
München), Knappe, L. Gies, Schwegerle, C. Roth,
Vogelsanger und Olofs lassen das hohe Können
und die künstlerische Disziplin erkennen, die er»
forderlich sind, der künstlerischen Eigenart der
Medaille gerecht zu werden.
Den Medaillen schließen sich eine Reihe erlese*
ner Goldschmiedearbeiten an: Silbernes Meß* und
Tischgerät von Professor A. v. Mayrhofer, Silber*
nes Tischgerät von Jensen*Copenhagen, Th. Hei*
den, Schmucksachen von Professor K. Rothmüller,
ein Bernsteinfläschchen mit goldener Sphinx von
E. Lettre*Berlin.
Wien ist mit so reizenden kleinen Dingen wie einer
Elfenbeindose von D. Peche und Lederarbeiten mit
Goldprägung der Wiener Werkstätten vertreten.
Metallgebrauchsgerät in guten Formen sei er*
wähnt von Wilhelm (München) und den Deut*
sehen Werkstätten (W. v. Wersin und Direktor
R. Riemerschmid, Kunstgewerbeschule Köln).
Der moderne, auf die reine Form eingestellte
Sinn äußert sich besonders glücklich in der phan-
tasievollen Erfindung schöner Glasformen. Auch
auf der Internationalen Kunstgewerbeausstellung
in Paris war die häufige gute Qualität der Gläser
auffallend. Umso dankenswerter ist, daß hier vom
guten das Beste in erlesenen Stücken gezeigt wer*
den kann. Die schwedischen Gläser erhielten in
Paris den ersten Preis. Und in der Tat, sie suchen
an Adel und Reife der Form ihresgleichen. Auch
der gläserne Brunnen ist sehr schön, wie eine edle,
aufblühende Blume von Wasser überströmt. Es
liegt beim Glas der Fall ähnlich wie bei der Kera*
mik: auch da ist die Erzeugung einer Hohlform
das immer gleiche Thema, auch da gewährt das
Material eine unendliche Vielfältigkeit der Form:
Aberes ist sehrlehrreich wie beim Glas die Formen
gewissermaßen aus einer anderen Tonart gehen,
wie die Führung des Konturs eine lebhaftere, wie
die Einschnürungenenergischeresind. Im Vergleich
zwischen Gläsern und Keramiken kann man sehen
wie sehr das Material die Form beeinflußt, wie nur
die Form eine gute ist, die die spezifischen Mög*
lichkeiten des Materials voll ausnützt. Schweden
leistet auch Hervorragendes in der Tönung des
Glases: seine „Rauchgläser" (Orrefors<Bruk) sind
Proben dafür. Aber das regelmäßige ist das weiße
Glas: nicht zuletzt das pikante Spiel blitzender
Lichter gibt dem Glase so hohen malerischen Reiz.
Das regelmäßige ist das glatte Glas, aber Schweden
zeigt, wie vollendet die Wirkung gravierten Glases
sein kann. Wichtig aber ist, daß der Rhythmus der
figürlichen Zeichnung der Gravur die kreisende
62
Musterung hat die Korbflechterei, die in reizvollen
Proben einheimischer (Fachschule Lichtenfels), aus*
ländischer(Italien) und exotischer Herkunft (Java)
vertreten ist, eine Verwandtschaft mit der Keramik.
Eine heute leider verhältnismäßig wenig mehr
kultivierte Technik ist der Eisenguß. Da ist eine
schwedische Sonnenuhr, sehr gut, modelliert von
Joh. Dahl, gegossen von Näfreqvans*Bruk, dann
gegossene Eisenplatten aus Wasseralfingen, model*
liert von Nida Rümelin.
Eine Vitrine Medaillen und Plaketten zeigt eine
Anzahl dieser kleinen Kunstwerke. Ganz ausge*
zeichnete Arbeiten von M. Dasio (Staatl. Kunstge*
werbeschule München), B. Bleeker (Akad. d. b. K.
München), Knappe, L. Gies, Schwegerle, C. Roth,
Vogelsanger und Olofs lassen das hohe Können
und die künstlerische Disziplin erkennen, die er»
forderlich sind, der künstlerischen Eigenart der
Medaille gerecht zu werden.
Den Medaillen schließen sich eine Reihe erlese*
ner Goldschmiedearbeiten an: Silbernes Meß* und
Tischgerät von Professor A. v. Mayrhofer, Silber*
nes Tischgerät von Jensen*Copenhagen, Th. Hei*
den, Schmucksachen von Professor K. Rothmüller,
ein Bernsteinfläschchen mit goldener Sphinx von
E. Lettre*Berlin.
Wien ist mit so reizenden kleinen Dingen wie einer
Elfenbeindose von D. Peche und Lederarbeiten mit
Goldprägung der Wiener Werkstätten vertreten.
Metallgebrauchsgerät in guten Formen sei er*
wähnt von Wilhelm (München) und den Deut*
sehen Werkstätten (W. v. Wersin und Direktor
R. Riemerschmid, Kunstgewerbeschule Köln).
Der moderne, auf die reine Form eingestellte
Sinn äußert sich besonders glücklich in der phan-
tasievollen Erfindung schöner Glasformen. Auch
auf der Internationalen Kunstgewerbeausstellung
in Paris war die häufige gute Qualität der Gläser
auffallend. Umso dankenswerter ist, daß hier vom
guten das Beste in erlesenen Stücken gezeigt wer*
den kann. Die schwedischen Gläser erhielten in
Paris den ersten Preis. Und in der Tat, sie suchen
an Adel und Reife der Form ihresgleichen. Auch
der gläserne Brunnen ist sehr schön, wie eine edle,
aufblühende Blume von Wasser überströmt. Es
liegt beim Glas der Fall ähnlich wie bei der Kera*
mik: auch da ist die Erzeugung einer Hohlform
das immer gleiche Thema, auch da gewährt das
Material eine unendliche Vielfältigkeit der Form:
Aberes ist sehrlehrreich wie beim Glas die Formen
gewissermaßen aus einer anderen Tonart gehen,
wie die Führung des Konturs eine lebhaftere, wie
die Einschnürungenenergischeresind. Im Vergleich
zwischen Gläsern und Keramiken kann man sehen
wie sehr das Material die Form beeinflußt, wie nur
die Form eine gute ist, die die spezifischen Mög*
lichkeiten des Materials voll ausnützt. Schweden
leistet auch Hervorragendes in der Tönung des
Glases: seine „Rauchgläser" (Orrefors<Bruk) sind
Proben dafür. Aber das regelmäßige ist das weiße
Glas: nicht zuletzt das pikante Spiel blitzender
Lichter gibt dem Glase so hohen malerischen Reiz.
Das regelmäßige ist das glatte Glas, aber Schweden
zeigt, wie vollendet die Wirkung gravierten Glases
sein kann. Wichtig aber ist, daß der Rhythmus der
figürlichen Zeichnung der Gravur die kreisende
62