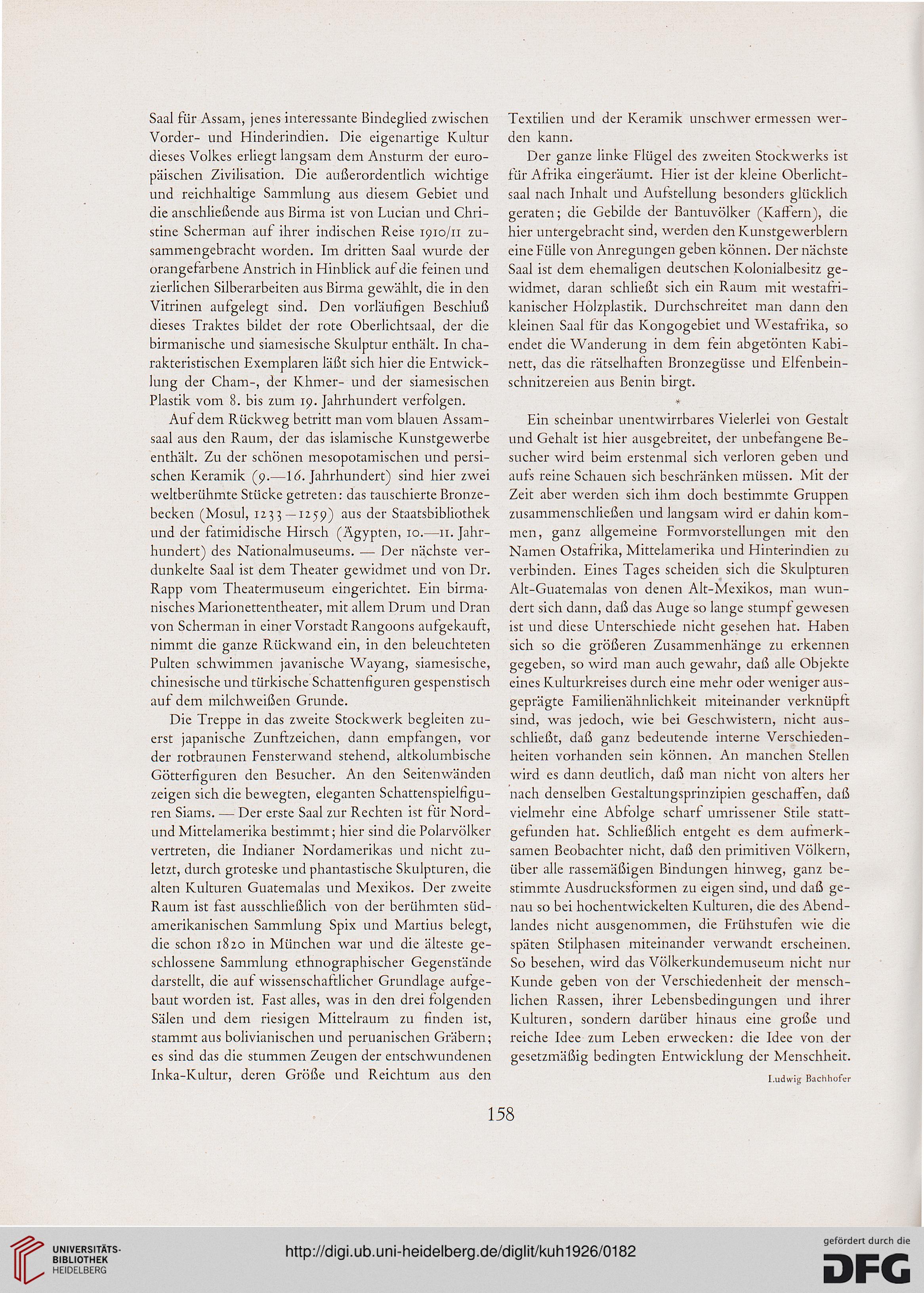Saal für Assam, jenes interessante Bindeglied zwischen
Vorder- und Hinderindien. Die eigenartige Kultur
dieses Volkes erliegt langsam dem Ansturm der euro-
päischen Zivilisation. Die außerordentlich wichtige
und reichhaltige Sammlung aus diesem Gebiet und
die anschließende aus Birma ist von Lucian und Chri-
stine Scherman auf ihrer indischen Reise 1910/11 zu-
sammengebracht worden. Im dritten Saal wurde der
orangefarbene Anstrich in Hinblick auf die feinen und
zierlichen Silberarbeiten aus Birma gewählt, die in den
Vitrinen aufgelegt sind. Den vorläufigen Beschluß
dieses Traktes bildet der rote Oberlichtsaal, der die
birmanische und siamesische Skulptur enthält. In cha-
rakteristischen Exemplaren läßt sich hier die Entwick-
lung der Cham-, der Khmer- und der siamesischen
Plastik vom 8. bis zum 19. Jahrhundert verfolgen.
Auf dem Rückweg betritt man vom blauen Assam-
saal aus den Raum, der das islamische Kunstgewerbe
enthält. Zu der schönen mesopotamischen und persi-
schen Keramik (9.—16. Jahrhundert) sind hier zwei
weltberühmte Stücke getreten: das tauschierte Bronze-
becken (Mosul, 1233 —1250) aus der Staatsbibliothek
und der fatimidische Hirsch (Ägypten, 10.—n. Jahr-
hundert) des Nationalmuseums. — Der nächste ver-
dunkelte Saal ist dem Theater gewidmet und von Dr.
Rapp vom Theatermuseum eingerichtet. Ein birma-
nisches Marionettentheater, mit allem Drum und Dran
von Scherman in einer Vorstadt Rangoons aufgekauft,
nimmt die ganze Rückwand ein, in den beleuchteten
Pulten schwimmen javanische Wayang, siamesische,
chinesische und türkische Schattenfiguren gespenstisch
auf dem milchweißen Grunde.
Die Treppe in das zweite Stockwerk begleiten zu-
erst japanische Zunftzeichen, dann empfangen, vor
der rotbraunen Fensterwand stehend, altkolumbische
Götterfiguren den Besucher. An den Seitenwänden
zeigen sich die bewegten, eleganten Schattenspielfigu-
ren Siams. — Der erste Saal zur Rechten ist für Nord-
und Mittelamerika bestimmt; hier sind die Polarvölker
vertreten, die Indianer Nordamerikas und nicht zu-
letzt, durch groteske und phantastische Skulpturen, die
alten Kulturen Guatemalas und Mexikos. Der zweite
Raum ist fast ausschließlich von der berühmten süd-
amerikanischen Sammlung Spix und Martius belegt,
die schon 1820 in München war und die älteste ge-
schlossene Sammlung ethnographischer Gegenstände
darstellt, die auf wissenschaftlicher Grundlage aufge-
baut worden ist. Fast alles, was in den drei folgenden
Sälen und dem riesigen Mittelraum zu finden ist,
stammt aus bolivianischen und peruanischen Gräbern;
es sind das die stummen Zeugen der entschwundenen
Inka-Kultur, deren Größe und Reichtum aus den
Textilien und der Keramik unschwer ermessen wer-
den kann.
Der ganze linke Flügel des zweiten Stockwerks ist
für Afrika eingeräumt. Hier ist der kleine Oberlicht-
saal nach Inhalt und Aufstellung besonders glücklich
geraten; die Gebilde der Bantuvölker (Kaffern), die
hier untergebracht sind, werden den Kunstgewerblern
eine Fülle von Anregungen geben können. Der nächste
Saal ist dem ehemaligen deutschen Kolonialbesitz ge-
widmet, daran schließt sich ein Raum mit westaffi-
kanischer Holzplastik. Durchschreitet man dann den
kleinen Saal für das Kongogebiet und Westafrika, so
endet die Wanderung in dem fein abgetönten Kabi-
nett, das die rätselhaften Bronzegüsse und Elfenbein-
schnitzereien aus Benin birgt.
Ein scheinbar unentwirrbares Vielerlei von Gestalt
und Gehalt ist hier ausgebreitet, der unbefangene Be-
sucher wird beim erstenmal sich verloren geben und
aufs reine Schauen sich beschränken müssen. Mit der
Zeit aber werden sich ihm doch bestimmte Gruppen
zusammenschließen und langsam wird er dahin kom-
men, ganz allgemeine Formvorstellungen mit den
Namen Ostafrika, Mittelamerika und Hinterindien zu
verbinden. Eines Tages scheiden sich die Skulpturen
Alt-Guatemalas von denen Alt-Mexikos, man wun-
dert sich dann, daß das Auge so lange stumpf gewesen
ist und diese Unterschiede nicht gesehen hat. Haben
sich so die größeren Zusammenhänge zu erkennen
gegeben, so wird man auch gewahr, daß alle Objekte
eines Kulturkreises durch eine mehr oder weniger aus-
geprägte Familienähnlichkeit miteinander verknüpft
sind, was jedoch, wie bei Geschwistern, nicht aus-
schließt, daß ganz bedeutende interne Verschieden-
heiten vorhanden sein können. An manchen Stellen
wird es dann deutlich, daß man nicht von alters her
nach denselben Gestaltungsprinzipien geschaffen, daß
vielmehr eine Abfolge scharf umrissener Stile statt-
gefunden hat. Schließlich entgeht es dem aufmerk-
samen Beobachter nicht, daß den primitiven Völkern,
über alle rassemäßigen Bindungen hinweg, ganz be-
stimmte Ausdrucksformen zu eigen sind, und daß ge-
nau so bei hochentwickelten Kulturen, die des Abend-
landes nicht ausgenommen, die Frühstufen wie die
späten Stilphasen miteinander verwandt erscheinen.
So besehen, wird das Völkerkundemuseum nicht nur
Kunde geben von der Verschiedenheit der mensch-
lichen Rassen, ihrer Lebensbedingungen und ihrer
Kulturen, sondern darüber hinaus eine große und
reiche Idee zum Leben erwecken: die Idee von der
gesetzmäßig bedingten Entwicklung der Menschheit.
Ludwig Bachhofer
158
Vorder- und Hinderindien. Die eigenartige Kultur
dieses Volkes erliegt langsam dem Ansturm der euro-
päischen Zivilisation. Die außerordentlich wichtige
und reichhaltige Sammlung aus diesem Gebiet und
die anschließende aus Birma ist von Lucian und Chri-
stine Scherman auf ihrer indischen Reise 1910/11 zu-
sammengebracht worden. Im dritten Saal wurde der
orangefarbene Anstrich in Hinblick auf die feinen und
zierlichen Silberarbeiten aus Birma gewählt, die in den
Vitrinen aufgelegt sind. Den vorläufigen Beschluß
dieses Traktes bildet der rote Oberlichtsaal, der die
birmanische und siamesische Skulptur enthält. In cha-
rakteristischen Exemplaren läßt sich hier die Entwick-
lung der Cham-, der Khmer- und der siamesischen
Plastik vom 8. bis zum 19. Jahrhundert verfolgen.
Auf dem Rückweg betritt man vom blauen Assam-
saal aus den Raum, der das islamische Kunstgewerbe
enthält. Zu der schönen mesopotamischen und persi-
schen Keramik (9.—16. Jahrhundert) sind hier zwei
weltberühmte Stücke getreten: das tauschierte Bronze-
becken (Mosul, 1233 —1250) aus der Staatsbibliothek
und der fatimidische Hirsch (Ägypten, 10.—n. Jahr-
hundert) des Nationalmuseums. — Der nächste ver-
dunkelte Saal ist dem Theater gewidmet und von Dr.
Rapp vom Theatermuseum eingerichtet. Ein birma-
nisches Marionettentheater, mit allem Drum und Dran
von Scherman in einer Vorstadt Rangoons aufgekauft,
nimmt die ganze Rückwand ein, in den beleuchteten
Pulten schwimmen javanische Wayang, siamesische,
chinesische und türkische Schattenfiguren gespenstisch
auf dem milchweißen Grunde.
Die Treppe in das zweite Stockwerk begleiten zu-
erst japanische Zunftzeichen, dann empfangen, vor
der rotbraunen Fensterwand stehend, altkolumbische
Götterfiguren den Besucher. An den Seitenwänden
zeigen sich die bewegten, eleganten Schattenspielfigu-
ren Siams. — Der erste Saal zur Rechten ist für Nord-
und Mittelamerika bestimmt; hier sind die Polarvölker
vertreten, die Indianer Nordamerikas und nicht zu-
letzt, durch groteske und phantastische Skulpturen, die
alten Kulturen Guatemalas und Mexikos. Der zweite
Raum ist fast ausschließlich von der berühmten süd-
amerikanischen Sammlung Spix und Martius belegt,
die schon 1820 in München war und die älteste ge-
schlossene Sammlung ethnographischer Gegenstände
darstellt, die auf wissenschaftlicher Grundlage aufge-
baut worden ist. Fast alles, was in den drei folgenden
Sälen und dem riesigen Mittelraum zu finden ist,
stammt aus bolivianischen und peruanischen Gräbern;
es sind das die stummen Zeugen der entschwundenen
Inka-Kultur, deren Größe und Reichtum aus den
Textilien und der Keramik unschwer ermessen wer-
den kann.
Der ganze linke Flügel des zweiten Stockwerks ist
für Afrika eingeräumt. Hier ist der kleine Oberlicht-
saal nach Inhalt und Aufstellung besonders glücklich
geraten; die Gebilde der Bantuvölker (Kaffern), die
hier untergebracht sind, werden den Kunstgewerblern
eine Fülle von Anregungen geben können. Der nächste
Saal ist dem ehemaligen deutschen Kolonialbesitz ge-
widmet, daran schließt sich ein Raum mit westaffi-
kanischer Holzplastik. Durchschreitet man dann den
kleinen Saal für das Kongogebiet und Westafrika, so
endet die Wanderung in dem fein abgetönten Kabi-
nett, das die rätselhaften Bronzegüsse und Elfenbein-
schnitzereien aus Benin birgt.
Ein scheinbar unentwirrbares Vielerlei von Gestalt
und Gehalt ist hier ausgebreitet, der unbefangene Be-
sucher wird beim erstenmal sich verloren geben und
aufs reine Schauen sich beschränken müssen. Mit der
Zeit aber werden sich ihm doch bestimmte Gruppen
zusammenschließen und langsam wird er dahin kom-
men, ganz allgemeine Formvorstellungen mit den
Namen Ostafrika, Mittelamerika und Hinterindien zu
verbinden. Eines Tages scheiden sich die Skulpturen
Alt-Guatemalas von denen Alt-Mexikos, man wun-
dert sich dann, daß das Auge so lange stumpf gewesen
ist und diese Unterschiede nicht gesehen hat. Haben
sich so die größeren Zusammenhänge zu erkennen
gegeben, so wird man auch gewahr, daß alle Objekte
eines Kulturkreises durch eine mehr oder weniger aus-
geprägte Familienähnlichkeit miteinander verknüpft
sind, was jedoch, wie bei Geschwistern, nicht aus-
schließt, daß ganz bedeutende interne Verschieden-
heiten vorhanden sein können. An manchen Stellen
wird es dann deutlich, daß man nicht von alters her
nach denselben Gestaltungsprinzipien geschaffen, daß
vielmehr eine Abfolge scharf umrissener Stile statt-
gefunden hat. Schließlich entgeht es dem aufmerk-
samen Beobachter nicht, daß den primitiven Völkern,
über alle rassemäßigen Bindungen hinweg, ganz be-
stimmte Ausdrucksformen zu eigen sind, und daß ge-
nau so bei hochentwickelten Kulturen, die des Abend-
landes nicht ausgenommen, die Frühstufen wie die
späten Stilphasen miteinander verwandt erscheinen.
So besehen, wird das Völkerkundemuseum nicht nur
Kunde geben von der Verschiedenheit der mensch-
lichen Rassen, ihrer Lebensbedingungen und ihrer
Kulturen, sondern darüber hinaus eine große und
reiche Idee zum Leben erwecken: die Idee von der
gesetzmäßig bedingten Entwicklung der Menschheit.
Ludwig Bachhofer
158