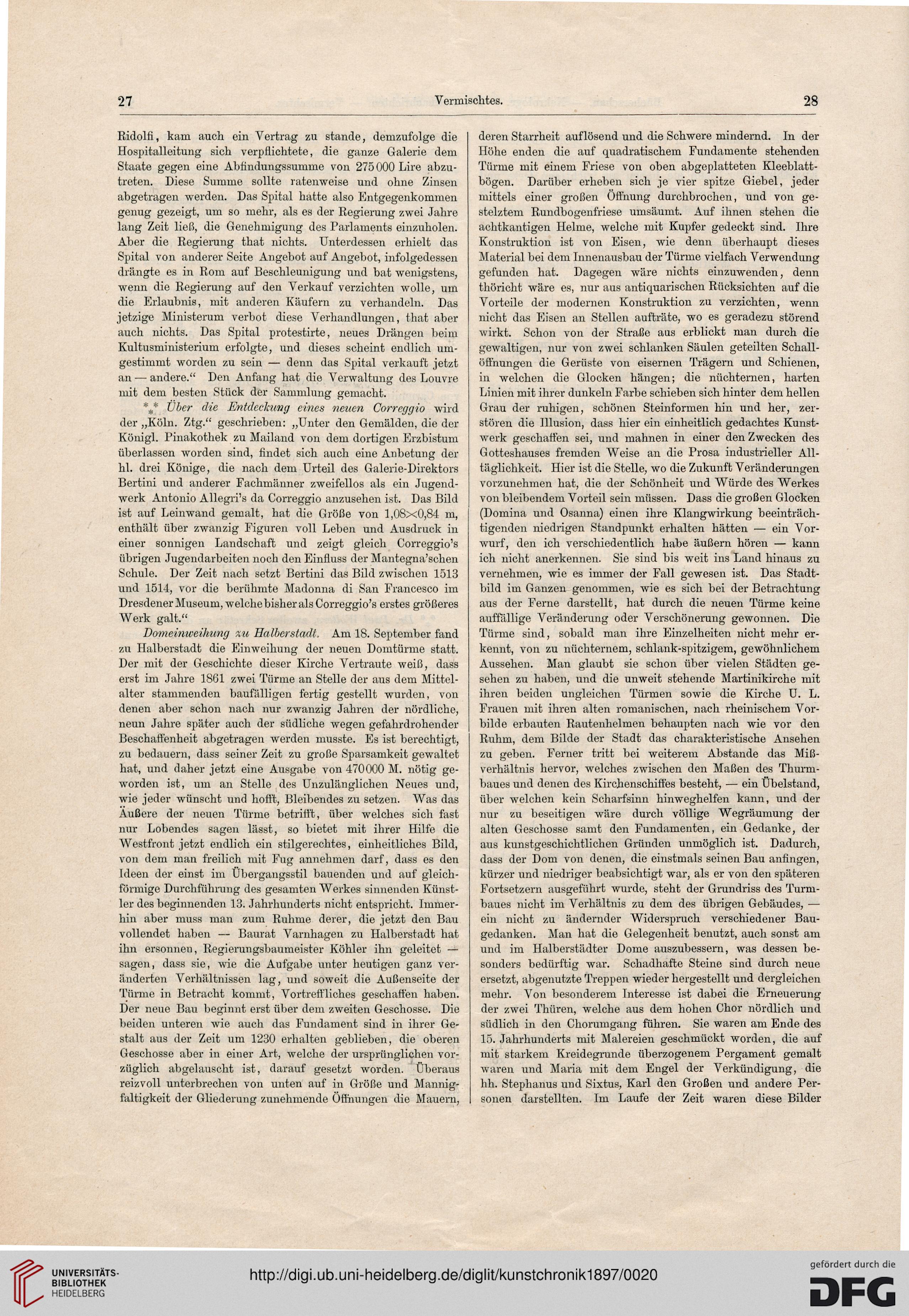27
Vermischtes.
28
Ridolfi, kam auch ein Vertrag zu stände, demzufolge die
Hospitalleitung sich verpflichtete, die ganze Galerie dem
Staate gegen eine Abfindungssumme von 275000 Lire abzu-
treten. Diese Summe sollte ratenweise und ohne Zinsen
abgetragen werden. Das Spital hatte also Entgegenkommen
genug gezeigt, um so mehr, als es der Regierung zwei Jahre
lang Zeit ließ, die Genehmigung des Parlaments einzuholen.
Aber die Regierung that nichts. Unterdessen erhielt das
Spital von anderer Seite Angebot auf Angebot, infolgedessen
drängte es in Rom auf Beschleunigung und bat wenigstens,
wenn die Regierung auf den Verkauf verzichten wolle, um
die Erlaubnis, mit anderen Käufern zu verhandeln. Das
jetzige Ministerum verbot diese Verhandlungen, that aber
auch nichts. Das Spital protestirte, neues Drängen beim
Kultusministerium erfolgte, und dieses scheint endlich um-
gestimmt worden zu sein — denn das Spital verkauft jetzt
an — andere." Den Anfang hat die Verwaltung des Louvre
mit dem besten Stück der Sammlung gemacht.
*„* Uber die Entdeckung eines neuen Corrcggio wird
der „Köln. Ztg." geschrieben: „Unter den Gemälden, die der
Königl. Pinakothek zu Mailand von dem dortigen Erzbistum
überlassen worden sind, findet sich auch eine Anbetung der
hl. drei Könige, die nach dem Urteil des Galerie-Direktors
Bertini und anderer Fachmänner zweifellos als ein Jugend-
werk Antonio Allegri's da Correggio anzusehen ist. Das Bild
ist auf Leinwand gemalt, hat die Größe von 1,08x0,84 m,
enthält über zwanzig Figuren voll Leben und Ausdruck in
einer sonnigen Landschaft und zeigt gleich Correggio's
übrigen Jugendarbeiten noch den Einfluss der Mantegna'schen
Schule. Der Zeit nach setzt Bertini das Bild zwischen 1513
und 1514, vor die berühmte Madonna di San Francesco im
Dresdener Museum, welchebisher als Correggio's erstes größeres
Werk galt."
Domeinweihimg %u Halberstadt. Am 18. September fand
zu Halberstadt die Einweihung der neuen Domtürme statt.
Der mit der Geschichte dieser Kirche Vertraute weiß, dass
erst im Jahre 1861 zwei Türme an Stelle der aus dem Mittel-
alter stammenden baufälligen fertig gestellt wurden, von
denen aber schon nach nur zwanzig Jahren der nördliche,
neun Jahre später auch der südliche wegen gefahrdrohender
Beschaffenheit abgetragen werden musste. Es ist berechtigt,
zu bedauern, dass seiner Zeit zu große Sparsamkeit gewaltet
hat, und daher jetzt eine Ausgabe von 470000 M. nötig ge-
worden ist, um an Stelle des Unzulänglichen Neues und,
wie jeder wünscht und hofft, Bleibendes zu setzen. Was das
Außere der neuen Türme betrifft, über welches sich fast
nur Lobendes sagen lässt, so bietet mit ihrer Hilfe die
Westfront jetzt endlich ein stilgerechtes, einheitliches Bild,
von dem man freilich mit Fug annehmen darf, dass es den
Ideen der einst im Übergangsstil bauenden und auf gleich-
förmige Durchführung des gesamten Werkes sinnenden Künst-
ler des beginnenden 13. Jahrhunderts nicht entspricht. Immer-
hin aber muss man zum Ruhme derer, die jetzt den Bau
vollendet haben — Baurat Varnhagen zu Halberstadt hat
ihn ersonnen, Regierungsbaumeister Köhler ihn geleitet —
sagen, dass sie, wie die Aufgabe unter heutigen ganz ver-
änderten Verhältnissen lag, und soweit die Außenseite der
Türme in Betracht kommt, Vortreffliches geschaffen haben.
Der neue Bau beginnt erst über dem zweiten Geschosse. Die
beiden unteren wie auch das Fundament sind in ihrer Ge-
stalt aus der Zeit um 1230 erhalten geblieben, die oberen
Geschosse aber in einer Art, welche der ursprünglichen vor-
züglich abgelauscht ist, darauf gesetzt worden. Überaus
reizvoll unterbrechen von unten auf in Größe und Mannig-
faltigkeit der Gliederung zunehmende Öffnungen die Mauern,
deren Starrheit auflösend und die Schwere mindernd. In der
Höhe enden die auf quadratischem Fundamente stehenden
Türme mit einem Friese von oben abgeplatteten Kleeblatt-
bögen. Darüber erheben sich je vier spitze Giebel, jeder
mittels einer großen Öffnung durchbrochen, und von ge-
stelztem Rundbogenfriese umsäumt. Auf ihnen stehen die
achtkantigen Helme, welche mit Kupfer gedeckt sind. Ihre
Konstruktion ist von Eisen, wie denn überhaupt dieses
Material bei dem Innenausbau der Türme vielfach Verwendung
gefunden hat. Dagegen wäre nichts einzuwenden, denn
thöricht wäre es, nur aus antiquarischen Rücksichten auf die
Vorteile der modernen Konstruktion zu verzichten, wenn
nicht das Eisen an Stellen aufträte, wo es geradezu störend
wirkt. Schon von der Straße aus erblickt man durch die
gewaltigen, nur von zwei schlanken Säulen geteilten Schall-
Öffnungen die Gerüste von eisernen Trägern und Schienen,
in welchen die Glocken hängen; die nüchternen, harten
Linien mit ihrer dunkeln Farbe schieben sich hinter dem hellen
Grau der ruhigen, schönen Steinformen hin und her, zer-
stören die Illusion, dass hier ein einheitlich gedachtes Kunst-
werk geschaffen sei, und mahnen in einer den Zwecken des
Gotteshauses fremden Weise an die Prosa industrieller All-
täglichkeit. Hier ist die Stelle, wo die Zukunft Veränderungen
vorzunehmen hat, die der Schönheit und Würde des Werkes
von bleibendem Vorteil sein müssen. Dass die großen Glocken
(Domina und Osanna) einen ihre Klangwirkung beeinträch-
tigenden niedrigen Standpunkt erhalten hätten — ein Vor-
wurf, den ich verschiedentlich habe äußern hören — kann
ich nicht anerkennen. Sie sind bis weit ins Land hinaus zu
vernehmen, wie es immer der Fall gewesen ist. Das Stadt-
bild im Ganzen genommen, wie es sich bei der Betrachtung
aus der Ferne darstellt, hat durch die neuen Türme keine
auffällige Veränderung oder Verschönerung gewonnen. Die
Türme sind, sobald man ihre Einzelheiten nicht mehr er-
kennt, von zu nüchternem, schlank-spitzigem, gewöhnlichem
Aussehen. Man glaubt sie schon über vielen Städten ge-
sehen zu haben, und die unweit stehende Martinikirche mit
ihren beiden ungleichen Türmen sowie die Kirche U. L.
Frauen mit ihren alten romanischen, nach rheinischem Vor-
bilde erbauten Rautenhelmen behaupten nach wie vor den
Ruhm, dem Bilde der Stadt das charakteristische Ansehen
zu geben. Ferner tritt bei weiterem Abstände das Miß-
verhältnis hervor, welches zwischen den Maßen des Thurm-
baues und denen des Kirchenschiffes besteht, — ein Übelstand,
über welchen kein Scharfsinn hinweghelfen kann, und der
nur zu beseitigen wäre durch völlige Wegräumung der
alten Geschosse samt den Fundamenten, ein Gedanke, der
aus kunstgeschichtlichen Gründen unmöglich ist. Dadurch,
dass der Dom von denen, die einstmals seinen Bau anfingen,
kürzer und niedriger beabsichtigt war, als er von den späteren
Fortsetzern ausgeführt wurde, steht der Grundriss des Turm-
baues nicht im Verhältnis zu dem des übrigen Gebäudes, —
ein nicht zu ändernder Widerspruch verschiedener Bau-
gedanken. Man hat die Gelegenheit benutzt, auch sonst am
und im Halberstädter Dome auszubessern, was dessen be-
sonders bedürftig war. Schadhafte Steine sind durch neue
ersetzt, abgenutzte Treppen wieder hergestellt und dergleichen
mehr. Von besonderem Interesse ist dabei die Erneuerung
der zwei Thüren, welche aus dem hohen Chor nördlich und
südlich in den Chorumgang führen. Sie waren am Ende des
15. Jahrhunderts mit Malereien geschmückt worden, die auf
mit starkem Kreidegrunde überzogenem Pergament gemalt
waren und Maria mit dem Engel der Verkündigung, die
hh. Stephanus und Sixtus, Karl den Großen und andere Per-
sonen darstellten. Im Laufe der Zeit waren diese Bilder
Vermischtes.
28
Ridolfi, kam auch ein Vertrag zu stände, demzufolge die
Hospitalleitung sich verpflichtete, die ganze Galerie dem
Staate gegen eine Abfindungssumme von 275000 Lire abzu-
treten. Diese Summe sollte ratenweise und ohne Zinsen
abgetragen werden. Das Spital hatte also Entgegenkommen
genug gezeigt, um so mehr, als es der Regierung zwei Jahre
lang Zeit ließ, die Genehmigung des Parlaments einzuholen.
Aber die Regierung that nichts. Unterdessen erhielt das
Spital von anderer Seite Angebot auf Angebot, infolgedessen
drängte es in Rom auf Beschleunigung und bat wenigstens,
wenn die Regierung auf den Verkauf verzichten wolle, um
die Erlaubnis, mit anderen Käufern zu verhandeln. Das
jetzige Ministerum verbot diese Verhandlungen, that aber
auch nichts. Das Spital protestirte, neues Drängen beim
Kultusministerium erfolgte, und dieses scheint endlich um-
gestimmt worden zu sein — denn das Spital verkauft jetzt
an — andere." Den Anfang hat die Verwaltung des Louvre
mit dem besten Stück der Sammlung gemacht.
*„* Uber die Entdeckung eines neuen Corrcggio wird
der „Köln. Ztg." geschrieben: „Unter den Gemälden, die der
Königl. Pinakothek zu Mailand von dem dortigen Erzbistum
überlassen worden sind, findet sich auch eine Anbetung der
hl. drei Könige, die nach dem Urteil des Galerie-Direktors
Bertini und anderer Fachmänner zweifellos als ein Jugend-
werk Antonio Allegri's da Correggio anzusehen ist. Das Bild
ist auf Leinwand gemalt, hat die Größe von 1,08x0,84 m,
enthält über zwanzig Figuren voll Leben und Ausdruck in
einer sonnigen Landschaft und zeigt gleich Correggio's
übrigen Jugendarbeiten noch den Einfluss der Mantegna'schen
Schule. Der Zeit nach setzt Bertini das Bild zwischen 1513
und 1514, vor die berühmte Madonna di San Francesco im
Dresdener Museum, welchebisher als Correggio's erstes größeres
Werk galt."
Domeinweihimg %u Halberstadt. Am 18. September fand
zu Halberstadt die Einweihung der neuen Domtürme statt.
Der mit der Geschichte dieser Kirche Vertraute weiß, dass
erst im Jahre 1861 zwei Türme an Stelle der aus dem Mittel-
alter stammenden baufälligen fertig gestellt wurden, von
denen aber schon nach nur zwanzig Jahren der nördliche,
neun Jahre später auch der südliche wegen gefahrdrohender
Beschaffenheit abgetragen werden musste. Es ist berechtigt,
zu bedauern, dass seiner Zeit zu große Sparsamkeit gewaltet
hat, und daher jetzt eine Ausgabe von 470000 M. nötig ge-
worden ist, um an Stelle des Unzulänglichen Neues und,
wie jeder wünscht und hofft, Bleibendes zu setzen. Was das
Außere der neuen Türme betrifft, über welches sich fast
nur Lobendes sagen lässt, so bietet mit ihrer Hilfe die
Westfront jetzt endlich ein stilgerechtes, einheitliches Bild,
von dem man freilich mit Fug annehmen darf, dass es den
Ideen der einst im Übergangsstil bauenden und auf gleich-
förmige Durchführung des gesamten Werkes sinnenden Künst-
ler des beginnenden 13. Jahrhunderts nicht entspricht. Immer-
hin aber muss man zum Ruhme derer, die jetzt den Bau
vollendet haben — Baurat Varnhagen zu Halberstadt hat
ihn ersonnen, Regierungsbaumeister Köhler ihn geleitet —
sagen, dass sie, wie die Aufgabe unter heutigen ganz ver-
änderten Verhältnissen lag, und soweit die Außenseite der
Türme in Betracht kommt, Vortreffliches geschaffen haben.
Der neue Bau beginnt erst über dem zweiten Geschosse. Die
beiden unteren wie auch das Fundament sind in ihrer Ge-
stalt aus der Zeit um 1230 erhalten geblieben, die oberen
Geschosse aber in einer Art, welche der ursprünglichen vor-
züglich abgelauscht ist, darauf gesetzt worden. Überaus
reizvoll unterbrechen von unten auf in Größe und Mannig-
faltigkeit der Gliederung zunehmende Öffnungen die Mauern,
deren Starrheit auflösend und die Schwere mindernd. In der
Höhe enden die auf quadratischem Fundamente stehenden
Türme mit einem Friese von oben abgeplatteten Kleeblatt-
bögen. Darüber erheben sich je vier spitze Giebel, jeder
mittels einer großen Öffnung durchbrochen, und von ge-
stelztem Rundbogenfriese umsäumt. Auf ihnen stehen die
achtkantigen Helme, welche mit Kupfer gedeckt sind. Ihre
Konstruktion ist von Eisen, wie denn überhaupt dieses
Material bei dem Innenausbau der Türme vielfach Verwendung
gefunden hat. Dagegen wäre nichts einzuwenden, denn
thöricht wäre es, nur aus antiquarischen Rücksichten auf die
Vorteile der modernen Konstruktion zu verzichten, wenn
nicht das Eisen an Stellen aufträte, wo es geradezu störend
wirkt. Schon von der Straße aus erblickt man durch die
gewaltigen, nur von zwei schlanken Säulen geteilten Schall-
Öffnungen die Gerüste von eisernen Trägern und Schienen,
in welchen die Glocken hängen; die nüchternen, harten
Linien mit ihrer dunkeln Farbe schieben sich hinter dem hellen
Grau der ruhigen, schönen Steinformen hin und her, zer-
stören die Illusion, dass hier ein einheitlich gedachtes Kunst-
werk geschaffen sei, und mahnen in einer den Zwecken des
Gotteshauses fremden Weise an die Prosa industrieller All-
täglichkeit. Hier ist die Stelle, wo die Zukunft Veränderungen
vorzunehmen hat, die der Schönheit und Würde des Werkes
von bleibendem Vorteil sein müssen. Dass die großen Glocken
(Domina und Osanna) einen ihre Klangwirkung beeinträch-
tigenden niedrigen Standpunkt erhalten hätten — ein Vor-
wurf, den ich verschiedentlich habe äußern hören — kann
ich nicht anerkennen. Sie sind bis weit ins Land hinaus zu
vernehmen, wie es immer der Fall gewesen ist. Das Stadt-
bild im Ganzen genommen, wie es sich bei der Betrachtung
aus der Ferne darstellt, hat durch die neuen Türme keine
auffällige Veränderung oder Verschönerung gewonnen. Die
Türme sind, sobald man ihre Einzelheiten nicht mehr er-
kennt, von zu nüchternem, schlank-spitzigem, gewöhnlichem
Aussehen. Man glaubt sie schon über vielen Städten ge-
sehen zu haben, und die unweit stehende Martinikirche mit
ihren beiden ungleichen Türmen sowie die Kirche U. L.
Frauen mit ihren alten romanischen, nach rheinischem Vor-
bilde erbauten Rautenhelmen behaupten nach wie vor den
Ruhm, dem Bilde der Stadt das charakteristische Ansehen
zu geben. Ferner tritt bei weiterem Abstände das Miß-
verhältnis hervor, welches zwischen den Maßen des Thurm-
baues und denen des Kirchenschiffes besteht, — ein Übelstand,
über welchen kein Scharfsinn hinweghelfen kann, und der
nur zu beseitigen wäre durch völlige Wegräumung der
alten Geschosse samt den Fundamenten, ein Gedanke, der
aus kunstgeschichtlichen Gründen unmöglich ist. Dadurch,
dass der Dom von denen, die einstmals seinen Bau anfingen,
kürzer und niedriger beabsichtigt war, als er von den späteren
Fortsetzern ausgeführt wurde, steht der Grundriss des Turm-
baues nicht im Verhältnis zu dem des übrigen Gebäudes, —
ein nicht zu ändernder Widerspruch verschiedener Bau-
gedanken. Man hat die Gelegenheit benutzt, auch sonst am
und im Halberstädter Dome auszubessern, was dessen be-
sonders bedürftig war. Schadhafte Steine sind durch neue
ersetzt, abgenutzte Treppen wieder hergestellt und dergleichen
mehr. Von besonderem Interesse ist dabei die Erneuerung
der zwei Thüren, welche aus dem hohen Chor nördlich und
südlich in den Chorumgang führen. Sie waren am Ende des
15. Jahrhunderts mit Malereien geschmückt worden, die auf
mit starkem Kreidegrunde überzogenem Pergament gemalt
waren und Maria mit dem Engel der Verkündigung, die
hh. Stephanus und Sixtus, Karl den Großen und andere Per-
sonen darstellten. Im Laufe der Zeit waren diese Bilder